Bettina HagedornInsofern besuchte eine starke Delegation von SPD-Bundestagsabgeordneten am 8. August den NOK bei Hochdonn – zwei Schleswig-Holsteiner und zwei Hamburger, zwei ausgewiesene Verkehrsexperten mit Mathias Stein und der verkehrspolitischen Sprecherin Dorothee Martin sowie mein verantwortlicher Haushaltskollege für das Verkehrsministerium Metin Hakverdi und ich als stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Der Präsident der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Witte sowie sein für den NOK zuständiger Mitarbeiter-Stab war ebenso wie die Vertreterin des Verkehrsministeriums vor Ort, um uns über die aktuellsten Hiobsbotschaften – die massiven Böschungseinbrüche am NOK zwischen Hochdonn und Brunsbüttel – zu informieren und mit uns über die dramatischen Auswirkungen der massiven Haushaltskürzungen auf die geplanten Baumaßnahmen am NOK zu diskutieren. Bild: studio kohlmeier berlin Wenn es nicht gelingen sollte, in den parlamentarischen Haushaltsberatungen in diesem Herbst diese Kürzungen rückgängig zu machen, dann sind weitere Verzögerungen und Kostenexplosionen an dieser wichtigsten künstlichen Wasserstraße der Welt vorprogrammiert, die de facto mehr Verkehr bewältigt als der Panama- und der Suez-Kanal zusammen. Die Aufgabe, diese für die Logistikketten in Nordeuropa so wichtige Wasserstraße, konsequent durch intakte Schleusentore und konsequenten Baufortschritt bei allen Investitionsvorhaben zwischen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau in gutem Zustand offen zu halten, ist von höchstem öffentlichem Interesse. Deshalb setze ich mich mit meinen Kollegen Matthias Stein, Metin Hakverdi und Dorothee Martin weiterhin mit ganzer Kraft für den Erhalt und Ausbau des NOK ein. Nicht zu vergessen: durch das umweltfreundliche Passieren des NOK werden enorme Treibstoffmengen gespart und das Klima geschützt – im Schnitt „spart“ jedes Schiff 260 Seemeilen und 14 – 18 Stunden Zeit bei einer Kanalpassage im Vergleich zu der Umfahrung Skagens. Minister Wissing hat mit der Verantwortung für dieses volkswirtschaftlich wie klimapolitisch so herausragenden Großprojekt angesichts des vergangenen Jahrzehnts des stümperhaften ‚Schneckentempos‘ seiner drei CSU-Vorgänger im Verkehrsministerium eine Herkulesaufgabe übernommen, die mit diesen drastisch gekürzten Geldern im Bundeshaushalt 2023 nicht zu bewältigen sein wird. Nord-Ostsee-Kanal Verkehrspolitik Xenius: Wasserstraßen Wie hält man Kanäle und Flüsse befahrbar? Sonntag, 11. September 2022, 07:10 bis 07:35 Uhr Montag, 12. September 2022, 11:35 bis 12:00 Uhr Wasserstraßen sind als Transportwege für die Binnenschifffahrt seit Jahrhunderten lebenswichtig. Doch so manche davon macht mittlerweile Probleme, für immer größer werdende Schiffe sind sie zu alt, zu flach oder zu eng. Wie hält man Flüsse und vor allem Kanäle befahrbar? Dörthe Eickelberg und Pierre Girard sind in Brunsbüttel: Hier beginnt der Nord-Ostsee-Kanal, die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Gebaut wurde der Kanal noch in der Kaiserzeit. Große Teile von Bausubstanz und Technik der großen Schleusen in Brunsbüttel befinden sich noch im Originalzustand. Eine lange überfällige Grundsanierung ist in Gang, doch „nebenbei“ muss auch der Kanal selbst laufend instand gehalten werden. Damit größere Containerfrachter stets genug Wasser unterm Kiel haben, wird hier rund um die Uhr gebaggert. Ein Job für die „Xenius“-Moderatoren: Dörthe sucht an Bord eines sogenannten Peilschiffs nach gefährlichen Untiefen und lotst ein Baggerschiff mit Pierre am Saugrüssel zum Einsatzort. In ganz anderen Dimensionen wird in der Elbe gebaggert. Um den Hamburger Hafen für Schiffe erreichbar zu halten, muss der mit Ebbe und Flut in den Fluss gelangende Nordseeschlick ständig ausgebaggert werden. Jährliche Kosten: rund 100 Millionen Euro. Und damit ist man den Schlick noch lange nicht los. Immerhin: der Fluss muss nicht bei laufendem Betrieb grundsaniert werden. Im Mittellandkanal kommt das an bestimmten Abschnitten regelmäßig vor. Dafür legt man einen Teil der Wasserstraße komplett trocken. „Xenius“ zeigt, wie das funktioniert, ohne dass die ganze Umgebung geflutet wird. Taucher untersuchen Tor und Schienen unter Wasser Nach mutmaßlichem Schaden an Schleusen in Brunsbüttel Spezialisten untersuchtendie Schäden. Danfoto Brunsbüttel Es war das Schlimmste befürchtet worden – doch am Montagvormittag kam die erlösende Nachricht. Die Nordkammer der großen Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) in Brunsbüttel konnte wieder in Betrieb gehen. Taucher hatten die Schäden unter Wasser untersucht und anschließend grünes Licht gegeben. Neben dem Tor wurde besonders das Schienensystem, auf dem das Tor rollt, in Augenschein genommen. Lange Staus auf beiden Seiten des Kanals Der Frachter „Coral Ivory“ hatte nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) am Sonnabend einen Maschinenschaden. Mit dem Anker hatte der Kapitän versucht, das Schiff abzubremsen. Welche Schäden er dabei verursachte, war zunächst offen. Die Schleuse wurde vorsorglich außer Betrieb genommen.Vor der Einfahrt zur Schleuse auf der Elbe stauten sich die Schiffe. Auch auf der Ostseite des NOK kam es zu massiven Verzögerungen bei der Schleusen-Abfertigung der Schiffe. Einige Kapitäne hatten sich sogar gegen Wartezeiten und für die deutlich längere Route um das Skagerrak entschieden. Denn am Wochenende, das stand schnell fest, konnten keine weitergehenden Untersuchungen der Schäden erfolgen. Erst am Montag rückten die Taucher an. Gegen 10 Uhr waren die Taucher aus dem Wasser: Keine feststellbare Schäden. „Um 11 Uhr hat die Schleuse nach ein paar Probedurchgängen wieder den Betrieb aufgenommen“, sagt WSA-Sprecher Thomas Fischer. Wäre die Unterwasserschiene beschädigt gewesen, hätte das eine langwierige Reparatur und lange Wartezeiten für die Schifffahrt auf der größten künstlichen Wasserstraße der Welt nach sich gezogen. Schleswig-Holstein Wir über uns Ein Containerschiff. © WSA Holtenau Foto: Christian Wolf Nord-Ostsee-Kanal: Kieler Schleuse bald wieder mit Ersatztor Stand: 13.05.2022 12:42 Uhr Rund zwei Jahre hatte die Kieler Schleuse kein Ersatztor, weil alle Tore durch Havarien beschädigt waren. In spätestens eineinhalb Wochen ändert sich das aber – mit der Übergabe des ersten reparierten Tores. von Christian Wolf Copyright NDR Ohne sie geht nichts an der Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal. Die Schleusentore sind unerlässlich für das Schleusen von Schiffen in und aus dem Kanal. Doch sie sind auch die Achillesferse der Schleuse. Immer wieder kommt es zwischen Frachtern und Toren zu Kontakt. Oft bleibt es bei leichten Beschädigungen, hin wieder gibt es aber auch schwere Havarien. Wie vor knapp zwei Jahren in Kiel-Holtenau, als im Spätsommer der Frachter „Else“ in ein Schleusentor krachte. Seitdem laufen die Reparaturarbeiten. Seit der Havarie hat die Kieler Schleuse kein Ersatztor mehr, jeder weitere Unfall hätte also fatale Folgen. Doch damit ist jetzt Schluss. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden“, erklärt der Projektleiter beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Heiko Dorn. „Es laufen gerade noch die letzten Arbeiten, aber das Tor ist weitestgehend repariert.“ In der Woche vor Himmelfahrt ist eine Übergabe geplant. Eine Person in Arbeitskleidung beugt sich am unteren Ende eines Betonrechtecks in einen offenen Spalt. © WSA Holtenau Foto: Christian Wolf 5 Bilder Kieler NOK-Schleuse: Die Reparatur der Schleusentore NOK-Schleuse: Komplizierte Reparatur kostete Zeit Eigentlich war geplant, das „Else-Tor“ schon im vergangenen Jahr wieder einzusetzen. Doch die Reparatur dauerte länger als zuvor geplant. „Wir waren darauf angewiesen, erst Stahl aus dem Tor rauszubauen, um es leichter zu machen, weil der Schaden kurz über der Wasserlinie war“, erklärt Dorn. Durch die Delle im Stahl hätte zudem viel erneuert werden müssen. „Insgesamt haben wir 20 Tonnen Stahl verbaut und einige Tausend Nieten getauscht, “ so der Projektleiter. Da die Schleusentore mehr als 100 Jahre alt sind, müssen die Arbeiter zudem oft auf alte Bauzeichnungen zurückgreifen. Auch das hat laut dem Projektleiter zu Verzögerungen geführt. Nun müssen nur noch kleinere Arbeiten durchgeführt werden, wie der Rückbau des Gerüstes, der Einbau der so genannten Reibhölzer und des Übergangs. Nach der Übergabe soll es dann auch schnell eingebaut werden, da ein weiteres Schleusentor in Kiel nach der Havarie mit dem Schiff „Wilson Goole“ auch dringend überholt werden muss. Weiteres Schleusentor soll im Anschluss repariert Doch die Arbeiten müssen erst einmal warten – voraussichtlich bis Ende August. „Dann ist auch endlich die Reparatur am „Akacia-Tor“ beendet“, so Jörg Brockmann, Sprecher der WSA in Kiel. Vor mehr als vier Jahren durchbrach der Frachter „Akacia“ das Tor, lag mit dem vorderen Teil auf dem Tor. Damit es aus der Schleusenkammer geholt werden konnte, musste es vorher in zwei Teile gesägt werden. Seit zwei Jahren sollte es eigentlich schon wieder im Betrieb sein, doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. „Durch Corona hat es beispielsweise Lieferengpässe gegeben,“ erklärt der Sprecher des Kieler WSA. „Auch hat es bei den Werftarbeitern immer wieder Ausbrüche des Virus gegeben, weswegen die Arbeit ruhen musste.“ Hinzu kam noch die Insolvenz der Nobiskurg Werft aus Rendsburg, die das Tor reparierte. WSA: Kosten für Reparatur belaufen sich auf mehrere Millionen Euro Die Kosten für die Instandsetzung beider Tore wird nicht billig. Beim „Else-Tor“ geht die WSA von rund einer Million Euro aus, was allerdings im Vergleich zum „Akacia-Tor“ fast schon wenig ist. „Bevor es die Schlussrechnung noch nicht gibt, lässt sich das schwer abschätzen, aber die Kosten werden am Ende zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegen,“ so Brockmann. Doch nach der Reparatur ist vor der Reparatur. Sobald das „Akacia-Tor“ an die WSA übergeben ist, soll so schnell wir möglich das „Wilson-Goole-Tor“ repariert werden. Doch so lange wie bei den beiden jetzigen Toren soll es dann nicht dauern. Das Schiff Akacia hat das Schleusentor in Kiel-Holtenau durchbrochen. © dpa-Bildfunk Foto: Daniel Friederichs/dpa Nord-Ostsee-Kanal: Schleusentor wird später fertig Neue Sparpläne: Was dem Nord-Ostsee-Kanal jetzt droht Verkehrsminister Wissing kürzt die Investitionen für Wasserstraßen um ein Drittel – die SPD-Haushälterin Bettina Hagedorn befürchtet Dramatisches Ausbauarbeiten schon jetzt stark im Verzug: Die neue Levensauer Hochbrücke wird erst 2026 fertig. Illustration: WSA Henning Baethge Copyright Norddeutsche Rundschau danke Ralph Poeschus Bundesverkehrsminister Volker Wissing will im nächsten Jahr die Ausgaben für den Erhalt und Bau von Wasserstraßen in Deutschland deutlich kürzen. Statt 909 Millionen Euro in diesem Jahr und 656 Millionen im letzten plant der FDP-Politiker dafür im nächsten Jahr nur 594 Millionen Euro ein. Das geht nach Angaben der ostholsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Haushaltsausschuss-Vorsitzenden Bettina Hagedorn aus dem Etatentwurf der Bundesregierung für 2023 hervor. „Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass die Mittel im Verkehrsetat für Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen gegenüber dem Vorjahr drastisch gekürzt wurden“, kritisiert Hagedorn. Sie befürchtet daher gravierende Folgen für den ohnehin schon stark verzögerten Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals. „Es ist ganz klar, dass von einem solchen Kahlschlag auch die elementar wichtigen Investitionen für den Ausbau und die Grundinstandsetzung des Nord-Ostsee-Kanals massiv betroffen sein werden.“ Schon jetzt sind die Ausbaumaßnahmen für den Kanal stark in Verzug geraten. Die neue Schleuse in Brunsbüttel wird erst 2026 statt wie einst geplant 2018 fertig, die neue Levensauer Hochbrücke ebenfalls erst 2026 statt 2019 und die Verbreiterung der Oststrecke frühestens 2030 statt 2021. Nicht zuletzt durch diese Verzögerungen sind die Kosten für die laufenden Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal stark gestiegen – auf inzwischen geschätzte 2,6 Milliarden Euro statt ursprünglich gut 700 Millionen. Hinzu kommen unerwartete Mehrausgaben in voraussichtlich zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe wegen der jetzt entdeckten schweren Uferschäden am Kanal. Wie berichtet drohen vor allem an der westlichen Kanalstrecke an rund hundert Stellen die Böschungen und Betriebswege wegzubrechen, weil sie unterspült sind. Die Ufer auf beiden Seiten des Kanals müssen daher aufwendig saniert werden. Hagedorn fürchtet nun einen Teufelskreis von immer neuen Verzögerungen und Verteuerungen am Nord-Ostsee-Kanal. Nachdem schon drei CSU-Verkehrsminister den Ausbau und die Sanierung des Kanals verschleppt und damit „natürlich“ die Kosten in die Höhe getrieben hätten, lasse nun auch der Haushaltsentwurf von FDP-Minister Wissing „weitere Verzögerungen und Kostenexplosionen“ befürchten, warnt Hagedorn – und wettert: „Dieser Regierungsentwurf wird den Herausforderungen am Nord-Ostsee-Kanal in keinster Weise gerecht.“ Daher werde der Haushaltsausschuss dem Minister bei den Beratungen ab September „sehr viele kritische Fragen stellen“. Für Hagedorn ist das Ergebnis schon klar: „Volker Wissing muss dem Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals endlich eindeutig Priorität geben!“, sagt sie. Meeresspiegel-Anstieg verteuert Schleusen Nord-Ostsee-Kanal: Kosten für Neubau in Kiel steigen auf 650 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie geplant Henning Baethge Die Kosten für den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanal steigen immer weiter. Nach der fünften Schleuse in Brunsbüttel und dem Ausbau der Oststrecke samt neuer Levensauer Hochbrücke wird nun auch der Ersatzbau für die beiden derzeit stillgelegten kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau viel teurer als geplant. Statt 240 Millionen Euro sind es nun 650 Millionen„Die voraussichtlichen Gesamtausgaben werden sich gegenüber dem in 2016 genehmigten Entwurf von ursprünglich 240 Millionen Euro nach heutigem Kenntnisstand auf 650 Millionen Euro erhöhen,“ teilt Bundesverkehrsminister Volker Wissing der schleswig-holsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Haushaltsausschuss-Vorsitzenden Bettina Hagedorn in einem Brief mit. In der bisher letzten Schätzung war Wissings CSU-Vorgänger Andreas Scheuer zwar auch schon von einer Kostensteigerung ausgegangen – aber nur auf 315 Millionen Euro. Für die Kostenexplosion bei den Kieler Schleusen gibt es laut FDP-Minister Wissing gleich mehrere Gründe. Allein 100 Millionen Euro gehen auf allgemeine Baupreissteigerungen zurück. Zudem verursacht der langfristig zu erwartende Anstieg des Meeresspiegels Extrakosten: Weil sich der Erd- und Wasserdruck auf die Schleusen dadurch zu erhöhen droht, müssen sie zusätzlich verstärkt werden. Auch muss deshalb das ursprünglich vorgesehene Torsystem geändert werden, was dazu führt, dass das ganze Bauwerk nun 37 Meter länger wird als bisher geplant und künftig 254 Meter messen wird. Die Schleusenkammer ist künftig für Schiffe bis 155 Meter statt bisher 125 Meter geeignet. Und schließlich hat Wissing nun auch noch einen Risikopuffer für unvorhersehbare Mehrausgaben von 130 Millionen Euro eingeplant. Die Fertigstellung der noch in der Planung befindlichen neuen Schleusen droht sich durch die Kostenexplosion zu verzögern. Einen Zeitpunkt für den Baubeginn oder Abschluss gibt Wissing gar nicht erst an, aber warnt schon mal, dass der Baustart „gerade auch mit Blick auf die erhebliche Kostensteigerung“ nur bei „ausreichenden Haushaltsmittel„ möglich sei. Derzeit läuft der Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel komplett durch die beiden großen Schleusen. Die beiden kleinen Schleusen sind seit 2014 stillgelegt und inzwischen zugeschüttet. Auch Reparaturdock in Brunsbüttel viel teurerTeurer werden am Nord-Ostsee-Kanal aber nicht nur die kleinen Schleusen in Kiel, sondern auch das geplante Trockendock zur Reparatur von Schleusentoren in Brunsbüttel und die dort vorgesehen Torliegeplätze. Hier erhöhen sich die Kosten ebenfalls um mehr als das doppelte – von 31 Millionen Euro auf 63 Millionen. Insgesamt kosten die laufenden Ausbaumaßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal damit statt einst geplanter 721 Millionen Euro gut 2,6 Milliarden. Und dabei sind die später anstehende Sanierung der großen Kieler Schleusen und die mindestens 263 Millionen Euro teure Vertiefung des Kanals noch nicht mal mitgerechnet. Letztere kann erst dann losgehen, wenn die Oststrecke ausgebaut ist – und auch dafür nennt Wissing kein Datum. Fachleute gegen von frühestens 2030 aus. SPD-Politikerin Hagedorn gibt CSU-Ministern Schuld SPD-Politikerin Hagedorn macht Wissings drei CSU-Vorgänger für die Misere beim Kanalausbau verantwortlich. „Drei CSU-Verkehrsminister haben seit 2009 alle wichtigen Sanierungsmaßnahmen verschleppt, obwohl Baurecht vorlag und seit langem das Geld im Bundeshaushalt bereitsteht“, kritisiert sie gegenüber unserer Zeitung. Wegen dieser „Verschleppungstaktik“ seien die Kosten nun „natürlich explodiert und müssen jetzt im Haushalt 2023 realistisch abgebildet werden“. Für Wissing, sagt sie, sei das „ein schweres Erbe“. Seit einer Havarie vor dreieinhalb Jahren hat die Schleuse in Kiel-Holtenau ein Ersatztor. Die Reparatur des demolierten Tors dauert noch. Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.05.2022 | 19:30 Uhr bei Facebook empfehlen bei Twitter empfehlen Link zur Seite per Mail versenden Seite ausdrucken Nachrichten aus Schleswig-Holstein Ein Containerschiff. © WSA Holtenau Foto: Christian Wolf Nord-Ostsee-Kanal: Kieler Schleuse bald wieder mit Ersatztor Bei einer Havarie mit dem Frachter „Else“ vor fast zwei Jahren wurde das Tor beschädigt. Nun ist es fast fertig repariert. https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL25kci5kZS9hYWM5YjczOS1hODVkLTQ5MDUtODc3Ny0yNDVkNTZkOGMzYjI Super Video NOK https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordstory/Durch-den-Nord-Ostsee-Kanal-Seefahrt-unter-Druck,sendung751164.htm Video NOK super Copyright Verkehr auf Nord-Ostsee-Kanal legt wieder zu Aktualisiert am 24.03.2022-17:47 Merken 0 2 Min. Der Verkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist 2021 nach dem Einbruch im ersten Corona-Jahr wieder besser in Fahrt gekommen. Wie die Kanalverwaltung am Freitag in Kiel mitteilte, wurden über den Wasserweg 85,2 Millionen Güter transportiert und damit 15,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt 27 293 Schiffe befuhren den Kanal. Das waren 8,1 Prozent mehr als 2020. Der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte, sprach von einem guten Jahr. Die Volkswirtschaften im nördlichen Europa hätten sich 2021 erholt. Der Kanal habe aber besonders auch von den hohen Preisen für Schiffstreibstoff profitiert. Der Verzicht auf die Erhebung der Befahrensabgabe bis Jahresende – eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie – machte den Kanal ebenfalls noch attraktiver. Die rund 100 Kilometer lange Verbindung zwischen Kiel und Brunsbüttel gilt als weltweit meistbefahrene künstliche Seewasserstraße. Im vorigen Jahr knüpften die Verkehrszahlen weitgehend an das Niveau der Vor-Corona-Jahre an, bei der Schiffszahl noch nicht ganz. Die transportierte Ladungsmenge hatte im Spitzenjahr 2008 aber mit 105 Millionen Tonnen auch schon deutlich höher gelegen. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres setzte sich der Aufwärtstrend beim Kanalverkehr mit zweistelligen Zuwachsraten fort. Die großen Bauvorhaben wie der Bau einer fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel, der Ausbau der Oststrecke zwischen Rendsburg und Kiel sowie die Vorbereitungen für einen Ersatz der Levensauer Hochbrücke nahe Kiel sind laut Witte sehr gut vorangekommen. 2921 seien 250 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau des Kanals geflossen. Fortgesetzt hat sich der Trend zu immer größeren Schiffen. Die gesamte Bruttoraumzahl (BRZ) wuchs 2021 um fast 15 Prozent auf gut 132,4 Millionen. Die Größe eines Durchschnittsschiffes erhöhte sich um fast 300 BRZ auf 4852. Die Haupttransportrouten liefen zwischen Schweden und den Niederlanden, zwischen Schweden und Großbritannien sowie zwischen Russland und den Niederlanden. Unter den Schiffstypen dominierten im Kanal 2021 Stückgut- und Massengutfrachter (12.948), Containerschiffe (4163) und Chemikalientanker (3349). Die Zahl der Sportboote erreichte nach einem Rückgang 2020 mit 11.048 auch wieder Vor-Corona-Niveau. 2021 ereigneten sich auf dem Kanal 63 Havarien im Bereich der Schleusen und deren Leitwerken sowie zwischen Schiffen. Bei 27.300 Schiffspassagen beträgt die Unfallquote damit 0,2 Prozent. Dennoch soll das Risiko, dass Schiffe Schleusen anfahren, weiter sinken. So gelten vom 1. April an verschärfte Kriterien, nach denen Schiffe Schlepper in Anspruch nehmen müssen, zum Beispiel abhängig von Tiefgang und Windstärke. Zudem muss während der Kanalpassage fachkundiges Personal im Maschinenraum sein, um bei einem technischen Ausfall sofort auf Handbetrieb umstellen zu können. Witte freute sich, dass nach jahrelanger Pause infolge einer Havarie seit 4. März eine neue Rendsburger Schwebefähre über dem Kanal im Einsatz ist. Allerdings wird sie mit Beginn der Osterferien am 4. April schon wieder außer Betrieb genommen – weil noch Restarbeiten zu erledigen sind, etwa zum Korrosionsschutz. Spätestens am 15. April und damit rechtzeitig zum Osterwochenende soll sie wieder fahren. Softwarefehler am NOK: Erste Schiffe werden wieder geschleust Stand: 20.03.2022 17:30 Uhr Ein Softwareproblem in der Verkehrszentrale in Brunsbüttel hat dafür gesorgt, dass auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) stundenlang nichts mehr ging. Nun werden kleinere Schiffe wieder geschleust. In Kiel und Brunsbüttel wurden seit Sonntagvormittag zunächst keine Schiffe mehr in den Nord-Ostsee-Kanal geschleust. Seit Sonntagnachmittag passieren kleinere Schiffe bis 130 Metern Länge wieder die Schleusen. Diese Schiffe fahren auf Sicht und mit Radar und sind nicht auf die fehlerhafte Software angewiesen. Martin Finnberg, Ältermann der Kieler Lotsenbruderschaft, sagte NDR Schleswig-Holstein am Sonntagnachmittag: „Unsere letzte Information ist, dass alles was so bis 120, 130 Meter geht, jetzt langsam wieder kommendarf. Alles was größer ist, darf im Moment nicht schleusen. Da warten im Moment bei uns fünf solcher Schiffe auf Einfahrt.“ AUDIO: NOK zeitweise komplett gesperrt (1 Min) Stau vor den Schleusenkammern Die Ursache für den zunächst komplett gesperrten NOK lag nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in einer neuen Software. In der Verkehrszentrale des NOK in Brunsbüttel wird damit der Schiffsverkehr im Kanal überwacht. Diese Technik fiel am Sonntagvormittag aus. Aus Sicherheitsgründen wurde der Schiffsverkehr laut WSA vorerst unterbrochen. In Brunsbüttel und Kiel-Holtenau stauten sich die Schiffe daraufhin vor den Schleusenkammern. Große Schiffe dürfen sich nicht direkt begegnen Mithilfe des Computer-Programms werden die Schiffe in dem Kanal gesteuert. Denn Schiffe ab einer bestimmten Größe dürfen sich auf dem NOK nicht direkt begegnen. Wenn sie aneinander vorbeifahren wollen, muss ein Schiff in einer sogenannten Weiche warten, bis das andere vorbeigefahren ist. Das Programm, dass diese Abläufe steuert, war erst in der vergangenen Woche eingeführt worden. Der Softwarefehler ist noch nicht behoben. Das WSA weiß noch nicht, wo das Problem liegt. Experten versuchen das derzeit herauszubekommen. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Das Ausschleusen ist jedoch weiterhin möglich. Zwei große Passagierschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal © WSA Kiel-Holtenau Nord-Ostsee-Kanal: Schiffe und Schleusen zum Greifen nah Wenn Container- und Kreuzfahrtschiffe durch Schleswig-Holstein gleiten, bieten sich spektakuläre Perspektiven. Zwei Bagger arbeiten an einem Gewässer. © NDR Schleusen-Baustelle Brunsbüttel: Was mit dem Aushub passiert Für die fünfte Schleusenkammer wird viel nasser Boden ausgegraben. Ihn zu trocknen und zu lagern, ist nicht einfach.


mit

Es war wieder eine Schrecksekunde. Als am Donnerstag ein Tanker das Schleusentor 1 mit seinem Wulstbug berührte, stand kurz wieder alles still. „Die Taucher waren unten. Der Schaden ist zum Glück nicht so groß. Das Tor kann weiter gefahren werden“, sagt Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal.
Nach zwei Havarien 2018 und 2020 gibt es in Holtenau keine Reserve-Tore mehr. Ein Tor liegt im Dock der Werft German Naval Yards, das andere an der Pier in der Wik. Die Arbeiten kommen nur langsam voran.
Noch im Frühjahr waren die Planer beim Kanalamt davon ausgegangen, dass beide Tore bis Ende 2021 wieder bei ihm an der Schleuse sein werden. Doch im Laufe des Jahres geriet der Zeitplan ins Wanken.
Ende 2022 wieder zwei Reservetore
„Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Tore 2022 einsatzbereit sein werden“, sagt Wittmüß. Konkrete Terminvorhersagen seien aber nicht möglich. Die Arbeiten an dem 2020 vom Frachter „Else“ gerammten Tor sind komplexer als erwartet. Und auch bei dem im Februar 2018 durch den Frachter „Akacia“ gerammten Schleusentor gab es 2021 Probleme. Die Insolvenz der Nobiskrug Werft habe hier auch Auswirkungen auf den Zeitplan gehabt, so der Amtsleiter.
Die Schleusen in Kiel-Holtenau haben insgesamt sechs jeweils rund 1000 Tonnen schwere Schiebetore. Vier werden für den zeitgleichen Betrieb der beiden großen Schleusenkammern benötigt. Je zwei Tore sind an der Fördeseite, zwei an der Kanalseite.
„Die Schleusentore sind die Achillesferse des Nord-Ostsee-Kanals. Wenn es hier zu Ausfällen kommt, dann trifft das den gesamten Kanal“, sagt Jens-Broder Knudsen, Vorsitzender der Initiative Kiel-Canal, der Vereinigung von Unternehmen, Dienstleistern und Gemeinden am Kanal.
Durch den Ausfall der Schleusen werde das gesamte Investitionsprogramm für die Wasserstraße gefährdet. „Die 2,5 Milliarden in den Ausbau des Kanals machen nur Sinn, wenn auch die Schleusen voll einsatzbereit sind“, so Knudsen.
Die langen Wartezeiten auf die Fertigstellung der Ersatztore sieht er besonders kritisch. „Wir kommen jetzt wieder in die schwierigste Zeit des Jahres mit den Stürmen und viel Schiffsverkehr. Ohne Ersatztore wird da die Leistungsfähigkeit der gesamten Wasserstraße aufs Spiel gesetzt“, so Knudsen.
Keine neuen Ersatztore in Planung
Die seit fast zehn Jahren bestehenden Planungen für den Bau eines weiteren Schleusentores liegen aus Mangel an Haushaltsmitteln im Bundesverkehrsministerium auf Eis. Ob es jemals neue Ersatztore geben wird, ist ebenfalls unklar, da zunächst die neuen Berechnungen zum Hochwasserschutz und zum steigenden Meeresspiegel ausgewertet werden müssen.
Detlef Wittmüß vom Kanal-Amt ist aber ganz zuversichtlich, dass sich die Lage mit der Fertigstellung des ersten Ersatz-Schleusentores bei German Naval Yards im Frühjahr bereits entspannen könnte. Die Stahlbauabteilung der Nobiskrug-Werft war erst im November von der Bremerhavener Rönner Gruppe übernommen worden. Rönner soll jetzt die Arbeiten im Dock in Gaarden beenden.
Das zweite Reservetor wird in der Wik schwimmend am Kai repariert. Der von dem Frachter „Else“ beschädigte Teil des Tores wurde inzwischen freigelegt und mit einem Gerüst wetterfest eingehaust.
Die Arbeiten sollen dort jetzt im Winter weitergehen. An die Schifffahrt hat der Amtsleiter nur den Appell, die vier verbliebenen Schleusentoren möglichst ohne weitere Havarien betriebsbereit zu halten
Nord-Ostsee-Kanal: Ausbau kommt gut voran
2,6 Milliarden Euro werden in die Verbreiterung investiert / Große Pläne
Michael Kierstein Copyright SHZ
Die Schiffe werden immer größer und breiter. Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) muss da mithalten. Deshalb werden etwa 2,6 Milliarden Euro investiert. Seit 2020 baut die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes die Oststrecke zwischen Großkönigsförde und Holtenau deshalb in mehreren Bereichen aus. Nun wurde eine Bilanz für dieses Jahr gezogen.
„Bis zum Jahresende werden wir nahezu auf dem gesamten ersten Bauabschnitt zwischen Großkönigsförde und Schinkel den Trockenboden bis auf die Wasserhöhe des Nord-Ostsee-Kanals abgetragen haben“, sagt Projektleiter Georg Lindner vom Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) NOK. Im kommenden Jahr soll dann unter der Wasserlinie gebaggert werden.
Bisher wurden etwa eine Million Kubikmeter Erde bewegt. „Um diese großen Mengen zu bewältigen, kamen auf der Baustelle bis zu 15 Bagger, 35 Treckerdumper, mehrere Raupen und Radlader zum Einsatz“, so Lindner. Nebenbei wurden zudem alte Gebäude wie eine Hausmülldeponie in Schinkel beseitigt und etwa 9000 Kubikmeter belastete Erde entsorgt.
Noch in diesem Jahr soll der 500 Meter lange und zehn Meter hohe Erdwall an der A 210 fertig gestellt werden. Im Frühjahr soll er dann bepflanzt werden. Auch die Flächen in Schinkel, die für den Aushub benötigt wurden, sollen im kommenden Jahr wieder der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.
Der Fokus wird jetzt langsam auf den nächsten Bauabschnitt zwischen Landwehr und Altwittenbek gelegt. Hier sollen die Vorbereitungen starten. Beispielsweise ist der rund ein Jahr dauernde Bau des temporären Anlegers für den Transport von abgebaggertem Boden und Baustoffen vorgesehen. Generell sei man in diesem Jahr beim Ausbau gut vorangekommen.
Super Video NOK eben
Aus dem Umfeld der Sitzung drang es am Morgen durch. Der Bund wird von Reedern auch 2021 für die Passage des Nord-Ostsee-Kanals keine Befahrungsabgabe erheben.
Diese Schiffs-Maut macht etwa 20 Prozent der für eine Kanalpassage anfallenden Kosten aus. Es handelt sich um eine Gebühr zur Benutzung der Wasserstraße. Die Abgabe liegt bei 400 bis 4000 Euro pro Schiff, je nach Größe.
Kanal bringt volkswirtschaftlichen Nutzen von 570 Millionen Euro
Institut für Weltwirtschaft bescheinigt Nord-Ostsee-Kanal positiven Wohlfahrts- und Umwelteffe

Kaputte Schleusentore, Kollisionen auf der 90 Kilometer langen Strecke zwischen Kiel und Brunsbüttel und lange Sanierungszeiten: Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) wird in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung häufig nur als ein Problemfall registriert. Dabei transportieren in normalen Jahren rund 30 000 Schiffe etwa 90 Millionen Tonnen Güter durch den NOK. Im Auftrag der Initiative Kiel Kanal hat das Institut für Weltwirtschaft (IFW) jetzt nachgerechnet, was die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt an Nutzen bringt. Demnach sorgt der NOK durch Reduktion der Handelskosten für Exporteure und Importeure jährlich für einen positiven Wohlfahrtseffekt von 570 Millionen Euro für Deutschland. In ganz Europa betrage der Effekt sogar eine Milliarde Euro. Dänemark und Schweden profitieren mit 87 beziehungsweise 88 Millionen Euro.
„Güterproduzenten, verladende Wirtschaft, Hafenbetreiber und Konsumenten ziehen ebenfalls einen Nutzen aus dem NOK“ , betonte Studienautor Vincent Stamer. „Beschäftigungseffekte entstehen nicht nur für regionale Industriestandorte wie den ChemCoast Park Brunsbüttel, der direkt 4500 Menschen beschäftigt, sondern für Deutschland insgesamt.“
Die Kieler Forscher reagierten auch auf die Beanstandungen des Bundesrechnungshofs. Der mahnt seit Jahren an, die Befahrungsabgaben für den NOK endlich um ein Drittel anzuheben, da die Gebühren kostendeckend sein müssten und gebühreninduzierte Einnahmeverluste durch weniger Passagen nicht zu befürchten seien. Stamer zeigt jedoch, dass diese Annahme nicht stimmt: Vielmehr senken die Transitkosten für alle Schiffstypen deutlich die Wahrscheinlichkeit, den Kanal zu passieren. Eine Verdoppelung der Gesamtkosten würde im Durchschnitt zu einer Reduktion der Passagen um 20 Prozent führen. Eine Erhöhung des Bunkerpreises hingegen begünstigt tendenziell die Befahrung des NOK, weil Schiffe dann aus Kostengründen die Route rund Skagen meiden. Die Autoren regen an, die bislang nur an die Schiffsgröße gekoppelten Abgaben flexibler zu gestalten: Bei sinkenden Treibstoffkosten sollte auch das Nutzungsentgelt sinken, damit die Abkürzung durch den Kanal finanziell attraktiv bleibt.
Solch ein Vorgehen wäre auch für die anderen deutschen Nord-und Ostseehäfen von Vorteil – besonders für Hamburg. Der Grund: Fährt ein Schiff durch den Nordostseekanal steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Hafen in Hamburger, Wilhelmshafen oder Bremerhaven angesteuert wird, statt Häfen der Niederlande und Belgiens. „Nicht zuletzt reduziert eine Passage durch den NOK auch Treibhausgasemissionen der Frachtschiffe und generiert somit positive, aber bisher nicht quantifizierte Gesamteffekte für die Umwelt“, betont Stamer. Das IfW geht in seinen Berechnungen von 783 000 Tonnen CO2 aus, die wegen der um rund 250 Seemeilen kürzeren Ost-West-Strecke durch den Kanal vermieden würden.
Für die Studie wurden AIS-Daten (Automatic Identification System) auf den Schiffahrtsrouten ausgewertet und analysiert, wann Frachtschiffe den NordOstsee-Kanal passieren oder die Alternativroute um Dänemark wählen. Auch wenn di Kanalpassagen pandemiebedingt zuletzt deutlich eingebrochen sind, ist Stamer überzeugt, „dass der Kanal auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Infrastrukturelement Nordeuropas bleibt, wenn die Modernisierung der Oststrecke abgeschlossen ist und die Schleusen erneut sind.“
Darum dreht sich der Streit um die Weservertiefung
Die Weservertiefung ist heute Thema im Bremer Häfenausschuss. Ein erbitterter Richtungsstreit über den richtigen Kurs zwischen Ökonomie und Ökologie geht in eine neue Runde.
Die Weser weiter ausbaggern, damit die ganz dicken Pötte die Häfen anlaufen? Ergibt das Sinn – gerade mit Blick auf Umweltschutz und Klimawandel? Der Bund und die Länder Bremen und Niedersachsen wollen den Fluss vertiefen – vor allem vor Bremerhaven und dem niedersächsischen Brake. Nach rechtlichen Schwierigkeiten mit dem ursprünglichen Verfahren, ging die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung im Frühjahr einen neuen Weg. Heute lässt sich der Bremer Häfenausschuss einen Sachstandsbericht der Behörden zum Genehmigungsverfahren geben.
Noch in diesem Jahr soll eine sogenannte frühe Öffentlichkeitsbeteiligung starten. Darin sollen betroffene Privatleute, anerkannte Vereinigungen und Verbände sowie Träger öffentlicher Belange Stellung beziehen können. Nach einer Abwägung kann der Bundestag dann beschließen. Dafür wird entscheidend sein, wie die künftige Regierung aussieht – und vor allem, welche Rolle die Grünen darin spielen.
- Warum soll denn unbedingt gebaggert werden?
- Aus wirtschaftlichen Gründen. Denn Befürworter wie der Wirtschaftsverband Weser fordern die Weservertiefung, damit die großen Containerschiffe mit bis zu 13,50 Meter Tiefgang vor allem Bremerhaven anlaufen können. Vom Hafen hängen zu viele Tausend Arbeitsplätze ab, als dass man das aufs Spiel setzen könnte, heißt es aus der Politik – zum Beispiel von Bremens Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD). Gleichzeitig versichert die Senatorin, dass genau und ordentlich abgewogen werde zwischen Wirtschaft und Natur- und Umweltschutz.
Innerhalb der Koalition im Land gibt es aber nicht nur Zustimmung. Die Bremer Grünen hatten der Außenweser bislang zugestimmt, nicht aber der Unterweser, so Sprecher Ralph Saxe: „Wir wollen auf keinen Fall eine Vertiefung der Unterweser. Und dagegen werden wir mit allen Kräften kämpfen.“ Kritik an der erneuten Vertiefung kam auch aus der Partei Die Linke in Bremen, die hier mitregiert. - Es gab schon Gerichtsurteile gegen die Vertiefung, warum wird das Verfahren trotzdem vorangetrieben?
- Geklagt hatte vor allem der Umweltverband BUND. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass sich die Gewässerqualität der Weser nicht verschlechtern dürfe. Deshalb sei die Vertiefung mit der EU-Wasserrichtlinie nicht zu vereinbaren. Das Bundesverwaltungsgericht hat daraufhin 2016 erklärt, dass das ursprüngliche Verfahren für den Ausbau der Weser rechtswidrig war. Herausgekommen ist ein Schnellverfahren, über das der Bundestag beschließt, nicht mehr die Länder. Nun sollen erst einmal nur die Außenweser vor Bremerhaven und der Bereich bis Brake ausgebaggert werden – der Rest der Weser aus Umweltschutzgründen nicht.
Hier soll die Weser vertieft werden
- Und was halten die Umweltverbände davon?
- Nichts, der BUND prüft zurzeit erneut eine Klage. Der Vorwurf der Umweltschützer: Mit dem Schnellverfahren sollen sie nur ausgebremst werden und die Wirtschaft werde über alles gestellt. Von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes dagegen heißt es, das neue Verfahren sei viel transparenter als das alte und alle Einwände würden gehört. Letztlich ist die Frage: Wie sieht die neue Bundesregierung aus? Und welche Position vertreten die wohl daran beteiligten Grünen dabei mit Blick auf die Klimadebatte? Erstmal treibt die Bundesverwaltung das Verfahren jedoch voran.
- Welche weiteren Interessen gibt es rund um die geplante Weservertiefung?
- Es prallen denkbar gegensätzliche Positionen aufeinander. Für die Befürworter ist die Weservertiefung alternativlos. Zum Beispiel Uwe Beckmeyer, Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsverbands Weser: „Die Reeder erwarten, dass tideabhängig und -unabhängig Bremerhaven, aber auch Brake erreicht werden können mit den Standardschiffen, die zurzeit laufen. Und die Standardschiffe, die Bremerhaven anlaufen, sind in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen.“
In den Augen der Gegner wäre eine weitere Vertiefung eine ökologische Katastrophe und gefährlich. Martin Rode, Geschäftsführer des Umweltschutzverbands BUND in Bremen: „Wir reden über Klimawandel, der Meeresspiegel steigt und wir wollen uns die Nordsee noch schneller reinholen. Das war schon vor zehn Jahren falsch und das ist jetzt falsch und das wird in zehn Jahren noch viel falscher sein.“
Kritisch sehen auch Touristik-Fachleute die Vertiefung der Weser – eine weitere Verschlickung der Häfen und Gefährdung der Strände könnte die Folge sein. An einer Menschenkette gegen die weitere Vertiefung beteiligten sich kürzlich rund 500 Menschen.
Für Oliver Oestreich, Vorsitzender des Verbands der Bremer Spediteure, muss die Weservertiefung kommen. So oder so – schließlich gehe es ja nicht nur darum, Container abzustellen, sondern auch eingespielt, logistisch sinnvoll weiterzutransportieren und wieder aufzunehmen: „Wird jetzt der eine oder andere nicht so gerne hören: Also die Außenweservertiefung ist wichtiger, denn da gehen die großen Schiffe hin. Die Musik spielt zuallererst in Bremerhaven, da müssen wir halt sehen, dass die mit den größtmöglichen Schiffen da voll abgeladen hingehen können.“
- Welche Rolle spielen die laufenden Verhandlungen von Bremen und Hamburg über eine Hafen-Kooperation?
- Eine große Rolle. Hamburg hat die Elbvertiefung gegen massive Proteste durchgesetzt. Auch wenn die Weservertiefung kommen sollte – alle Zeichen stehen darauf, dass an einer Hafen-Kooperation von Bremen und Hamburg kein Weg mehr vorbeiführt. Die Verhandlungen gehen dem Vernehmen nach in die Schlussrunde. Künftig dürfte der Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven stärker in den Fokus rücken, an dem Bremen ja bereits beteiligt ist. Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd jetzt beschlossen hat, in den Jade-Weser-Port mit 30 Prozent einzusteigen. Es wird also aller Voraussicht nach bald mehr Containerumschlag an der Küste stattfinden – weniger in Hamburg.
Rückblick: Kommt die Außenweservertiefung jetzt schneller als gedacht?
Schifffahrt – Hamburg:Maritimer Koordinator: Investitionen in maritime Sicherheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal
Hamburg (dpa/lno) – Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, hat angesichts der Corona-Pandemie und der jüngsten Blockade des Suezkanals mehr Investitionen in die maritime Sicherheit gefordert. „Nach wie vor findet die maritime Sicherheit hierzulande in meinen Augen zu wenig Beachtung“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einer Online-Veranstaltung des Deutschen Maritimen Zentrums in Hamburg.
Funktionierende, gut ausgebaute Häfen, maritime Infrastruktur, sichere Seewege und Lieferketten seien keine Selbstverständlichkeit. „Deswegen müssen wir in sie investieren“, sagte Brackmann. Er verwies dabei auch auf die Corona-Pandemie, die gezeigt habe, wie sehr Deutschland von funktionierenden Lieferketten abhängig sei.
Die über den Seeweg verschiffte Exportmenge Deutschlands habe sich in den vergangenen 50 Jahren verfünffacht, die Importmenge verdoppelt, betonte Brackmann. „Die maritimer Wirtschaft ist eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Sie gewährleistet über 90 Prozent des deutschen Exports auf dem Seeweg, erwirtschaftet über 40 Milliarden Euro und sichert in Summe mehr als 400 000 Arbeitsplätze in Deutschland“, sagte Brackmann. Doch „erst wenn es zu Störungen kommt, schaut die ganze Welt hin“, sagte er mit Blick auf die jüngste Blockade des Suezkanals durch das 400 Meter lange Containerschiff „Ever Given“.
Suezkanal, Panamakanal und Co. Das sind die wichtigsten Wasserstraßen der Welt
Eine Woche lang blockierte das Containerschiff „Ever Given“ den Suezkanal. Der Wasserverkehr auf der vielbefahrenen Handelsroute stand derweil still. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Wasserstraßen der Welt vor.
Beiträge

Bei der offiziellen Verschmelzung der beiden Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Kiel-Holtenau und Brunsbüttel zum neuen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal wurde am Montag in Rendsburg auch das Neubauamt erstmals vorgestellt.
Das Wasserstraßen-Neubauamt NOK soll zukünftig alle Bauprojekte der 100 Kilometer langen Wasserstraße zentral koordinieren und überwachen. Das von Sönke Meesenburg geführte Amt verfügt über 80 Stellen und hat seinen Sitz in Kiel.
Damit wird aus der 2008 gegründeten Planungsgruppe ein eigenständiges Amt. „Wir werden in den nächsten Jahren 2,5 Milliarden Euro in den Kanal investieren. Diese Investitionen müssen gemanagt werden, dafür gibt es jetzt das Wasserstraßen-Neubauamt NOK“, sagte Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, bei der Vorstellung der neuen Struktur am Montag in Rendsburg.
Neues Amt kümmert sich auch um die großen Schleusen in Kiel und Brunsbüttel
Das neue Amt ist für den Schleusenbau in Brunsbüttel und Kiel, den Ersatz der Levensauer Hochbrücke, den Ausbau der Oststrecke und die Vertiefung des gesamten Kanals um einen Meter zuständig. Auch die Sanierung der 1914 eingeweihten großen Schleusen in Kiel und Brunsbüttel liegt im Aufgabenbereich des Neubauamtes.
„Damit haben wir jetzt alles in einer Hand. Die 80 Kollegen werden sich jetzt gezielt um die Investitionen kümmern“, sagte Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt.
Die beiden bisherigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Kiel-Holtenau und Brunsbüttel wurden zum Wasserstraßen und Schifffahrtsamt NOK zusammengelegt. Diese Behörde wird jetzt von Detlef Wittmüß geführt, dem an den Standorten Kiel und Brunsbüttel etwa 800 Mitarbeiter unterstellt sind.
Schifffahrtsverwaltung wurde 2013 reformiert
„Wichtig war uns, dass bei dieser Reform niemand gegen seinen Willen versetzt oder durch betriebsbedingte Kündigungen entlassen wurden“, so Alexander Bätz, der Bezirkspersonalrat für die Ämter am Kanal. Auch er lobte das Ergebnis der Reform.
Ausgelöst wurde der Umbau durch die Reform der Schifffahrtsverwaltung 2013. Dabei wurden die 39 bisherigen Ämter durch Zusammenschlüsse zu 17 neuen Ämtern umstrukturiert. Im Oktober war an der Ostseeküste so aus den beiden Ämtern Lübeck und Stralsund das Amt Ostsee geworden.
Neue Behörde kümmert sich um den Nord-Ostsee-Kanal
Die meistbefahrene künstliche Wasserstraße soll wieder gebündelt durch zwei Ämter geführt werden. Seit 1980 kümmerten sich Ämter in Brunsbüttel und in Kiel jeweils einzeln um die Belange des Kanals an Nord- und Ostsee.
Bislang hat sich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau um die Seite zur Ostsee hin gekümmert. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel war dagegen für die Zufahrt von der Nordsee zuständig. Doch damit ist jetzt Schluss. Nun werden die Aufgaben durch zwei neue Ämter am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gebündelt. Eins plant die Investitionen des Bundes in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und das andere betreibt Schleusen, Brücken und Tunnel entlang des Kanals.
Zwei Behörden, zwei Aufgaben
Für Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ein bedeutender Tag: „Wir haben die Entscheidungs-Strukturen erheblich verschlankt, denn wir wollen den Kanal ja in den kommenden Jahren umfangreich sanieren, insgesamt sollen 2,5 Milliarden Euro investiert werden.“ Diese Summe muss bewegt werden. Diese Aufgabe wird künftig das Wasserstraßen-Neubauamt NOK übernehmen. Rund 80 Mitarbeiter werden sich beispielsweise um den Ausbau der Ost-Strecke kümmern, den Neubau der fünften Kammer in Brunsbüttel oder den neuen Schleusen-Anlage in Kiel.
„Auf der anderen Seite haben wir auch ein klassisches Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK gegründet“, sagte Ferlemann. Die Aufgabe der Behörde mit seinen rund 700 Mitarbeitern: der Betrieb der Schleusenanlagen in Kiel und in Brunsbüttel. Zum Aufgabenbereich gehören aber auch die zehn Brücken über den Kanal, die zwei Tunnel in Rendsburg, die 14 Fähren und zwölf Weichen.
Hoffnung auf besseres Krisenmanagment
Viele, die auf Einnahmen des Nord-Ostsee-Kanals angewiesen sind, hoffen mit der Schaffung der beiden neuen Ämter vor allem auf ein besseres Krisenmanagement. Neue Strukturen alleine aber reichen etwa dem Vorsitzenden der Initiative Kiel Canal, Jens-Broder Knudsen, nicht: „Für die Instandhaltung der gesamten Anlagen brauchen wir auch einfach mehr Personal.“ Vieles ist für Knudsen nicht mehr nachvollziehbar, der neben seiner Tätigkeit in der Initiative auch Geschäftsführer der Schiffsmaklerei Sartori & Berger ist: „Mit den Milliarden-Investitionen in die Infrastruktur ist der Nord-Ostsee-Kanal Deutschlands teuerste Wasserbaustelle. Und es wird riskiert, diese Wasserstraße wegen fehlender Schleusen-Tore lahmzulegen.“
Schleusen-Tor soll im Herbst fertig sein

Eines dieser Tore wird momentan in Kiel repariert. Vor mehr als drei Jahren war der Frachter „Akacia“ in Kiel in die Stahlkonstruktion gekracht. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Sommer beendet sein, doch es gibt Verzögerungen. Daher kann nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau frühestens im Herbst mit dem Einbau gerechnet werden. Die Arbeiten an dem mehr als 100 Jahren alten Schleusentor dauern unter anderem deshalb so lange, weil der Stahl der rund 1.200 Tonnen schweren Konstruktion nicht geschweißt werden kann. Die Platten müssen miteinander verschraubt werden, was dem Tor auch eine gewisse Elastizität verleiht. Nach der Reparatur sollen etwa rund 60.000 neue Schrauben und mehr als 200 Tonnen Stahl verbaut worden sein.
Ende des Jahres wieder Ersatztore in Kiel
Außerdem kündigte Enak Ferlemann an, dass schon im September dieses Jahres das vom Frachter „Else“ im vergangenen Jahr beschädigte Schleusen-Tor repariert worden sein soll. „Ich gehe davon aus, dass uns damit bis Ende des Jahres wieder alle Tore in Kiel zur Verfügung stehen“, so der Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium. Lange geplant und gefordert, soll auch der Bau des Tor-Instandsetzungsdocks in Brunsbüttel vorangetrieben werden. „Die Planungsphase neigt sich dem Ende entgegen und ich rechne damit, dass im kommenden Jahr der Auftrag zum Bau vergeben werden kann“, erklärt Enak Ferlemann. Er rechne damit, dass in vier bis fünf Jahren die Arbeiten an dem Dock abgeschlossen sein werden. Damit sollen künftig Instandsetzungsarbeiten der Schleusentore schneller abgewickelt werden.
Kanaltunnel: Anfang Mai vierspurig?
Der CDU-Politiker hatte noch mehr gute Nachrichten für den Kanal parat. So soll spätestens Anfang Mai der Verkehr wieder vierspurig durch den Rendsburger Kanaltunnel fließen. „Das hängt zwar noch von einem Test der Brandschutzanlage ab – aber was das angeht, bin ich mehr als zuversichtlich.“
Umstrukturierung im Norden abgeschlossen
Die Umstrukturierung ist schon länger geplant und geht auf die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes zurück. So werden die bislang bundesweit 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter auf 17 reduziert. Schon vor Jahren wurden die damals sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen zu einer Generaldirektion zusammengelegt, die ihren Sitz in Bonn hat. Durch schlankere Strukturen soll die WSV nach eigenen Worten leistungsfähiger werden. „Mit den beiden neu gegründeten Ämter hier in Büdelsdorf, ist die Umstrukturierung im Norden abgeschlossen“, meinte Enak Ferlemann.
Zwei neue Ämter für den Kanal
Büdelsdorf Zwei neue Ämter lenken jetzt die Geschicke am Nord-Ostsee-Kanal (NOK): Verantwortlich für die Schifffahrtsbelange, die Schleusen und Brücken an der knapp 100 Kilometer langen Wasserstraße zwischen Kiel und Brunsbüttel ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK. Die Zuständigkeit für die Aus- und Neubauprojekte übernimmt als jetzt eigenständige Dienststelle das Wasserstraßen-Neubauamt NOK. Der Bundes-Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (Foto), eröffnete die Ämter gestern gemeinsam mit dem Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte. Nunmehr seien die Kompetenzen für die Schifffahrt einschließlich der Anlagen und das Know-how für die Investitionsprojekte jeweils gebündelt. „So kann flexibler und schneller agiert werden“, sagte Ferlemann. Das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK geht aus bisher zwei Ämtern in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel hervor. Beide Standorte bleiben erhalten. Bundesweit werden 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter zu 17 neuen Ämtern zusammengeführt. sh:z
https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Nur-noch-ein-Wasserstrassen-und-Schifffahrtsamt-fuer-den-Nord-Ostsee-Kanal
Copyright KN online

Damit wird die meistbefahrene künstliche Wasserstraße für Seeschiffe wieder aus einer Hand geführt. Diese Organisationsstruktur gab es zur Eröffnung: Am 1. Juli 1895 wurde in Kiel das Kaiserliche Kanalamt gegründet. Seit 1939 wurden durch mehrere Reformen die Verwaltungsstrukturen umgebaut.
1980 schließlich wurde der Kanal in zwei Ämter aufgeteilt. Mit der jetzt vollzogenen Zusammenführung dieser Ämter sollen Überwachung der Schifffahrt, Unterhaltung der Bauwerke und Verwaltung der Behörde effizienter und transparenter werden.
Zu diesem Schluss kam schon 2013 das Bundesverkehrsministerium, das eine entsprechende Reform auf den Weg brachte. Von den einst 39 Wasser- und Schifffahrtsämtern zwischen Tönning und Aschaffenburg sollen danach nur 17 bestehen bleiben. Nachdem 2020 bereits die Ämter Lübeck und Stralsund zum Amt Ostsee verschmolzen wurden, ist jetzt der Kanal dran.
Detlef Wittmüß leitet das neue WSA NOK
Neuer Leiter des „WSA NOK“ wird Detlef Wittmüß, bisher Leiter des WSA Kiel-Holtenau. Ihm unterstehen fortan die drei Bereichsleiter für Administration, Schifffahrt und Wasserstraße. Damit gibt es eine neue Führungsstruktur. Beide Ämter haben heute zusammen 800 Beschäftigte.
Wie schon 1895 sitzt 2021 der Leiter der Kanalverwaltung wieder in Kiel – hat aber auch ein Büro in Brunsbüttel. Als Unterorganisation gab es damals jeweils eine Bauinspektion in Holtenau und Brunsbüttel sowie eine Maschinenbauinspektion. Ab 2021 heißen die drei Abteilungen unter der Leitung nun Administration, Schifffahrt und Wasserstraße.
Wirtschaft hofft auf besseres Havarie-Management
Die Wirtschaft hofft, dass die Reform ein besseres Havarie-Management bewirken wird. Allerdings: „Es reicht nicht, nur neue Strukturen zu schaffen. Es muss auch mehr Personal für die Instandhaltung der Anlagen vorhanden sein“, sagt Jens-Broder Knudsen, Geschäftsführer der Schiffsmaklerei Sartori & Berger, zudem Vorsitzender der Initiative Kiel Canal.
Lesen Sie auch: Scharfe Kritik am Bund
Die jüngste Havarie am Wochenende (wir berichteten) hat auch bei ihm einen Schrecken hinterlassen. „Da werden zwei Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert, und man riskiert, die Wasserstraße wegen fehlender Schleusentore lahmzulegen“, so Knudsen.
Mit Blick auf das seit August aufgelegte Schleusentor der „Else“-Havarie spart er nicht an Kritik: „Wenn man neun Monate braucht, um eine Ausschreibung für eine Reparatur von sieben Monaten auf den Weg zu bringen, läuft da was schief.“
Wasserstraßen: Neue Behörde am Start
Tönning/hamburg/Stade Ein weiterer Akt der Verwaltungsreform – gestern ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee eröffnet worden. Die Behörde umfasst die Zuständigkeitsbereiche der bisherigen Ämter Hamburg, Cuxhaven und Tönning und betreibt mit dem Eidersperrwerk das größte deutsche Küstenschutzbauwerk.
Zum Aufgabenbereich gehören unter anderem das schleswig-holsteinische Wattenmeer mit den Zufahrten nach Husum, Büsum, zu den Halligen und den Nordfriesischen Inseln sowie die Bundeshäfen Helgoland und Hörnum. Damit lägen „nun alle Kompetenzen und Zuständigkeiten in einer Hand“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann (CDU). Das WSA Elbe-Nordsee unterhält zudem rund 130 Kilometer Tideelbe, die Nebenflüsse mit rund 120 Kilometern und 110 Kilometer Eider. Das neue Amt ist auch verantwortlich für 80 Leuchttürme.
Bundesweit wird die Zahl der Wasser- und Schifffahrtsämter durch die Neuorganisation von 39 auf 17 verringert. Die Reform soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. lno
Großbaustelle Nord-Ostsee-Kanal
Es ist das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals: Etwa 2,6 Milliarden Euro werden in den kommenden Jahren in die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt investiert. Verantwortlich dafür, dass alles reibungslos klappt, ist Sönke Meesenburg, der Leiter des Fachbereichs Investitionen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau. Er muss letztendlich dafür sorgen, dass Schleusen erweitert, Brücken erneuert und Teile des Kanals verbreitert werden. Die größte Herausforderung in seiner bisher zwölfjährigen Amtszeit.
Die Aussetzung der Abgaben war im Juli erstmals vom Bund beschlossen worden, da die niedrigen Ölpreise und die Corona-Krise zu einem starken Einbruch im Kanal führten. Immer mehr Schiffe fuhren via Skagen.
Zahlen haben sich noch nicht erholt
Aktuell sieht es so aus, als ob im Nord-Ostsee-Kanal in diesem Jahr die Schiffszahl erneut drastisch einbricht. Es wird vermutlich sogar das schlechteste Ergebnis seit 70 Jahren geben.
Die aktuellen Zahlen deuten bis Jahresende auf weniger als 29 000 Schiffe hin. Deshalb hatten auch die Nautischen Verbände Kiel und Brunsbüttel eine weitere Aussetzung der Befahrungsabgabe gefordert.
Seit der Aussetzung der Befahrungsabgabe im Juli hatten sich die Verkehrszahlen wieder leicht erholt. „Wir haben in den vergangenen Wochen einen spürbaren Trend nach oben“, so Jens-Broder Knudsen von der Agentur Sartori & Berger.
Mitglied im Deutschen Bundestag
www.bettina-hagedorn.de | facebook.com/BettinaHagedornMdB
Platz der Republik 1 | 11011 Berlin |Raum 7.633 | Tel.: (030) 227-73342 | Fax: (030) 227-76920 Lübecker Straße 6 | 23701 Eutin | Tel.: (04521) 71611 | Fax: (04521) 78386
_______________________________________________________________________
Bettina Hagedorn: Finanzministerium will den Nord-Ostsee-Kana 2021 mit 21 Mio. Euro unterstützen!
(Im Anhang finden Sie ein Foto zur freien Verfügung von Bettina Hagedorn und MdB Mathias Stein vom 19. Februar 2020 in Brunsbüttel bei ihrer Veranstaltung „SOS. für den Nord-Ostsee-Kanal“.)
Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen 2021 hat das SPD-geführte Bundesfinanzministerium dem Haushaltsausschuss in seiner Vorlage für die Abschlusssitzung am 26. November 2020 zusätzliche finanzielle Hilfen für den Nord-Ostsee-Kanal in Höhe von 21 Mio. Euro vorgeschlagen: Die Befahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal, die auf Initiative des Finanzministeriums bereits seit 1. Juli 2020 befristet bis zum 31. Dezember 2020 komplett entfallen sind, um die Schiffspassagen in der Corona-Zeit attraktiver zu machen, will der Bund nun für ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2021 aussetzen. Bettina Hagedorn, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, freut sich:
„Als die maritime Wirtschaft rund um unsere ´Lebensader´ im Norden – dem Nord-Ostsee-Kanal – im Frühjahr stark von den gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen war, und viele Reedereien – vor allem wegen des sinkenden Rohölpreises – den Umweg über Skagen/Dänemark in Kauf nahmen, haben wir als Bund mit dem 2. Nachtragshaushalt zum 1. Juli für die 2. Jahreshälfte 2020 komplett auf die Erhebung der Befahrensabgabe im Nord-Ostsee-Kanal und damit auf Gebühren von 10 Millionen Euro verzichtet. Diese Maßnahme war sehr erfolgreich: Während noch von April bis Juli 2020 die Schiffspassagen um bis zu 30 Prozent gegenüber den entsprechenden Vorjahresmonaten einbrachen, waren es im Oktober dann glücklicherweise nur noch 3 Prozent! Durch die nun vom Bundesfinanzministerium befürwortete erneute Aussetzung der Befahrungsabgaben für das gesamte (!) Jahr 2021 in Höhe von 21 Mio. Euro will der Bund die Attraktivität des NOK nachhaltig steigern, um auch den im Frühjahr existenzbedrohenden Einnahmeverlusten für Lotsen, Kanalsteurer und Schiffsmakler entgegenzuwirken und die Wettbewerbsfähigkeit der Hafenstandorte in Kiel, Brunsbüttel und Hamburg zuverlässig zu stärken. Das ist eine elementare Unterstützung für die Zukunftsfähigkeit des Kanals, für den ich mich seit Jahren aktiv einsetze!“
Am 19. Februar 2020 – noch kurz vor der Corona-Pandemie – führte Bettina Hagedorn gemeinsam mit ihrem SPD-Bundestagskollegen aus Kiel, dem Verkehrspolitiker Mathias Stein, die Veranstaltung „SOS für den Nord-Ostsee-Kanal“ mit mehr als 80 interessierten Gästen aus der Lotsenbrüderschaft, der maritimen Wirtschaft, dem DGB Nord, Vertretern der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) in Brunsbüttel durch. Es war die „Nachfolgeveranstaltung“ in der Tradition der von ihr und MdB Johannes Kahrs im September 2011 gleichlautenden Auftaktveranstaltung „S.O.S. für den Nord-Ostsee-Kanal – der Norden steht auf!“, nach der der Haushaltsausschuss des Bundestages in den Folgejahren in der Summe über 2 Mrd. Euro für die Grundinstandsetzung des Nord-Ostsee-Kanals im Bundeshaushalt beschloss: Ein riesiger Erfolg für das NOK-Bündnis und tausende Beschäftigte in Schleswig-Holstein und im Hamburger Hafen.
Hagedorn weiter: „In der Region sichert der Nord-Ostsee-Kanal über 3.000 Arbeitsplätze. Dazu zählen nicht nur die über 300 Lotsen und ca. 160 Kanalsteurer, sondern auch Schiffsmakler, Werften, Handwerksbetriebe, Schiffsausrüster, Tourismusagenturen, Gaststätten- und Hotelbetreiber. Sie alle profitieren von den jetzt bis Ende 2021 ausgesetzten Befahrensabgaben!“
Kanal-Passagen weiter gratis
Verkehr nimmt wieder zu – Bund will auch 2021 auf „Befahrungsabgabe“ verzichten
Neue Panne im Nord-Ostsee-Kanal
Computerfehler führt zu Stillstand / Buchholz will Wasserstraße attraktiver machen Copyright SHZ Norddeutsche Rundschau danke Ralf Pöschus
Margret Kiosz
Kiel Schon wieder Stillstand auf dem Kanal. Weil das Computerprogramm zur Lenkung der Schifffahrt auf der Wasserstraße zusammenbrach, konnten seit gestern Morgen keine größeren Schiffe in den Kanal einlaufen. Alle Versuche , in der Nacht den Schaden mit Bordmitteln zu beheben, waren gescheitert. Jetzt müssen die IT-Spezialisten der Herstellerfirmen ran, teilte WSA-Amtsleiter Detlef Wittmüß in Brunsbüttel der Schifffahrt mit. Erneut wurden Reedereien und Kapitäne auf eine Geduldsprobe gestellt.
Während die Schiffe auf der Kieler Förde und der elbseitigen Reede 12 Stunden warten müssen, forderte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) weitere Stärkungen der 125 Jahre alten künstlichen Wasserstraße. „Der Kanal muss für die Schifffahrt attraktiv und wirtschaftlich sein“, sagte er. Wichtig sei ein Rabattsystem für umweltfreundliche Schiffe und die Verlängerung der Befreiung von der Befahrensabgabe bis Ende 2021. Durch den Verzicht auf die Abgabe war die Zahl der Kanalpassagen nach dem Corona-bedingten Einbruch im Frühjahr zuletzt fast wieder auf Normal-Niveau geklettert. „Um Skagen zu fahren, darf nicht zur ernsthaften Option werden“, sagte Buchholz. Dies hätte negative Folgen für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein und für den Hamburger Hafen. Die Jamaika-Koalition stärkt ihm dabei mit einem Antrag im Landtag den Rücken. Sie fordert ein Notfallkonzept und einen Vorrat von Ersatzteilen sowie „eine ausreichende personelle Abdeckung, um Reparaturen schnellstmöglich umzusetzen und Außerbetriebnahmen der Schleusenkammern zu vermeiden“.
Zudem halten die Abgeordneten eine Überarbeitung der Gefahrenbetrachtung im Schiffsverkehr für nötig, so dass bei der Risikoabschätzung zukünftig nicht nur der Schiffstyp, sondern vor allem auch die transportierte Ladung berücksichtigt wird. Aktueller Bezug: die Havarie des mit Ammoniumnitrat beladenen Frachters „Else“ am 29. August in Kiel. „Den Unfall der Else sollten wir als Warnschuss nehmen – das hätte leicht ins Auge gehen können“, betont auch der Minister. Nötig sind laut Buchholz möglicherweise auch besondere Auflagen für Massengutschiffe wie eine ausgeweitete Lotspflicht, eine zusätzliche Meldepflicht oder sogar Befahrensverbote.
Interessant für die Sportschifffahrt: Auch die Lotsenpflicht für Sportfahrzeuge soll unter besonderer Berücksichtigung der Erteilung von Sonderregelungen wie dem Freifahrer-Zeugnis überprüft und die bargeldlose Bezahlung der Kanalgebühren forciert werden.
Große Hoffnung setzt die Koalition zudem in die digitale Optimierung des Schleusenzulaufs, so dass Schiffe schon im Ärmelkanal nachsehen können, wie lange sie in Brunsbüttel auf die Schleusung warten müssen und ihre Geschwindigkeit entsprechen anpassen. Allerdings besteht die Sorge, dass bei den digitalen Systemverbesserungen momentan die Arbeit ruht, weil sie aus den momentan ausgesetzten Befahrensabgaben finanziert werden.
In den kommenden Jahren steckt der Bund 2,6 Milliarden Euro in den Ausbau und Erhalt des Kanals.
Neues Amt für die westdeutschen Kanäle

Ab sofort liegt die Verantwortung für die westdeutschen Kanäle in einer Hand. Im Zuge der Neuordnung wird ein neues Amt mit 800 Beschäftigten geschaffen.
Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, hat heute das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle eröffnet. Im Rahmen der Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) startet damit das 13. neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.
Rund 800 Beschäftigte sind jetzt für eines der wichtigsten deutschen Verkehrsgebiete verantwortlich. Mit der Neustrukturierung sollen Synergien geschaffen werden, die zu noch effizienteren Arbeitsabläufen führen, heißt es bei der GDWS. Das neue Amt geht aus den bisherigen WSA in Duisburg-Meiderich und Rheine hervor. Beide Standorte bleiben erhalten.
Leiter des neuen WSA Westdeutsche Kanäle ist Ulrich Wieching. Er führte bereits 13 Jahre lang das WSA Rheine und seit über einem Jahr kommissarisch auch das WSA Duisburg-Meiderich.
Zum Zuständigkeitsbereich des neuen Amtes zählen 300 km Kanal-und 50 km Flussstrecke, vom Rhein bis zum Emsland. An diesen Strecken liegen insgesamt 630 Bauwerke, unter anderem 230 Brücken, rund 140 Düker, über 40 Schleusenkammern und über ein Dutzend Pumpwerke. Darüber hinaus ist das Amt verantwortlich für die Fernsteuerzentrale Wasserversorgung in Datteln und das Kompetenzzentrum für das Taucherwesen in Hörstel. Für die Ausbaumaßnahmen am Dortmund-Ems-Kanal, Rhein-Herne-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal und Wesel-Datteln-Kanal investiert die WSV insgesamt mehr als 1,7 Mrd. €.
Die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV-Reform) ist eine der größten Verwaltungsreformen der vergangenen vier Jahrzehnte. Bundesweit werden 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter zu 17 neuen Ämtern zusammengeführt.
Henning Baethge Kiel/berlin Bis zum Jahresende verzichtet der Bund wegen der Corona-Krise auf die Gebühren für Fahrten durch den Nord-Ostsee-Kanal – und nun will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die seit Juli geltende Regelung auch auf das nächste Jahr ausdehnen: Wie ein Sprecher des CSU-Politikers unserer Zeitung gestern sagte, sei geplant, die sogenannte „Befahrungsabgabe“ auch 2021 nicht zu erheben.
Die endgültige Entscheidung über eine Gebührenbefreiung und deren Dauer trifft am Donnerstag der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner Abschluss-Sitzung für den 2021er-Etat. Die Chancen für eine Verlängerung sind aber groß. „Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen“, sagt selbst die Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, die schleswig-holsteinische SPD-Politikerin Bettina Hagedorn.
Seit dem Gebührenverzicht im Sommer hat der damals eingebrochene Verkehr auf dem Kanal wieder stark zugenommen. Verzeichnete Scheuers Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt dort im Juli noch mit einer Ladungsmenge von nur 5,3 Millionen Tonnen einen Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, waren es im Oktober schon wieder 6,7 Millionen Tonnen Ladung und damit nur 3 Prozent weniger als im letzten Oktober. Die Zahl der Schiffe im Kanal stieg zwischen Juli und Oktober von 1873 auf 2289.
Die Gebührenbefreiung habe „weit mehr als den erhofften Effekt erzeugt“, freuten sich daher kürzlich schon die nautischen Vereine Kiel und Brunsbüttel. Und sie forderten sogar, künftig dauerhaft auf die Abgabe zu verzichten – zumindest aber so lange, bis der Kanal modernisiert ist, also noch mindestens zehn Jahre. SPD-Bundestags-Verkehrspolitiker Mathias Stein, selbst lange in der Kanalverwaltung tätig, mahnte gestern zudem eine Verlängerung der Staatshilfen für Lotsen und Kanalsteurer an.
Ein Verzicht auf die Kanalgebühren im nächsten Jahrwürde den Bund 21 Millionen Euro kosten. Dieses Jahr entgehen ihm schon 10 Millionen. Eine Kanalpassage kostet für einen Frachter mit 200 Metern Länge normalerweise fast 2500 Euro. In einem kleinen Segelboot werden nur 12 Euro fällig.

https://www.jungewelt.de/artikel/389181.steuerpolitik-geschenke-an-schiffahrtskonzerne.html
Copyright jungewelt

Einmal mehr entpuppt sich die Coronakrise als Vorwand, um Millionen Euro Steuergeld in Subventionen umzulenken, die nicht mit der Pandemie im Zusammenhang stehen – und enthüllt zugleich, dass diese Praxis schon seit Jahrzehnten üblich ist. Es geht wieder einmal um die Seeschiffahrt (siehe jW vom 20. August). Laut einem Bericht vom 21. Oktober der Fachzeitschrift Hansa haben die Nautischen Vereine in Kiel und Brunsbüttel einen Brief an Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium (BMVI), geschrieben. Darin fordern sie, den derzeit aufgrund der Krise praktizierten Verzicht auf – Amtsdeutsch – »Befahrungsabgaben« für den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) zu verlängern, »oder besser (…) auf die Erhebung der Abgabe (…) dauerhaft« zu verzichten. Im Sommer dieses Jahres hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages die Passagegebühren bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt, es geht dabei um rund zehn Millionen Euro. Die Gratiskanalfahrt von Kiel nach Brunsbüttel (und umgekehrt) begünstigt zwar Schiffe aller Reedereien und Flaggen, hilft aber auch der regionalen Logistikwirtschaft: Dank der seit der Gebührenstreichung »drastisch gestiegenen« Durchgangszahlen, so zitiert Hansa aus dem Brief, könnten die Dienstleister am Kanal trotz Pandemie »auskömmliche Einnahmen erwirtschaften«. Die Nautischen Vereine mutmaßen sogar, der »betriebswirtschaftliche Verlust im Haushalt« durch weiteren Abgabenverzicht könne »durch den volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen ausgeglichen« werden.
Das ist nicht nur rechnerisch sehr mutig, sondern offenbart einen Jahrzehnte währenden Missstand: Seit mehr als 40 Jahren beanstandet der Bundesrechnungshof (BRH) die viel zu niedrigen Gebühren für die Kanalbenutzung. Im BRH-Jahresbericht vom Dezember 2017 stellten die Finanzaufseher fest, die Befahrungsabgabe sei »zuletzt im Jahr 1996 angepasst« worden. Das BMVI missachte nicht nur die Bundeshaushaltsordnung und deren »wichtige Vorgabe« des »Vollkostendeckungsprinzips«. Es ignoriere auch Empfehlungen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), die Abgabe zu erhöhen, und verzichte so auf jährliche Millioneneinnahmen. Im anschließenden BRH-Bericht vom Mai 2018 an den Haushaltsausschuss des Bundestages wurde das BMVI explizit aufgefordert, »die Befahrungsabgaben auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu prüfen und entsprechend anzuheben«. Tatsächlich aber steht im aktuellen Entwurf des Bundeshaushaltsplans für 2021 exakt derselbe Ansatz für Einnahmen aus der Abgabe wie in etlichen Jahren zuvor: 21 Millionen Euro. Dabei hatte der BRH im Jahre 2017 nur seine frühere Kritik erneuert: Schon 1976 hatte die Behörde die Abgabenhöhe als zu niedrig beanstandet und allein für die sieben Jahre von 1970 bis 1976 das NOK-Defizit – Einnahmen aus der Befahrungsabgabe gegen Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung – mit 200,2 Millionen D-Mark (102,36 Millionen Euro) beziffert.
Dabei kostet der jüngst 125 Jahre alt gewordene Nord-Ostsee-Kanal gerade jetzt sehr viel Geld: Seit Jahresanfang wird er an mehreren Stellen verbreitert, an anderen Punkten werden Kurven abgeflacht, es werden Brücken ertüchtigt, und Brunsbüttel bekommt eine fünfte Schleusenkammer. Laut BMVI-Pressemitteilung vom 12. Oktober investiert der Bund insgesamt »mehr als 2,6 Milliarden Euro in Erhalt und Ausbau des Kanals«. Schließlich sei der Kanal »elementarer Bestandteil globaler Transportwege«, jede Investition in ihn stärke die deutsche Wirtschaft.
Der NOK sei, so das BMVI, nach wie vor »die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt« und verzeichne mit 30.000 Schiffspassagen jährlich »fast doppelt so viele Schiffe wie der Suezkanal«. Der indes vermeldet im aktuellen Geschäftsbericht Einnahmen von 5,8 Milliarden US-Dollar (4,9 Milliarden Euro) für 18.880 Schiffspassagen – und kann so Investitionen wie die jüngste Erweiterung (acht Milliarden US-Dollar) binnen Kürze finanzieren. Der Panamakanal kam 2019 auf 13.785 Passagen und 2,97 Milliarden Dollar Transitgebühren.
|
© 2020 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Andreas Scheuer (CSU) am Kanal über die anstehenden Investitionen. Stand: 12.10.2020 17:19 Uhr
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Montag in Großkönigsförde das offizielle Startsignal für den Ausbau der Oststrecke gegeben – auch wenn die Bauarbeiten bereits seit Januar laufen. Am Montag war der symbolische Spatenstich, der Corona-bedingt verschoben werden musste. Das rund 20 km lange Teilstück des Nord-Ostsee-Kanals zwischen Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel-Holtenau gilt insbesondere für große Schiffe als Nadelöhr, deswegen wird der Kanal in den kommenden Jahren verbreitert – auf mindestens 70 Meter. Gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Kanal über die anstehenden Investitionen. 2,6 Milliarden Euro für InvestitionenScheuer betonte, wie wichtig der Kanal nicht nur für Schleswig-Holstein sondern ganz Deutschland sei: 125 Jahre alt und doppelt so viel Verkehr wie am Sueskanal. „Das sind Zahlen, die beeindrucken, aber sie helfen auch. Weil sie den Exportweltmeister Deutschland voranbringen und deswegen investieren wir hier in den nächsten Jahren 2,6 Milliarden Euro“, sagte Scheuer. Das Geld soll unter anderem in die Schleusen in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau fließen. Auch die Levensauer Hochbrücke bei Kiel wird damit finanziert. Günther hofft auf zügige BauarbeitenTatsächlich wurde der 1895 erbaute Kanal lange vernachlässigt, nun gibt es viel zu tun. „Man weiß ja, für große Bauprojekte brauchen wir lange Planungen. Nun können wir kräftig investieren“, so Scheuer weiter. Ministerpräsident Daniel Günther sprach beim Termin mit Scheuer auch die inzwischen zehn Jahre dauernden Sanierungsarbeiten im Rendsburger Kanaltunnel an. Das, so Günther, sei eine enorme Belastung für die Region. Nun aber freue er sich über die beginnenden Bauarbeiten an der Oststrecke: „Es ist eine gute Zeit, die anbricht und wir sehen, dass der Bund erhebliche Gelder zur Verfügung stellt und, dass der NOK eine große Priorität im Bund hat. Jetzt hoffen wir, dass es so schnell geht, wie geplant.“ DGB-Nord fordert mehr EngagementKritik kommt dagegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB Nord Chef Uwe Polkaehn spricht von einer Showeinlage am Nord-Ostsee-Kanal und pocht auf ein höheres Tempo beim Ausbau. Der aktuelle Rückgang an Passagen solle genutzt werden, um bauliche Investitionen vorzuziehen und den Kanal schneller zu ertüchtigen, so Polkaehn. „Die norddeutsche Wirtschaft, die Häfen und mehrere zehntausend Arbeitsplätze im Land sind mittelbar oder unmittelbar davon abhängig, dass diese Hauptschlagader des Schiffsverkehrs funktioniert“, meint der Gewerkschafter.
https://www.kn-online.de/Lokales/Nord-Ostsee-Kanal/Finanzspritze-vom-Bund-2-6-Milliarden-Euro-fuer-den-NOK-Ausbau?fbclid=IwAR1-nMqj1XuiavI7RV43pCaky4a3Rl1UiIW0_70aBzDpgImog7VMH2zsqEk Copyright KN Online danke Frank Behling
|
|
Pressekontakt Copyright Norddeutsche Rundschau danke Ralf Poeschus Die „Lebensader“ wird ausgebautDer Bund unterstützt den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals mit 500 Millionen Euro / Schiffsverkehr derzeit rückläufigGroßkönigsförde Bei einem Besuch auf der Baustelle hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das Startsignal für den Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals gegeben. 500 Millionen Euro investiere der Bund in den kommenden zehn Jahren in die 20 Kilometer lange Engstelle der künstlichen Wasserstraße zwischen Kiel und Großkönigsförde. „Alles in allem 2,6 Milliarden Euro steckt der Bund in den nächsten Jahren in den Ausbau und Erhalt des Kanals“, sagte Scheuer. Dieser habe in 125 Jahren nichts an Bedeutung verloren. Die Passage sei für die Reeder schneller und billiger als die Fahrt um Skagen. Zudem werde weniger Kohlendioxid ausgestoßen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dankte der Bundesregierung für das klare Bekenntnis zum Nord-Ostsee-Kanal. „Vieles ist im Moment noch im Bau, manches noch in Planung“, sagte er. Der Ausbau dieser „Lebensader“ sei sehr wichtig für die Wirtschaft im Norden. Der rund 100 Kilometer lange Kanal zwischen Kiel und Brunsbüttel gilt als die weltweit meistbefahrene künstliche Seewasserstraße. Nachdem er lange vernachlässigt wurde, werden jetzt auch die Schleusen in Brunsbüttel und Kiel erneuert und die alte Levensauer Hochbrücke bei Kiel ersetzt. Im Kanal gebe es etwa doppelt so viel Verkehr wie im Suezkanal, sagte Scheuer und sprach von „100 Kilometern nasser Autobahn“. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Neubau der neuen Schleusenkammer in Brunsbüttel voraussichtlich nochmals 370 Millionen Euro teurer wird als zuvor geplant. Im Entwurf für das Haushaltsgesetz 2021 wird aktuell mit Gesamtausgaben von 1,2 Milliarden Euro gerechnet. Dies entspricht einer Steigerung um 45 Prozent zum Vorjahr, als noch mit 830 Millionen Euro kalkuliert wurde. Als der Bau 2009 beschlossen wurde, waren noch 273 Millionen Euro veranschlagt worden. Scheuer: „Die Schleuse in Brunsbüttel ist ja nicht ein einfaches Projekt.“ Ministerpräsident Günther sprach von einer „exorbitanten Kostensteigerung“. Aber Bauvorhaben verteuerten sich bei langen Planungszeiten oft. Nötig seien schnellere Planungsverfahren. Die Dänen zeigten, dass es auch im Rahmen des EU-Rechts deutlich schneller gehen könne. Der Verkehr auf dem Kanal war schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Ladungsmenge der Schiffe betrug 2019 noch 83,5 Millionen Tonnen, nachdem es im Spitzenjahr 2008 rund 105 Millionen Tonnen waren. Im Juli setzte der Bund die Befahrungsabgaben bis Jahresende aus, um den Kanal zu stützen. Nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung nutzten den Kanal im Juli 1905 Schiffe. Ein Jahr zuvor waren es noch 2226 gewesen. „Der aktuelle Rückgang an Passagen sollte genutzt werden, um bauliche Investitionen vorzuziehen und den Kanal schneller zu ertüchtigen“, sagte der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn. Die norddeutsche Wirtschaft, die Häfen und mehrere zehntausend Arbeitsplätze seien davon mittelbar oder unmittelbar abhängig. dpa
|
|
Bei Fragen zu Ihrem Abonnement schicken Sie uns bitte eine E-Mail an: service@abo.bmvi.de |
|
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an: |
|
||||
Bund investiert 500 Millionen Euro in Ausbau der Oststrecke |
||||
|
Scheuer: Investition in NOK schützt Klima und stärkt Wirtschaft |
||||
|
Der NOK ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Mit 30.000 Schiffspassagen jährlich verzeichnet er fast doppelt so viele Schiffe wie der Suezkanal. Mit dem Spatenstich zum ersten Ausbauabschnitt der Oststrecke wird heute offiziell ein Großprojekt für die Bundeswasserstraße gestartet: 500 Millionen Euro investiert der Bund in den kommenden zehn Jahren in die 20 Kilometer lange Strecke zwischen Kiel und Großkönigsförde, insgesamt fließen mehr als 2,6 Milliarden Euro in Erhalt und Ausbau des Kanals – so viel wie an keiner anderen Bundeswasserstraße. Bundesminister Andreas Scheuer:
Ministerpräsident Daniel Günther:
Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der GDWS:
Bei der Planung wurden die verschiedensten Interessen berücksichtigt: von Bund und Land, Landkreisen und Kommunen, Anwohnern und Reedern, den Landwirten und Naturschützern. Zum Beispiel wird es einen durchgehenden Seitenweg geben, den Radfahrer und Spaziergänger nutzen können. Selbst der Bodenaushub wird so gestaltet, dass die Flächen sich nahtlos in das natürliche Landschaftsbild des norddeutschen Hügellandes einfügen. |
||||
hat ein Video in der Playlist Bericht aus Berlin #FragMathias gepostet.

Eine große Möwe gleitet durch die laue Sommernacht über die Schleuse und setzt dann rasch zur Landung an. Ihr Landeplatz auf dem Balkon des Schleusenmeister-Hauses bietet einen tollen Blick auf Nord- und Südkammer des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel. „Die kommen sogar rein und setzen sich bei uns auf den Teppich“, sagt Heiko Kroymann-Meyer. Der 53-Jährige ist seit zwölf Jahren Schleusenmeister in Kiel-Holtenau. Er hat drinnen vor einer Wand aus fünf Monitoren die Nachtschicht.
Im Leben des Schleswig-Holsteiners spielte die künstliche Wasserstraße die meiste Zeit seines Lebens eine Rolle. Seine Kindheit verbrachte er in Breiholz, ziemlich genau an der Mitte des Kanals. „Da war mein Spielplatz an der Kanalböschung.“ Das Wasser und die Schiffe hätten ihn bereits als Kind begeistert. Seit 27 Jahren hat er hier seinen Arbeitsplatz. Die ersten 15 Jahre brachte er mit einer Kanalfähre Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger von einer auf die andere Seite.
Elf Jahre lang selbst Kapitän auf Nord- und Ostsee
Davor fuhr er selbst elf Jahre lang als Kapitän auf kleiner Fahrt auf Nord- und Ostsee. „Wir sind viel durch den Kanal gefahren.“ Das knapp 80 Meter lange Schiff gehörte seinem Vater. Auch der Großvater fuhr zur See. „Erst waren es Holzpakete aus Skandinavien, die wir immer geholt haben, dann ging es über in Containerschifffahrt.“ Ob es noch in den Fingern juckt, wenn die dicken Pötte vor ihm in die Schleusenkammer fahren. „Gar nicht“, antwortet er blitzschnell.
Spiegelglatt ist das Wasser an diesem Abend. Und das liegt nicht nur an der Windstille. Die Folgen der Corona-Pandemie schlagen auf die Schifffahrt durch. „Im Moment ist es sehr mau“, sagt der Schleusenmeister. Für die Nacht stehen nur wenige größere Schiffe auf der Liste, die den Kanal verlassen oder von der Ostsee kommend die knapp 100 Kilometer lange Passage von Kiel nach Brunsbüttel angehen. Ein wesentlicher Grund sind die niedrigen Spritpreise. «So dass die meisten sagen: Dann fahren wir oben rum», sagt Kroymann-Meyer.
„Seit Anfang April herrscht im Kanal Flaute“
Das beobachtet auch Jens Knudsen. „Seit Anfang April herrscht im Kanal Flaute“, sagt der Vorsitzende der Initiative Kiel-Canal – wie die Wasserstraße international heißt. „Seit Ausbruch von Corona meiden Reeder den Kanal aus zwei Gründen: Erstens wegen der extrem niedrigen Treibstoffpreise und zweitens aus Angst, die Crew könne sich während der Passage mit dem neuartigen Coronavirus infizieren.“ Viele Reeder schickten ihre Schiffe deshalb auf den Umweg über Skagen. „Es gab Momente, wo es für ein Feederschiff mit 1400 Standardcontainern (TEU) 1000 Euro günstiger gewesen ist, oben herumzufahren.“ Der Bund hat reagiert. Er will den Kanal durch Aussetzen der Befahrungsabgaben bis Jahresende stützen.
Um Mitternacht herrscht aber doch Betrieb in der Schleuse. Mindestens sieben Stunden brauchen Schiffe von Brunsbüttel nach Kiel. Auf dem Weg nach Kokkola (Finnland) macht das knapp 135 Meter lange Containerschiff „Aurora“ fest. An Land kümmern sich zwei Festmacher um die dicken Taue. Wenige Minuten später folgt die knapp 158 Meter lange „Tunadel“ auf dem Weg nach Polen. «Das sind beides Stammgäste», sagt Kroymann-Meyer. Nur einen Fingertipp auf dem Monitor braucht der Schleusenmeister, um hinter beiden Schiffen das schwere Schleusentor zufahren zu lassen. In der Regel dauere eine Schleusung etwa 45 Minuten. Ist die Warteliste lang, bestehe die Herausforderung im «Schiffe stopfen», um möglichst viele gleichzeitig zu schleusen.
Lesen Sie auch: Historische Krise zum 125. Geburtstag
Mehrfach krachen Schiffe gegen Schleusentor
Aber nicht immer läuft alles glatt. Mehrfach krachten Schiffe in die Schleusentore. Viele Pötte seien schnell unterwegs, sagt Kroymann-Meyer. „Die Kapitäne kennen ihre Schiffe. Die reißen einmal den Hebel runter und dann stehen die.“ Oder es kracht wie vor wenigen Monaten in einer Nachtschicht von Kroymann-Meyer. Zwar laufe deshalb noch immer Wasser durchs Tor, sagt er.
Folgenreicher aber war die Havarie der „Akacia“ im Februar 2018. Das Containerschiff rammte das Tor der Südkammer so heftig, dass der Bug die Stahlkonstruktion teilweise durchbrach. Sieben Wochen fiel die Kammer wegen Reparaturen aus, der Schaden lag im zweistelligen Millionenbereich. „Da war ich nicht hier“, sagt Kroymann-Meyer mit einem Lächeln. Als Ursache wurde bei der «Akacia» seinerzeit ein Defekt an der Maschinenanlage vermutet.
Einsätze für die Wasserschutzpolizei
Manchmal stoppt aber auch die Wasserschutzpolizei die Schiffe. Kroymann-Meyer erinnert sich an einen arg betrunkenen Kapitän. Da habe er nach dem Hinweis eines Lotsen die Polizei informiert. Nur mit Mühe sei der Seemann in der Schleuse von Bord gebracht worden. Dort habe er sich auf einen Poller gesetzt, weil er nicht mehr laufen konnte. „Dann haben sie ihn irgendwann auf die Ladefläche eines Elektrofahrzeugs gezogen und sind mit ihm ab. Das war ein Bild für die Götter.“ Diese schwarzen Schafe gebe es leider immer wieder.
Nicht nur große Schiffe, Jachten und Segelboote nutzen die Schleusenanlage in Holtenau. 2016 sorgte ein Delfin für Aufregung. „Der ist regelmäßig in den Kanal und wieder raus. Er wurde regelmäßig durchgeschleust“, sagt der Norddeutsche. Aus Sorge, das Tier könne durch die Geräusche der Schiffe und die Verwirbelungen des Wassers Schaden nehmen, wurden keine Schiffe gemeinsam mit ihm in die Schleuse gelassen. „Wir wollten dem ja nix tun“, sagt Kroymann-Meyer. Die Sorge sei letztlich unbegründet gewesen: „Der hat hier Sprünge gemacht.“
Der Kieler Schleusenmeister macht seinen Job gern. Der werde ihm nicht langweilig. „Und ich habe noch den Kontakt zur Seefahrt. Auch wenn ich nicht mehr zur See fahren will.“
Weitere Nachrichten zum Nord-Ostsee-Kanal lesen Sie hier.
Von RND/dpa
https://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/5-schleusenkammer-in-brunsbuettel-soll-ende-2026-fuer-schiffsverkehr-freigegeben-werden-id27941797.html
Copyright Norddeutsche Rundschau
https://zeitung.shz.de/glueckstaedterfortuna/1876/?gatoken=dXNlcl9pZD1mZWMyYzNlMzU1ODQ4NzEyMmFiMTI4YWI5NTZkYjgxZiZ1c2VyX2lkX3R5cGU9Y3VzdG9t
Die große Flaute Copyright Norddeutsche Rundschau
Im April 25 Prozent weniger Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal – und es kann noch schlimmer kommen
Kiel Wenn die kräftigen PS-Boliden der Kieler Schleppgesellschaft (SFK) tagelang arbeitslos an der Kaikante liegen, ist das für Küstenbewohner ein untrügliches Zeichen: Auf Nord- und Ostsee – besonders aber in den Schleusen und auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) – ist wenig los. Das steht jetzt auch offiziell fest: Im Vergleich zum Vorjahresmonat haben im April 2020 rund 25 Prozent weniger Schiffe den NOK befahren – „insgesamt nur 1749“, teilt Claudia Thoma von der Wasser und- Schifffahrtsdirektion in Kiel mit. Bei den Ladungsmengen registrierte die Behörde nach 7,01 Millionen Tonnen im April 2019 jetzt nur noch 5,01 Millionen, das entspricht einem Minus von 29 Prozent.
„Hauptfaktoren für die aktuell rückgängigen Verkehrszahlen im Nord-Ostsee-Kanal sind die coronabedingt nachlassende Umschlagsaktivität in den Häfen der Nord- und Ostsee und die niedrigen Bunkerpreise. Dies führt dazu, dass Schiffe die Skagenroute wählen“, erklärt Thoma.
Der Ältermann der Lotsenbrüder fürchtet, dass diese Talfahrt noch nicht zu Ende ist. „Auch die ersten beiden Maiwochen sahen alles andere als gut aus.“ Er will nicht ausschließen, dass der Rückgang gegenüber dem Vorjahr sogar 40 Prozent ausmachen wird.
Auch Probst verweist auf niedrige Treibstoffkosten und den abnehmenden Zeitdruck, der die Reeder veranlasst die längere Route rund um Dänemarks Nordspitze zu nehmen. Anfang des Jahres hat eine Tonne Schweröl noch 350 Dollar gekostet, im Moment zahlen die Schiffe gerade mal 100 Dollar.
Aber auch die Sorge vor einer Infektion der Besatzung hält laut Probst viele Reeder davon ab, mit ihren Schiffen durch den Kanal zu gehen. Sie wollen maximale Kontaktarmut. Kanalsteurer, Lotsen, Agenten die zwischen Kiel und Brunsbüttel das Schiff betreten, werden als Gefahr angesehen.
Der massive Rückgang der Passagen verursacht bei den Lotsen erhebliche finanzielle Einbußen. Sie gelten zwar als Selbstständige, ihre Brüderschaft hat aber einen öffentlich-rechtlichen Status – deshalb fallen sie durch alle Raster staatlicher Sofortprogramme.
Jens Broder Knudsen, Vorsitzender der Initiative Kiel-Canal, forderte kürzlich in einem Brief an das Bundesverkehrsministerium die Senkung der Abgaben für das Befahren des Kanals, um die Wasserstraße attraktiver zu machen. Angesichts der milliardenschweren Investitionen in die Kanalverbreiterung und des Neubaus der Schleusen macht der vorübergehende Verzicht auf die Befahrensgebühren den Kohl auch nicht mehr fett, meinen Experten.
Derweil stehen nicht nur die Deutschen Werften am Abgrund und fordern Neubauaufträge der öffentlichen Hand (wir berichteten). Auch der Verband Deutscher Reeder (VDR) schlägt Alarm und sieht die nationale Handelsflotte in Gefahr. Die Umsätze und Frachtraten seien im Schnitt um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. Ein weiterer Verfall wird für die kommenden Monate erwartet. Fast 500 Schiffe seien weltweit ohne Aufträge, das sei das höchste Niveau aller Zeiten. kim
Copyyright Kieler Nachrichten Online danke Frank Behling

Kiel
„Der April war der Monat mit den wenigsten Schiffspassagen seit Langem. Wir haben einen Rückgang bei den Passagen um 40 Prozent registriert“, sagt Jens-Broder Knudsen. 2200 bis 2800 Schiffe passieren normalerweise pro Monat den Kanal. Nach KN-Informationen waren es im April unter 2000 Schiffe.
Die konkreten April-Zahlen ermittelt die Generaldirektion Wasserstraßen Schifffahrt (GWDS) in den nächsten Tagen. Für die Makler steht aber schon fest: Der April hat einen bislang beispiellosen Einbruch bei den Verkehrszahlen gebracht.
Abgabensenkungen sollte Ausweg aus der Krise sein
Ein Ausweg aus der Krise sollte die Senkung der Abgaben sein, die Reeder für die Passagen ihrer Schiffe zahlen müssen. Bereits Anfang April hatte die Initiative Kiel Canal sich deshalb mit einem Schreiben ans Verkehrsministerium gewandt. Dem Hilferuf aus Schleswig-Holstein erteilte das Ministerium aber eine deutliche Absage.
https://www.behoerden-spiegel.de/2020/04/21/wsv-sechs-projekte-im-pb-modell/
Copyright Behoerdenspiegel
WSV: Sechs Projekte im PB-Modell

Bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) werden aktuell sechs Pilotprojekte durchgeführt, bei denen Planung und Bau (PB-Modell) aus einer Hand erfolgt. Klar ist, dieses Modell eignet sich nur für Großprojekte.
Das PB-Modell sieht eine stärkere Einbindung der Bauwirtschaft in den Planungsprozess vor, um Beschleunigungseffekte zu erzielen. “Bei entsprechender Leistungsfähigkeit und Qualifikation des Auftragnehmers und optimalem Verlauf könnte die Anwendung des PB-Modells Vorteile in der Bauabwicklung durch Reduzierung von Streitfällen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer haben”, heißt es seitens des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) auf eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag (Drucksache 19/18327).
Bei den Infrastrukturvorhaben im Bereich der Wasserstraßen handelt es sich um den Bau eines Trockendocks für Schleusentorinstandsetzungen in Brunsbüttel, ein Spundwand-/Pollersanierungsprogramm im Westdeutschen Kanalnetz, den Neubau des Wehres Wieblingen (Neckar) sowie Teilleistungen des Neubaus der Schleuse Kriegenbrunn (Main-DonauKanal).
Darüber hinaus werden zwei weitere Maßnahmen im Hochbau umgesetzt: Einerseits der Neubau eines Betriebsgebäudes in Brunsbüttel (Nord-Ostsee-Kanal) und andererseits der Neubau Außenbezirk und Leitzentrale Kachlet (Donau).
Anhand der gemachten Erfahrungen sollen Kriterien für eine Vergabe von PB-Modellen erarbeitet werden. Doch schon jetzt zeige sich, dass auch in Zukunft der Aufwand für die Vergabe nur bei Großprojekten zu rechtfertigen sei.
5. Schleusenkammer in Brunsbüttel soll Ende 2026 für Schiffsverkehr freigegeben werden
Häfen als Drehscheibe Copyright THB
Infrastruktur Personalnotstand in Verkehrsbehörden bremst Investitionen massiv
Das Eisenbahn-Bundesamt gerät beim Schienenausbau in Personalengpass.
Düsseldorf Die gute Nachricht lautet: Im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sind von 1 277 Stellen nur 68 nicht besetzt, zehn weniger als noch im vergangenen Jahr. Die schlechte Nachricht: Ausgerechnet in der Zentralabteilung, die für das Personalmanagement zuständig ist, fehlen 34 Mitarbeiter.
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) muss aufpassen, dass in seinem Haus keine Zustände einkehren wie in vielen Verkehrsbehörden des Bundes, für die der Minister oberster Dienstherr ist.
In den 19 Ämtern und Dienststellen, die alle für die Mobilität in Deutschland eine wichtige Rolle spielen, herrscht teilweise eklatante Personalnot. 3 522 Stellen sind nach einer Übersicht der Bundesregierung unbesetzt. Spitzenreiter ist das Bundesamt für den Güterverkehr (BAG), wo 27 Prozent des Stellenplans offen sind. Darauf folgt das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), das 18,5 Prozent unbesetzte Stellen ausweist.
Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), gerade in der Endphase einer radikalen Neuorganisation, kommt zwar nur auf 13,3 Prozent Vakanz im Besetzungsplan. In absoluten Zahlen weist die über das gesamte Bundesgebiet verteilte Behörde allerdings ein erschreckendes Defizit von 1 623 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus.
Diese Zahlen gehen aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Sven-Christian Kindler hervor.
Themen des Artikels
Verwaltung
Die Binnenschiffer haben den Personalmangel in diesen Tagen schmerzlich zu spüren bekommen. Die Wasserstraßenverwaltung teilte Ende März kurzerhand mit, Schleusen nur noch 16 Stunden pro Tag statt wie bislang rund um die Uhr offen zu halten. Nachtfahrten mit Binnenschiffen fallen damit auf vielen Kanälen aus.
Die Begründung der WSV mutet sonderbar an: Sie wolle die Personalkapazitäten vorsorglich wegen der Coronakrise auf ein „Kernnetz“ konzentrieren, um für Notsituationen ausreichend Personalreserven aufzubauen. Mit anderen Worten: Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hat keine Personalreserve zum Betrieb der Schleusen.
Die Personalkrise der Verkehrsbehörden könnte sich noch verschärfen. Laut den Unterlagen der Bundesregierung werden 6 623 Stelleninhaber bei den 19 nachgeordneten Behörden bis zum Jahr 2030 in den Ruhestand gehen, davon die Hälfte allein bei der WSV. Und das sind nur die planmäßigen Ruheständler.
Die Versäumnisse der Personalpolitik in den vergangenen Jahren im CSU-geführten Verkehrsministerium zeigen sich immer offensichtlicher, lautet das Fazit der Grünen. Die besonders angespannte Personalsituation bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung „droht die notwendigen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den Wasserstraßeninfrastrukturen weiter zu verlangsamen und damit den Binnenschiffsverkehr in Deutschland auszubremsen“, fürchtet Kindler.
Minister Scheuer könne die „verkorkste WSV-Reform nicht länger aussitzen und sich weiter vor allem mit bayerischen Straßen beschäftigen“, kritisiert Kindler. Diese Reform geht ins achte Jahr. Kern waren die Abschaffung der sieben regionalen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen und die Bildung einer neuen Oberbehörde namens GDWS in Bonn, die jetzt 39 Wasser- und Schifffahrtsämter sowie sieben Neubauämter koordinieren soll. Die WSV äußerte sich auf Anfrage nicht dazu.
723,5 Millionen Euro liegen geblieben
Für die Binnenschiffer ist der Personalmangel in der Schifffahrtsverwaltung nichts Neues. Das sei schon „seit Jahren ein Riesenproblem“, bestätigt Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Es fehle an allem, vor allem an Ingenieuren. „Erst war nicht genug Geld im Haushalt, und jetzt ist die Verwaltung nicht in der Lage, es zu verbauen.“ Es mangelt sogar an Personal zur Abnahme von Patentprüfungen für junge Binnenschiffer.
Nicht weniger kritisch ist die Lage beim Bundesamt für Güterverkehr, wo 652 von 2400 Stellen laut Regierungsauskunft nicht besetzt sind. Das BAG muss unter anderem die Lkw-Maut kontrollieren, Lenk- und Ruhezeiten von Lkw-Fahrern überwachen und letztlich dafür sorgen, dass der wachsende Güterverkehr auf Deutschlands Autobahnen nicht im Chaos endet.
Niemand könne erwarten, dass eine Bundesbehörde ihre Aufgaben ordentlich erledigt, wenn mehr als ein Viertel ihrer Stellen nicht besetzt sind, sagt Grünen-Politiker Kindler. Die Behörde selbst wollte die in Berlin „genannte Zahl unbesetzter Stellen in dieser Höhe nicht bestätigen“. Zugleich verweist das BAG aber auf den Zuwachs an Aufgaben und die damit verbundene „Stellenmehrung“.
Welche Folgen eklatanter Personalmangel haben kann, das belegen auch die Zahlen der Eisenbahn. Mehr als 100 Millionen Euro, die für den Aus- und Neubau des Gleisnetzes vorgesehen waren, sind 2019 nicht verbaut worden. Dabei haben sich Regierungskoalition und Deutsche Bahn fest versprochen, das Bahnnetz mit Milliarden schnell auf Vordermann zu bringen.
Über die letzten Jahre sind nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums sogar 723,5 Millionen Euro liegen geblieben. Das geht aus einer Anfrage des Grünen-Politikers Matthias Gastel an die Bundesregierung hervor.
Kaum baureife Projekte
„Die Deutsche Bahn kann nur mit Ach und Krach die im Bundeshaushalt bereitgestellten Mittel verbauen“, erklärt Gastel. Die Bundesregierung gesteht in ihrer Antwort auf die Anfrage sogar selbst ein, dass sie in der Vergangenheit viel zu wenig in die Planung investiert habe und daher jetzt kaum baureife Schienenprojekte vorliegen. „Den Mangel hat die Bundesregierung zu verantworten. Wer nicht rechtzeitig plant, kann später auch nicht bauen“, sagt Bahnpolitiker Gastel.
Einer der Engpässe ist das Eisenbahnbundesamt, das bei der Planung von Bahnstrecken eine entscheidende Rolle spielt. Nichts geht ohne die Zustimmung der Bonner Behörde, nicht einmal die nachträgliche Elektrifizierung einer bereits bestehenden Strecke.
Das EBA ist unter anderem für die Planfeststellung für Bauprojekte verantwortlich. Insider berichten, dass schon die Vollständigkeitsprüfung von Unterlagen manchmal ein ganzes Jahr Zeit verschlinge. Bis dann gebaut werden kann, gehen noch mal Jahre ins Land. Da überrascht es nicht, dass vom Staat bereitgestellte Millionen nicht wie geplant abgerufen werden. Dem EBA fehlt es an Personal. 274 von 1482 Stellen sind laut Aufstellung der Bundesregierung nicht besetzt.
Das EBA begründet auf Anfrage den „größten Teil der aktuellen Vakanzen“ mit neuen Aufgaben, die der Gesetzgeber der Behörde zugewiesen habe, wodurch ein „erheblicher Personalmehrbedarf“ entstanden sei. Unter anderem sei das EBA nun auch Anhörungsbehörde in Planfeststellungsverfahren, was bislang Aufgabe der Bundesländer war.
Angesichts dieses Mangels in den Verkehrsbehörden verwundert die Aufforderung des Verkehrsministers an „die Kolleginnen und Kollegen der Länder“, dafür Sorge zu tragen, dass trotz Coronakrise auf „den Baustellen weiter gearbeitet wird, Ausschreibungen vorbereitet und Vergabeverfahren durchgeführt werden“. Denn, so der Minister in einer Videokonferenz mit 120 Mitgliedern des Deutschen Verkehrsforums kurz vor Ostern: „Wir brauchen eine gute Infrastruktur in Deutschland. Daran gibt es nichts zu rütteln.“
Mehr: Die Bahn muss auch in Zukunft wirtschaftlich betrieben werden.
es gesamten Ressorts wird durch die unbesetzten Stellen massiv eingeschränkt.“Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sieht die Häfen im Land in der Corona-Krise gut aufgestellt. Sie würden „eine Schlüsselfunktion als Drehscheibe der Logistik“ haben. „Der Warenfluss über die Häfen muss gewährleistet sein, damit Unternehmen ihre Produktion aufrechthalten können“, sagt der Minister. „Die Häfen sind sich ihrer Verantwortung bewusst“, so Frank Schnabel, Vorsitzender des Gesamtverbands Schleswig-Holsteiner Häfen. tja

Sperrwerk in Balje: Schließzeiten eingeschränkt
BALJE. Die Brückenschließzeiten der Klappbrücke über das Oste-Sperrwerk müssen vorübergehend geändert werden. Die Betriebszeiten des zwischen dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven und dem Landkreis Stade vereinbarte Brückenbetriebsdienstes sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr im vollen Umfang leistbar.
Die Zeiten, in denen die Brücke für den öffentlichen Straßenverkehr passierbar ist, wird auf die Zeiten von Montag bis Donnerstag, 7 bis 15.30 Uhr, und Freitag von 7 bis 13 Uhr geändert. In den dazwischen liegenden Zeiten am Nachmittag, abends, über Nacht sowie das komplette Wochenende und den Feiertagen ist die Brücke hochgefahren und für den Straßenverkehr nicht passierbar.
Die Klappbrücke über das Oste-Sperrwerk bei Neuhaus/Belum ermöglicht eine zweite Überfahrt für den Straßenverkehr über die Oste zusätzlich zur Überfahrt der Landstraße L 111 über die Klappbrücke bei Geversdorf und wird gerne von der ansässigen Bevölkerung und Touristen sowie Besuchern des Natureum genutzt. Hierzu wird die Brücke zu festgelegten Zeiten für den öffentlichen Straßenverkehr heruntergefahren und nur bei Schiffsverkehr für die Schifffahrt geöffnet.
Vor dem Hintergrund der schnellen Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland trifft das WSA Cuxhaven Maßnahmen, um seine Aufgaben uneingeschränkt wahrnehmen zu können. In der Folge werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WSA Cuxhaven vorrangig für die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs und den Zustandserhalt der Bundeswasserstraße Elbe für die Schifffahrt eingesetzt. Daneben verlagert das WSA Cuxhaven auch die Personalressourcen in die systemrelevanten Bereiche, um seine Verpflichtung zum Sturmflutschutz der Osteniederung ohne Einschränkung zu erfüllen.
„Die Entscheidung des Krisenstabes des WSA Cuxhaven, vorübergehend die Schließzeiten der Brücke über das Oste-Sperrwerk zu verringern, ist notwendig, um den Betrieb des Oste-Sperrwerks auch in dieser schwierigen Situation mit der Ausbreitung von Covid-19 ohne große Einschränkungen sicherzustellen. Wir konzentrieren unsere Ressourcen damit auf einen besonders wichtigen Bereich, um den Hochwasserschutz des Hinterlandes sicherzustellen. Damit sind wir auch auf eine Zuspitzung der Situation und einen eventuell zu befürchtenden krankheitsbedingten Ausfall unseres Sperrwerkpersonals vorbereitet. Im Falle einer Sturmflut wird das Oste-Sperrwerk rechtzeitig geschlossen sein. Das können wir sicherstellen. Ich bitte daher alle Nutzerinnen und Nutzer der Brücke um Verständnis, dass aktuell eine Priorisierung auf die besonders wichtigen Aufgaben erforderlich ist“, erläutert Bernhard Meyer, Amtsleiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Hamburg und Cuxhaven, die Maßnahme.
Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ist für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf den Bundeswasserstraßen sowie den Erhalt des Zustands der Bundeswasserstraßen für die Schifffahrt verantwortlich. Als Strom- und Schifffahrtspolizeibehörde obliegt der WSV auch die Gefahrenabwehr in diesen Bereichen.
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Cuxhaven ist unter anderem für den Bereich der Bundeswasserstraße Elbe von St. Margarethen bis zur Elbe-Ansteuerungstonne in der Nordsee zuständig. Mit der Errichtung des Oste-Sperrwerks hat des WSA die rechtliche Verpflichtung zum Betrieb des Sperrwerks und damit für die Gewährleistung des Sturmflutschutzes übernommen. Im Zuge der WSV-Reform werden demnächst die WSÄ Cuxhaven, Hamburg und Tönning zum neuen WSA Elbe-Nordsee zusammengeführt.
https://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/5-schleusenkammer-in-brunsbuettel-soll-ende-2026-fuer-schiffsverkehr-freigegeben-werden-id27941797.html
Copyright Norddeutsche Rundschau
5. Schleusenkammer in Brunsbüttel soll Ende 2026 für Schiffsverkehr freigegeben werden
Doch die Arbeiten seien immer wieder ins Stocken geraten, sagte Menke. „Sonst wären wir ja nicht hinter dem Zeitplan.“ Zu den Herausforderungen habe die Herstellung der Kampfmittelfreiheit gezählt. „Bei einer solchen Baustelle muss sichergestellt sein, dass bis zu einer bestimmten Tiefe sich im Boden keine Kampfmittel befinden.“ Spezialisten mussten aufwändig sondieren und räumen – zum Teil arbeiteten sie ohne Sicht. „Das hat zu Verzögerungen geführt.“ Ein grundsätzliches Problem ist jedoch laut Menke die Baustelle selber. „Eine Insellage. Rechts und links sind Schleusen, die über 100 Jahre alt sind. Das heißt, man kann nicht wie auf einer grünen Wiese fröhlich die große Ramme rausholen, sondern man muss immer behutsam vorgehen.“
Auch das Material müsse mit einer Fähre herangeschafft werden. So wurden für Arbeiten auf der Sohle der etwa 26 Meter tiefen Baugrube 2600 Kubikmeter Beton binnen 29 Stunden heran geschafft. Da die insgesamt rund viereinhalb Meter mächtige Konstruktionsbetonsohle in zwei Schritten aufgebaut wird, muss das noch einmal erfolgen.
Anschließend sollen in mehreren Etappen die etwa vier Meter breiten Torkammerwände in Massivbauweise erstellt werden. Menke: „Das ist quasi eine Garage, in die das Schleusentor geschoben wird, wenn Schiffe in die Schleusenkammer hinein oder aus ihr herausfahren wollen.“ Die Arbeiten an den Wänden der neuen Schleusenkammer gehen laut Menke schrittweise voran. In einigen Restbereichen werde die Spundwand noch mit Schrägpfählen tief im Erdreich verankert. Dort können anschließend Abschirmplatten betoniert werden, die später das eigentliche Schleusendeck tragen. Auf den Abschirmplatten selber sitzen auch die massiven Fundamente aus Stahlbeton für die Poller zum Festmachen von Schiffen in der Schleuse.
Aktuell gibt es nach Angaben der WSV keine Behinderungen im Baubetrieb. Auch die Corona-Pandemie habe bislang noch keine Auswirkungen gezeigt, sagte Menke. „Bis jetzt läuft alles normal.“
– Quelle: https://www.shz.de/27941797 ©2020Copyright KN Online danke Frank Behling
Seit Jahren hakt es bei der Schleusensanierung und dem Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals.
Copyright Norddeutsche Rundschau danke Ralf Pöschus
shz+ Nutzer
Brunsbüttel
Brunsbüttel | Nach nur siebenjähriger Bauzeit feierte Kaiser Wilhelm II. 1895 die Fertigstellung des rund 100 Kilometer langen Nord-Ostsee-Kanals. 125 Jahre später ist die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt.
Am NOK hängen nicht nur unmittelbar 4000 Arbeitsplätze am Industrie- und Schleusenstandort Brunsbüttel und 12.000 Beschäftigungsverhältnisse, die im direkten Zusammenhang mit dem größten Industriegebiet in Schleswig-Holstein stehen. Auch unzählige Arbeitsplätze im Hamburger Hafen und anderen Industriestandorten sind vom Kanal abhängig.
Rund 29.000 Schiffspassagen verzeichnete der NOK im vergangenen Jahr. Schiffe, die – würde es den Kanal nicht geben – über die Nordsee um Skagen fahren müssten. Das wären nicht nur 250 Seemeilen (rund 460 Kilometer) mehr, sondern auch eine entsprechend höhere Belastung für die Umwelt. „Damit ist die international wichtige Transitwasserstraße auch ein echtes Umweltthema“, so der Brunsbütteler Hafenchef, Frank Schnabel. Dessen waren sich auch die Teilnehmer der Podiumsdiskussion der SPD-Bundestagsfraktion unter dem Titel „S.O.S. für den Nord-Ostsee-Kanal – Der Norden steht auf!“ Brunsbüttel einig.
Weiterlesen: Ältermann Matthias Probst fordert mehr Tempo bei Ausbau des Nord-Ostsee-Kanal
„Wir haben diese Veranstaltung ganz bewusst unter dasselbe Motto gestellt wie vor rund achteinhalb Jahren“, sagte Gastgeberin Bettina Hagedorn. Denn wie zum Zeitpunkt der Veranstaltung im September 2011 bestünde auch heute Anlass zur Sorge um die Betriebsfähigkeit des Kanals, wenn auch aus anderen Gründen als damals, unterstrich die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium.
Bauvorhaben dauern an
Bedauerlicherweise sei es nicht gelungen Gelder vom Verkehrsministerium für den Bau der 5. Schleusenkammer, für die Grundsanierung der Schleusen in Brunsbüttel und Kiel sowie die Begradigung der Oststrecke zu bekommen. Das Parlament indes habe die Bedeutung des NOK sowohl für die Wirtschaft als auch für das Erreichen der klimapolitischen Ziele erkannt und mehr als zwei Milliarden Euro für die genannten Maßnahmen bereitgestellt, betonte Hagedorn.
DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn in seiner Kritik deutlich:
Ich habe den Eindruck, die bayerischen Verkehrsminister wissen nicht wo der Norden ist. Uwe Polkaehn
Klare Worte fand dieser für den Schleusenneubau: „Es ist ein Trauerspiel für die Bundesrepublik Deutschland und ein verheerendes Signal ins Ausland, dass es hierzulande nicht gelingt, in einem überschaubaren Zeitrahmen eine Schleuse herzustellen.“ 1996 wurden die Planungen aufgenommen. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin war für das laufende Jahr vorgesehen, musste jetzt jedoch aufgrund diverser Komplikationen auf das Jahr 2026 verlegt werden.
Weiterlesen: Nord-Ostsee-Kanal: Weniger Schiffe, weniger Ladung
Große Sorgen bereitet zudem das Fehlen von Fachkräften, die für einen Kanalausbau und den Betrieb stehen. „Wir alle haben diese Entwicklung verpennt“, brachte es Polkaehn auf den Punkt. Einige der Schleusenausfälle ließen sich auf den Personalnotstand zurückführen, kritisierte Matthias Probst, Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK I.: „Die Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) arbeiten seit Jahren an ihren Leistungsgrenzen.“ Beim WSA sei nicht nur der demografische Wandel schuld an der dünnen Personaldecke, sondern auch der von der Bundesregierung auferlegte Sparzwang, bedauerten die Vertreter der Sozialdemokraten und räumten ihrer Partei eine Mitschuld ein.
Kritik an Auftragsvergabe
Mahnende Worte kamen auch aus dem Publikum. Werner Hoffmann aus Wewelsfleth kritisierte die Vergabe der Bauaufträge von vier NOK-Fähren an eine Werft in Estland. „Wir werden alle Bemühungen vorantreiben die Rendsburger Werft zu stärken, indem wir ihr Reparaturaufträge zukommen lassen“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Stein abschließend.
|
Kosten für Schleusenbau explodieren Die Kosten für den Bau der 5. Schleusenkammer sind explodiert. Wurden zu Beginn der Maßnahme 300 Millionen Euro für den Bau veranschlagt, kletterten die Kosten zunächst auf 540 Mio. Euro. Aktuell belaufen sich die Schätzungen auf 830 Mio. Euro. Auch die Kosten für die Begradigung der Oststrecke haben sich gegenüber ersten Schätzungen verdoppelt und belaufen sich nun auf weit über 300 Mio. Euro. Der Bau des Trockeninstandsetzungdocks kostet 21. Mio Euro. Baubeginn soll im 2021 sein. 300 Mio. Euro werden für die Grundinstandsetzung der kleinen Schleuse in Kiel veranschlagt. |
„Mehr Tempo wünschenswert“




SOS für den Nord-Ostsee-Kanal: Gemeinsam mit meiner Bundestagskollegin Bettina Hagedorn war ich gestern in Brunsbüttel. Einen Tag lang ging es um die Zukunft der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt.
Die Sparmaßnahmen der letzten Jahre sind am Nord-Ostsee-Kanal nicht spurlos vorbeigegangen. Bei drei CSU-Verkehrsministern in Berlin war dieses nationale Mega-Projekt stets „Stiefkind“. Erst die Initiative der SPD-Fraktion im Bundestag „S.O.S. für den Nord-Ostsee-Kanal – der Norden steht auf!“ hat ab 2011 sichergestellt, dass die Finanzierung notwendiger Baumaßnahmen und Milliardeninvestitionen für den Kanal im Bundeshaushalt abgedeckt sind.
In einem intensiven Gespräch mit Vertretern aus dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt vor Ort sowie dem Verkehrsministerium haben wir uns gestern ausführlich über Baufortschritte am Kanal und die Personalsituation bei der WSV informiert sowie die Baustelle für die 5. Schleusenkammer begutachtet.
Abends haben wir mit mehr als 80 Interessierten diskutiert: Was muss getan werden, damit der NOK eine starke Achse für Wirtschaft und Schifffahrt bleibt? Wir waren uns einig: In vielen Dingen sind wir auf dem richtigen Weg. Große Herausforderung bleibt der Fachkräftemangel: Es muss der WSV gelingen, für junge Menschen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Für uns steht fest: Der Nord-Ostsee-Kanal ist DIE Lebensader des Nordens. Der Schiffsverkehr muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Hierfür brauchen wir moderne und sicher befahrbare Wasserstraßen. Zusammen mit dem Hamburger Hafen ist der NOK die zentrale Logistik-Drehscheibe im Norden und garantiert zehntausende Arbeitsplätze. Deshalb gehört seiner dringend erforderlichen Instandsetzung die höchste Priorität.
Kapitän Matthias Probst über Herausforderungen für den Erhalt des Nord-Ostsee-Kanals als unverzichtbare Wasserstraße
Brunsbüttel Rückläufige Passagen auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) allein seien noch kein Grund zu Panik, sagt Matthias Probst. Der 47-jährige Kapitän ist Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK, deren 130 Mitglieder täglich auf der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt unterwegs sind und neuralgische Punkte auf dem 125 Jahre alten Kanal bestens kennen. Probst ist zudem Vorstandsmitglied der Initiative Kiel Canal, die sich für den Ausbau des NOK stark macht. Mit ihm sprach Redakteur Ralf Pöschus.
„SOS am Nord-Ostsee-Kanal“ ist die morgige Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion in Brunsbüttel überschrieben. Ist es schon wieder so brenzlig?
Der Titel ist gut geeignet, um Publikum anzulocken, aber wir haben kein akutes Problem. Das war 2011 anders, als es um die fünfte Schleuse für Brunsbüttel ging. Seitdem hat der NOK viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hilft. Dennoch haben wir mit Problemen zu kämpfen, die bekannt sind und weiter angegangen werden müssen. Denn was wir auch sehen: Die Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sind alle engagiert – und an der Leistungsgrenze. Es fehlt schlicht an Personal.
Wie lässt sich hier Druck machen, dass sich die Situation verbessert?
Wir als Lotsen können das nicht, aber die Initiative Kiel Canal kann handfeste politische Forderungen stellen. Der Initiative gehören unter andere Hafengesellschaften Reedereien und andere Vertreter der Wirtschaft an. Wir sind gut vernetzt.
Die 100 Kilometer lange Wasserstraße zwischen Brunsbüttel und Kiel verzeichnete zuletzt ein gesunkenes Verkehrsaufkommen. Dennoch entspannt sich die Situation offenbar nicht. Woran liegt das?
Wir reden hier über einen Rückgang von 4,3 Prozent gegenüber 2018 – und haben dennoch rund 29.000 Passagen, darunter 22.000 Seeschiffe. Der NOK ist also immer noch die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Das Nadelöhr ist auch nicht der Kanal, das liegt an beiden Endpunkten. Als in Kiel reparaturbedingt im vergangenen Sommer eine Schleuse nicht zur Verfügung stand, haben viele der großen Seeschiffe nicht gewartet, sondern sind ums Kattegat gefahren. Wenn alle Schleusen funktionieren, sind sie zu 70 bis 80 Prozent ausgelastet. Der Rest ist eine notwendige Reserve. Darauf kann nicht verzichtet werden.
Für den Schleusenbau in Brunsbüttel musste lange getrommelt werden. Hat der Nord-Ostsee-Kanal beim Bund zu wenig Rückhalt?
Eigentlich trommeln wir schon länger, und nicht nur die SPD. Mehr Tempo beim Ausbau wäre natürlich wünschenswert. Aber hier zeigt sich, dass Effizienz nicht immer mit gesenkten Kosten zu tun hat, etwa bei der personellen Ausstattung der Kanalverwaltung. Daneben kämpfen wir mit dem Vergaberecht. Das führt zu Zeitverlusten durch Einsprüche und Klagen und ist insgesamt sehr aufwändig. Die Handlungskompetenz vor Ort müsste erhöht werden.
Warum ist der NOK unter Klima-Aspekten wichtig?
Der Klima-Aspekt ist spannend. Der Umweg ums Kattegat kostet einen Tag. Wenn wir über 22.000 Seeschiffe sprechen, die alle im Schnitt jeweils 30 Tonnen Treibstoff am Tag verbrauchen, verdoppelt sich die Menge bei der Fahrt um Dänemark – und damit der Schadstoffausstoß. Zugleich bin ich überzeugt, dass das Schiff als Transportmittel auf lange Sicht nicht ersetzbar sein wird. Daher gilt, den Schiffsverkehr auf einen kurzen und sicheren Weg zu konzentrieren – in diesem Fall auf den Nord-Ostsee-Kanal.
Sie sehen also positiv in die Zukunft des NOK?
Ich glaube nicht, dass der Kanal irgendwann ein Angelgewässer oder Freizeitrevier wird. Der NOK verbindet Nord- und Ostsee, macht die Häfen zu einem Verbund, der gut erreichbar ist. Davon profitieren besonders die Häfen an der Ostsee. Wenn ich den gleichen Liefertakt ohne den Kanal erhalten will, bräuchte ich mehr Schiffe, weil die ja länger unterwegs wären. Insofern ist der NOK ein echtes Stück Infrastruktur. Daher macht es für mich Sinn, die Anlagen zu ertüchtigen und die Oststrecke zu erweitern.
SOS für den Nord-Ostsee-Kanal, SPD-Bundestagsfraktion, Mittwoch, 19. Februar, 18.30 Uhr, Torhaus, Brunsbüttel. Anmeldungen: mathias-stein.wk@bundestag.de

Kiel (rtn) Jährlich nutzen rund 32 000 Schiffe und etwa 10 000 Sportboote den Nord-Ostsee-Kanal, der ihnen den Umweg um Skagen erspart.
Damit ist der Nord-Ostsee-Kanal, in der internationalen Schifffahrt „Kiel-Canal“ genannt, vor dem Panamakanal und dem Suezkanal der meistbefahrene Seekanal der Welt.
Am Freitag haben wir dort folgende Schiffe fotografiert: Sea Prospect, Sten Frigg, Deneb, Sten Bergen
Diesmal sorgt kein Schaden an einem Schleusentor für den Schiffsstau, sondern nur ein kleines Schutzblech an einem Lichtmast. „Das Blech könnte herunterfallen und stellt deshalb eine Sicherheitsgefahr für den Betrieb dar“, so ist vom Personal der Schleuse zu erfahren.
Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel hat angeordnet, dass erst bei Windstille einen Bergungsversuch mit einem Hubsteiger erfolgen soll. Da es keinen Notdienst gibt, kann dies frühestens am Donnerstag erfolgen.
Der Einsatz eines Höhenrettungsteams der Feuerwehr oder einer externen Firma kommt nicht in Betracht, da dieses Personal nicht mit der Anlage vertraut ist. „Dieser Ausfall ist für den Kanal gerade während der Sturmphase besonders ärgerlich. Das Amt hat aber nun einmal so entschieden“, sagt Matthias Probst, Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK 1 aus Brunsbüttel.
„Wir müssen jetzt den Kunden erklären, warum bei so einem relativ kleinen Problem gleich eine ganze Schleusenkammer stillgelegt werden muss“, sagt Jann Petersen. Und auch Probst kann die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen. „Der Lichtmast steht auf der Mittelmauer, die Seitenmauern sind davon gar nicht betroffen und könnten benutzt werden“, so Probst.
Die Folgen für die Schifffahrt sind erheblich. Laut der Webseite des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes müssen Schiffe vor Kiel-Holtenau derzeit acht Stunden Wartezeit einkalkulieren. Auf der Elbe müssen die Schiffe sechs Stunden warten.
Weitere Nachrichten aus dem Ressort lesen Sie hier.
Hans-Heinrich Witte überzeugt. Intensiv widmet sich der Jahresbericht auch dem wichtigen Lotsenversetzdienst im Bereich des Nord-Ostsee-Kanals (NOK). Eine zentrale Rolle spielt dabei das…
Guenther Goettling

Wie jetzt bekannt wurde, sind etwa bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) aktuell 158 Stellen und bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) insgesamt 1262 Stellen unbesetzt. Diese befänden sich „in unterschiedlichen Stadien der Besetzungsverfahren“, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Die Bundesregierung verneint darin weiter ausdrücklich die Nachfrage, ob die GDWS ein Personalproblem habe. Es sei gelungen, seit 2014 etwa 440 zusätzliche Stellen einzuwerben, heißt es weiter. Damit sei insbesondere der Ingenieurbereich zur Umsetzung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen gestärkt worden.
Indes hat die GDWS dieser Tage ihren neuen Jahresbericht für das Jahr 2018 vorgelegt. In dem rund 100 Seiten starken Rechenschafts- und Tätigkeitsbericht geht die Verwaltung ausführlich auf verschiedene Projekte und Sachverhalte ein und lässt diese durch ausgewiesene Experten beschreiben. Der Leser kann sich in dem Rapport schnell orientieren, auch deshalb, weil zum Beispiel der umfangreiche Aufgabenbereich nach Küstenzonen und dem nachgeordneten inländischen Wasserstraßennetz aufgegliedert ist. Zudem spielt das allseits beherrschende Thema „Digitalisierung“ eine wichtige Rolle. „Neue Möglichkeiten der Digitalisierung werden dabei helfen, Arbeitsabläufe noch sicherer und effektiver zu gestalten“, ist GDWS-Präsident Prof. Dr. Hans-Heinrich Witte überzeugt.
https://www.haefen-sh.de/aktuelles/bedeutung-des-nok
Copyright Haefen-sh
27.01.20
Trotz Ladungsrückgang im NOK: Bedeutung des Kanals für die Häfen und ansässige Industrie unverändert groß.
Trotz leicht sinkender Zahlen der Schiffspassagen und Ladung im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bleibt der Kanal die Lebensader für die Kanalhäfen und ansässige Industrieunternehmen in Schleswig-Holstein. Die Bedeutung des NOK geht weit über die einer reinen Transitwasserstraße hinaus. Die begonnenen Ausbaumaßnahmen sind überfällig und müssen dringend umgesetzt werden.
Der Nord-Ostsee-Kanal ist mit knapp 28.800 Schiffspassagen im Jahr 2019 weiterhin die mit großem Abstand meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Neben der bedeutenden Funktion als Transitwasserstraße zwischen Nord- und Ostsee, nimmt der Kanal eine herausragende Bedeutung sowohl für die Häfen entlang des gesamten Kanals, als auch für die ansässigen Industrieunternehmen ein, die über die Kanalhäfen versorgt werden. Ohne einen funktionierenden und erreichbaren NOK wären sowohl die Häfen als auch die Industrieunternehmen, die zahlreiche Industriearbeitsplätze sichern und Wertschöpfung in Schleswig-Holstein generieren, abgeschnitten.
Daher unterstreicht der GvSH die Notwendigkeit der begonnenen Ausbaumaßnahmen und die Dringlichkeit der unverzögerten Umsetzung und Fertigstellung. Vorrangig sind hier die Neubauten der Schleusenkammern in Brunsbüttel und Kiel, die Ostbegradigung und auch die Vertiefung des Kanals auf gesamter Länge zu nennen.
„Der vor fast 125 Jahren eröffnete Nord-Ostsee-Kanal muss entsprechend auf die Entwicklungen der Schifffahrt angepasst sowie altersbedingt instandgehalten werden, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Somit unterstützen wir das Statement von Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz, der den begonnenen Ausbau der Oststrecke und der Schleusen als überfällig einstufte“, kommentiert Frank Schnabel, Vorstandsvorsitzender des Gesamtverbandes Schleswig-Holsteinischer Häfen e.V. „Trotz eines leichten Rückgangs der Zahlen hat der Nord-Ostsee-Kanal ungebrochen eine herausragende Bedeutung für die schleswig-holsteinischen Häfen, Norddeutschland und die Schifffahrt in Nord- und Ostsee“, führt Schnabel weiter aus.
Aufgrund umweltpolitischer Aspekte ist ebenfalls die uneingeschränkte Nutzung des NOK für die Frachtschifffahrt anzustreben. Die Passage durch den NOK erspart den Schiffen den rund 460 km und 12 Stunden längeren Umweg über Skagen, wodurch Schiffstreibstoff eingespart wird und damit auch eine erhebliche Reduktion von Emissionen einhergeht.
Bedeutung des Kanals für die Häfen und ansässige Industrie unverändert groß
Copyright Nordlicht Steinburg

Bund gibt 87 Mio. € für maritimen Sektor
-
Bitte , wenn ihr mehr sehen wollt, auf m e h r druecken und dann , wenn m e h r Infos erwünscht sind auf ältere Artikel drücken , die eigentlich immer auf dem neuesten Stand sind -waren .

- https://binnenschifffahrt-online.de/2020/01/haefen-wasserstrassen/12338/neues-wsa-ems-nordsee-eroeffnet/?fbclid=IwAR3fC2RTREdHFEPEvqaNj0TeLmKGcYQ_0LBK11t5xmIt7tE_JtTCj_YjaEg
- Copyright binnenschiffahrt
Neues WSA Ems-Nordsee eröffnet

Aus den bisherigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern Meppen und Emden ist jetzt das neue WSA Ems-Nordsee hervorgegangen. Alle Informationen für Binnen- und Küstenschifffahrt kommen nun aus einer Hand.
Der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte, hat das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee heute in der Stadthalle Papenburg eröffnet. Die insgesamt 480 Beschäftigten sind jetzt für Binnen- und Küstenangelegenheiten zuständig, für die Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals, den Küstenkanal, die gesamte Ems mit der Leda und für die ostfriesische Küste einschließlich des Wattengebiets mit den Inseln Borkum bis Spiekeroog.

Im Zuständigkeitsgebiet finden jährlich mehrfach Schiffspassagen der Meyer Werft statt, die vom WSA eng begleitet werden. Besonders für das Revier ist, das Gebiet vom Emden bis zur Ansteuerungstonne Westerems wird sowohl von Deutschland als auch von den Niederlanden betreut.
»Alle Informationen kommen aus einer Hand«
Witte: »Erweiterte Verantwortlichkeiten für einen großen zusammenhängenden Verkehrsraum, das stärkt die Kompetenz in der Region. Das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee ist jetzt direkter Ansprechpartner für die Küsten- und Binnenschifffahrt. Alle Informationen kommen aus einer Hand.«
Das WSA Ems-Nordsee ist das sechste neu strukturierte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, das im Rahmen der WSV- und Ämterreform neu strukturiert wurde. Es ist an den Standorten Meppen und Emden vertreten.
Bundesweit werden 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter zu 17 neuen Ämtern zusammengeführt. Aus den beiden bisherigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern Meppen und Emden wurde jetzt das neue WSA Ems-Nordsee.
Poppen neuer Leiter
Leiter des neuen WSA Ems-Nordsee ist Hermann Poppen, der nach Stationen im Bundesverkehrsministerium und in der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) bereits sieben Jahre lang das WSA Duisburg-Meiderich leitete und seit 2019 das WSA Emden.
Poppen: »Die Beschäftigten der Ämter Meppen und Emden haben intensiv an der Struktur des neuen Amtes mitgearbeitet, so dass wir bes-tens gerüstet sind für alle anstehenden Herausforderungen. Ich freue mich sehr, dass ich als Kind der Region in einem neu strukturierten Amt in mei-ner Heimat arbeiten kann, in dem jetzt der Binnenverkehr nahtlos an den Seeverkehr angeschlossen ist.«
Die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV-Reform) ist eine der größten Verwaltungsreformen der vergangenen vier Jahrzehnte. Bereits umgesetzt wurden die Neuorganisation der wasserstraßenbezogenen Aufgaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und die Zusammenlegung der früheren sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn. Die Aufgaben und Kompetenzen im Binnen- und Küstenbereich wurden in einer zentralen Behörde zusammengefasst. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der WSV zu steigern.
In den vergangenen beiden Legislaturperioden wurden die Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Wasserstraßeninfrastruktur deutlich erhöht. Darüber hinaus wurde die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit zusätzlichem Personal für wichtige Investitionsmaßnahmen ausgestattet.

Auf dem Bauschild an der Schleuse in Brunsbüttel stand bis vor Kurzem die Angabe „Bauzeit 2014 bis 2021“. Das ist Geschichte. Nun gilt selbst 2024, die aktuelle Angabe für die Fertigstellung der fünften Schleusenkammer, als sehr ehrgeizig. Der Bund der Steuerzahler hat das Projekt als mahnendes Beispiel ins Schwarzbuch geschrieben. Immerhin handelt es sich um die größte Wasserbaustelle Europas und die Einfahrt zur weltweit meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße, dem Nord-Ostsee-Kanal.
Verantwortlich für die Verzögerung ist der Personalmangel in den Wasser- und Schifffahrtsämtern. Ihnen fehlt es an Ingenieuren, um Baufirmen mit Anweisungen für Wartung und Reparatur zu versorgen. Die Schifffahrtsämter sind so überlastet, dass sie nur langsam reagieren können, sodass Nachverhandlungen und Streitereien sich hinziehen können.
Mehr als 1000 Stellen nicht besetzt
Das ganze Ausmaß der Not legt eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion offen. Die Antwort der Bundesregierung liegt WELT exklusiv vor: Nach Auskunft des parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann im Bundesverkehrsministerium sind allein in der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), der zentralen Steuerungsbehörde des Bundes, 158 Planstellen unbesetzt. In der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) gibt es 1262 offene Stellen.

Dabei ist das Arbeitsaufkommen immens: Die WSV verwaltet Bundeswasserstraßen von 7300 Kilometer Länge und 23.000 Quadratkilometer Seewasserstraßen einschließlich aller Schleusen, Wehre und Brücken. Die sind zum Beispiel für die Energie- und Verkehrswende wichtig.
Auch die Versorgung der Industrie mit Rohstoffen könnte gefährdet sein, wenn der Sanierungssstau im Schleusen- und Kanalnetz nicht aufgelöst wird. Denn ein Binnenschiff ersetzt rund 150 Lkw, die für den Lieferverkehr auf Straßen und Autobahnen eingesetzt werden müssten. „Die WSV ist die wichtigste Behörde, wenn es um den Erhalt und Ausbau der Wasserstraßen geht“, warnt der FDP-Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther aus Nordrhein-Westfalen: „Deswegen ist es katastrophal, dass enorm viele Stellen noch immer unbesetzt sind.“
Muskelkraft ersetzt Infrastruktur
Das zeigt sich etwa an der Schleuse Dorsten am Wesel-Datteln-Kanal. Weil die Nischenpoller in der Schleusenwand marode sind, müssen Frachtschiffe von einer extra angeheuerten Truppe von zwölf bis 16 „Festmachern“ auf altertümliche Art per Hand am Seil gehalten werden. Deutschland, so zeigt sich hier, hat nicht nur ein Problem mit der digitalen Infrastruktur.
Der Wesel-Datteln-Kanal ist die Lebensader des großen Chemieparks Marl. Der lässt sich mit jährlich 2,5Millionen Tonnen rund ein Drittel seines Rohstoffbedarfs per Schiff anliefern. Gäbe die marode Schleuse Dorsten ihren Betrieb ganz auf, würde das die Produktion des gesamten Chemieclusters gefährden. „Lkw wären kein Ersatz, denn unter einer solchen Menge würden die überlasteten Straßen in NRW vollends zusammenbrechen“, sagt Alexandra Boy, Sprecherin des Standorts. „Einige Stoffe dürfen auch schlicht nicht über die Straße transportiert werden.“
Vergangene Woche hat der Haushaltsausschuss des Bundestages zwar 72 Stellen für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in Nordrhein-Westfalen genehmigt. Die FDP-Verkehrspolitiker beruhigt das jedoch kaum: Was, fragen sie, nützen neue Planstellen, wenn schon die alten nicht besetzt werden können?
Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) sieht es ähnlich und fordert eine „Einstellungsoffensive“. Denn: „Selbst mit diesen neuen Stellen ist eine Fertigstellung der Sanierungen erst bis 2038 prognostiziert.“ Jetzt, fordert VCI-Sprecher Gerd Deimel, müsse „sauber priorisiert werden, damit uns trotz der neuen Personalkapazitäten das Kanalnetz in NRW nicht zusammenbricht.“
Dieser Text ist aus der WELT AM SONNTAG. Wir liefern sie Ihnen gerne regelmäßig nach Hause.
Bund bewilligt 172 Stellen für die WSV
Im kommenden Jahr sollen 172 neue Arbeitsplätze bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) entstehen. Das hat der Verkehrshaushalt im Deutschen Bundestag jetzt beschlossen.
Es sei der größte Stellenaufwuchs seit Jahren, erklärt Mathias Stein, SPD-Berichterstatter für die WSV sowie für die Binnenschifffahrt. Die 172 bewilligten neuen Stellen betreffen Infrastrukturmaßnahmen, Betrieb und Unterhaltung, Umweltschutz, die Klimaanpassungsstrategie, Niedrigwasserforschung, das Blaue Band Deutschland, die ökologische Durchgängigkeit. Auch die Übernahme von Auszubildenden sei darin enthalten. »Jede einzelne dieser Stellen wird der WSV, den Bundeswasserstraßen, der Binnenschifffahrt und damit auch Klima und Umwelt helfen. Wie in den vergangenen Jahren musste das Parlament wieder ‚die Kohlen aus dem Feuer holen‘. Denn das Bundesverkehrsministerium hat im Regierungsentwurf keine einzige dieser Stellen untergebracht«, so Stein.
»Mindestens 400 Stellen sind nötig«
In den vergangenen Monaten habe er sich in zahlreichen Gesprächen für diese zusätzlichen Stellen bei der WSV eingesetzt. Besonders bei Betrieb und Unterhaltung, aber auch bei Umwelt- und Naturschutz, Digitalisierung, im westdeutschen Kanalnetz, bei der Abladeoptimierung Mittelrhein und weiteren Einzelmaßnahmen würden »enorme Lücken klaffen«, wie Stein sagt. »Diese Lücke schließen wir aber nur teilweise. Die WSV hätte mindestens 400 Stellen gebraucht, um ihre Aufgaben vollumfänglich zu erfüllen. Ich werde daher, gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Verbänden weiter für diese Stellen kämpfen«, kündigt der Politiker an.
»Klar ist aber: Das Parlament kann die Stellenbewirtschaftung der WSV nicht standardmäßig übernehmen. Die enorme Zahl zusätzlicher Stellen der vergangenen Jahre waren eine Art parlamentarischer Notwehr angesichts der Jahr für Jahr im Regierungsentwurf fehlenden Stellen. Das Bundesverkehrsministerium muss seiner Verantwortung für seine nachgeordnete Behörde endlich gerecht werden und die nötigen Stellen schaffen und auch zügig besetzen«, fordert Stein.
Gute Nachrichten gibt es für den Nord-Ostsee-Kanal (NOK): Nachdem Brunsbüttel 15 Jahre mit zwei großen Fähren auskommen musste, werden nun 22 Mio. € für den Bau einer dritten 100-t-Fähre bereit gestellt. Dadurch sollen künftig lange Staus und Wartezeiten für Pendler verhindert werden.
»Auf meine Initiative werden wir zudem ein Förderprogramm für die nachhaltige Modernisierung von Küstenschiffen mit einem Ansatz von zunächst 1 Mio. € auflegen. Analog zum erfolgreichen Programm für Binnenschiffe wollen wir so auch für die Küste Innovationsimpulse und finanzielle Anreize für weniger Emissionen und mehr Klimaschutz setzen«, so Stein weiter.
Mathias Stein – Sozialdemokrat im Deutschen Bundestag ist mit Bettina Hagedorn unterwegs.
Der Haushalt des Bundesverkehrsministeriums steht in diesem Jahr im Zeichen der Umwelt: Wir stocken die Investitionen in Schienen und Bahnhöfe massiv auf und geben der Deutschen Bahn eine Milliarde Euro zusätzliches Eigenkapital. Der Radverkehr bekommt nächstes Jahr allein aus dem BMVI-Etat 180 Millionen Euro und in den Jahren 2021 bis 2023 noch einmal 600 Millionen Euro obendrauf. Auf meine Initiative legt das BMVI ein Förderprogramm für saubere Schiffe an der Küste auf und gemeinsam mit den SPD-Haushältern habe ich dafür gesorgt, dass die WSV im nächsten Jahr 172 Stellen mehr bekommt. Kompliment und ein großes Dankeschön an Johannes Kahrs und Thomas Jurk!

Kommentare
-
Guenther Goettling Bettina Johannes Mathias Magnus vielen Dank NOK Notgruppe 50 Mitarbeiter 5 Ingenieure und bald noch mehr Personal vielen Dank
Copyright Binnenschifffahrt online
Der Haushaltausschuss des deutschen Bundestages hat insgesamt 87 Mio. € sowie die Schaffung von 200 Stellen für den maritimen Sektor bewilligt.
Für fünf Projekte gibt es Förderungen in Millionenhöhe. Die größten Fördersummen – jeweils 30 Mio. € – werden für digitale Testfelder in Häfen, an Wasserstraßen und Bahnstrecken sowie für LNG als Schiffskraftstoff bereitgestellt.
An den digitalen Testfeldern werden Innovationen der der Logistik 4.0, des Güterumschlags und -transports entwickelt und erprobt, während das Programm zur Aus- und Umrüstung von Seeschiffen zur Nutzung von verflüssigtem Erdgas (LNG) als Kraftstoff sehr viel Ähnlichkeit mit dem Modernisierungsprogramm für Binnen- und Küstenschiffe aufweist. Damit sollen auch hier die Schiffe umweltfreundlicher sowie Treibhaus- und Luftschadstoffemissionen gesenkt werden. Da ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wurde und eine weiterhin hohe Zahl an Anträgen erwartet wird, seien die Mittel hierfür erhöht worden, heißt es.
22 Mio. € für neue NOK-Fähre
22 Mio. € sind für den Bau einer dritten Fähre für den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) verplant. Weil nicht genügend Fähren zur Überquerung des NOK zur Verfügung stehen, wolle man den Bau einer zusätzlichen 100 t-Fähre für Brunsbüttel veranlassen und das notwendige Geld bereitstellen.
Auch den umweltfreundlichen Bordstrom behält der Bund im Blick und stellt hierfür 4,4 Mio. € bereit. Somit werden die Mittel für Investitionen in umweltfreundlichen Bordstrom- beziehungsweise in mobile Landstromanlagen erhöht. Damit könnten deutsche Häfen umweltfreundlichen Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.
Modernisierungsprogramm für Küstenschiffe
Die nachhaltige Modernisierung der Küstenschiffe lässt sich der Bund 1 Mio. € kosten. Um Schadstoff- und Lärmemissionen zu verringern, gibt es deshalb bereits ein Programm zur nachhaltigen Modernisierung von Binnenschiffen. Da man bei Küstenschiffen mit einer ähnlichen Problematik konfrontiert sei, wolle man hier ebenfalls ein Modernisierungsprogramm anschieben und Anreize schaffen.
Mehr als 200 neue Stellen für den maritimen Bereich
Auch die Stellen im maritimen Bereich wurden aufgestockt: 148 zusätzliche Stellen gibt es allein für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), unter anderem für Infrastrukturmaßnahmen an Bundeswasserstraßen, Maßnahmen am westdeutschen Kanalnetz, für die Instandsetzung und Erhaltung von Brücken und Schleusen sowie für Maßnahmen zum Umweltschutz und Digitalisierung. Hier die detaillierte Aufstellung:
- 10 der Stellen sind für das Vorhaben »Abladeoptimierung am Rhein« vorgesehen
- 10 für die Instandsetzung der Schleusen,
- weitere 5 für die Schleusenverlängerung am Neckar,
- 42 Stellen sind dem westdeutschen Kanalgebiet zugewiesen, darunter 15 für die Bauaufsicht und weitere 21 für den Wesel-Datteln-Kanal,
- weitere 12 Stellen werden für Instandsetzung und Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken, Dükern und Schleusen geschaffen,
- am Dortmund-Ems-Kanal wurden für die Fertigstellung des Stadtabschnittes Münster 8 Stellen bewilligt.
Für Betrieb und Unterhaltung an Bundeswasserstraßen werden 23 Stellen für die Übernahme befristet übernommener Azubis geschaffen. 20 Stellen wurden für Digitalisierung und Informationssicherheitsmanagement bewilligt. Die Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutz an Haupt- und Nebenwasserstraßen wird mit 29 zusätzlichen Stellen unterlegt.
»Unsere wiederholten Mahnungen, die Flüsse und Kanäle nicht länger auf Verschleiß zu fahren und endlich für eine ausreichende Personaldecke in der WSV zu sorgen, sind gehört worden«, kommentierte Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschiffahrt, die Beschlüsse. Die WSV müsse nun zusehen, dass sie die bewilligten Stellen so schnell wie möglich besetzt. »Das wird bei dem gegebenen Fachkräftemangel keine leichte Aufgabe«, so Schwanen.
Für das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kommen insgesamt 81 Stellen für Offshore-Maßnahmen hinzu. »Ich freue mich, dass wir für den maritimen Sektor auch in diesem Haushalt wieder Verbesserungen erreichen konnten«, sagt der Hamburger CDU-Abgeordnete Rüdiger Kruse, Berichterstatter für Verkehr und digitale Infrastruktur im Haushaltsausschuss.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/schiffsverkehr-und-klimawandel-die-lebensader-rhein.1001.de.html?dram:article_id=463682
Länderreport | Beitrag vom 18.11.2019
Schiffsverkehr und KlimawandelDie Lebensader Rhein schrumpft
Beitrag hören Podcast abonnieren-

- Der Rhein bei Koblenz – künftig könnte es für Schiffe schwieriger werden, ihre Ladung den Fluss entlang zu transportieren. (unsplash / Pieter van de Sande)
Der Klimawandel lässt im Rhein die Pegelstände sinken. Der Schiffsverkehr auf der wichtigen Wasserstraße ist gefährdet, darüber täuschen auch herbstliche Regenfluten nicht hinweg. Was tun – die Fahrrinne weiter vertiefen oder auf flachere Schiffe setzen?
Eine Rheinfähre erreicht nach wenigen Minuten Fahrt vom Hafen im rheinland-pfälzischen Bingen das andere Ufer im hessischen Rüdesheim. Eine wichtige Verkehrsverbindung auch für Berufspendlerinnen und Pendler, da die nächste Brücke, die Schiersteiner Brücke in Mainz, rund 25 Kilometer entfernt und oft verstopft ist. Doch der Klimawandel sorgt in den letzten Jahren dafür, dass die Fähren immer öfter stillgelegt werden müssen – wegen Niedrigwasser:
„Das hatten wir im Jahr 2018 massiv, diese Situation. Dass die Fähren den Betrieb einstellen mussten. Wir haben üblicherweise 20 Tage Niedrigwasser pro Jahr im Rhein gehabt in unserem Abschnitt. In diesem Jahr waren es 132. Mit entsprechenden Auswirkungen bis hin zum Stillstand der Schifffahrt“, sagt die hessische CDU- Landtagsabgeordnete Petra Müller-Klepper.
Der Rhein ist das prägende Element
Ich treffe sie ein paar Kilometer von Rüdesheim entfernt in ihrem Haus in den Weinbergen des Rheingaus:
„Ja, ich bin Rheingauerin, bin hier geboren und aufgewachsen und habe die große Ehre und Freude, die Region seit 2005 im hessischen Landtag zu vertreten. Und der Rhein ist unsere Lebensader. Er ist das prägende Element unserer Kulturlandschaft. Und wir waren doch alle insbesondere im Sommer 2018 sehr geschockt, als es den historisch niedrigsten Pegelstand gegeben hat. So wenig Wasser wie nie im Rhein. Was dann auch entsprechend massive, negative Auswirkungen auf die Schifffahrt hatte bis hin zum Stillstand.“
„Nächster Halt – Probsthof-Nord. Ausstieg in Fahrtrichtung links.“
 Bauingenieur Hans-Heinrich Witte ist zuständig für die Pflege der Wasserstraßen. (Deutschlandradio / Ludger Fittkau)
Bauingenieur Hans-Heinrich Witte ist zuständig für die Pflege der Wasserstraßen. (Deutschlandradio / Ludger Fittkau)
Die Straßenbahnhaltestelle Probsthof-Nord in Bonn ist ein wichtiger Ort, um herauszufinden, wie man den Auswirkungen des Klimawandels auf den Rhein technisch gegensteuern kann. Denn unweit der Haltestelle hat Professor Hans-Heinrich Witte seinen Dienstsitz.
„Ich bin Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Und damit zuständig in der Bundesrepublik Deutschland für alle unsere Bundeswasserstraßen. Im Mittelpunkt natürlich im Binnenbereich der Rhein. Das sind zirka 7.300 Kilometer Binnenwasserstraßen und dann die Zufahrten zu unseren ganzen deutschen Seehäfen, Nordsee, Ostsee. Das sind nochmal 23.000 Quadratkilometer, die noch dazu gehören.“
12.500 Mitarbeiter für die Pflege der Wasserstraßen
Professor Hans-Heinrich Witte ist gelernter Bauingenieur und Chef von rund 12.500 Mitarbeitern, die die Wasserstraßen hierzulande intakt halten sollen.
„Die aufgeteilt sind einmal hier auf unsere Direktion, hier mit dem Sitz in Bonn und unsere Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter, die in den Revieren sitzen, die Schleusen betreiben, die Ufer unterhalten und so weiter und so fort.“
An der Wand des Bonner Büros von Hans-Heinrich Witte hängt hinter einem Glasrahmen eine Deutschland-Landkarte mit den bunt hervorgehobenen Flüssen und Kanälen, die von seiner Großbehörde bewirtschaftet werden. Der Klimawandel hat für Witte und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwei Seiten. Während man sich bei den Binnengewässern langfristig auf sinkende Pegelstände einstellt, zwingt der steigende Meeresspiegel zu höheren Deichen an der Küste:
„Wir bauen ja zurzeit am Nord-Ostsee-Kanal, den ertüchtigen wir ja intensiv. Ein 2,5 Milliarden-Projekt, was wir dort an der Backe haben. Da sind unsere Schleusen. Sowohl auf der Ostsee- als auch auf der Nordsee-Seite. Das ist die erste Deichlinie. Und natürlich beim Neubau der Schleuse in Brunsbüttel berücksichtigen wir den Meeresspiegel-Anstieg und bauen die Schleusentore höher, als die letzten gebaut wurden. Das Gleiche auch an der Ostsee. Diese Auswirkungen sind da, aber der steigende Meeresspiegel beeinflusst zurzeit nicht direkt die Schifffahrt. Ganz anders als im Binnenbereich, wo uns das Wasser fehlt.“
Die Wasserqualität ist immer besser geworden
Auf der Wasserstraßen-Karte von Hans-Heinrich Witte ist der Rhein zweifarbig eingezeichnet. Der Oberrhein von Basel bis Mainz ist braun, der Mittel- und Niederrhein schwarz. Mit der Wasserqualität hat das nichts zu tun, die ist in den vergangenen Jahrzehnten immer besser geworden.
Die Farben, die den Abschnitten des Stroms zugeordnet sind, markieren die jeweils zuständigen regionalen Wasser- und Schifffahrtsämter. Die machen sich zunehmend auch über die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Rheinschifffahrt Gedanken, so Hans-Heinrich Witte:
„Wir müssen weiterdenken, ja. Abschmelzende Gletscher, die Schneeschmelze – den Rhein ja prägend in seinem Abflussregime, das ist zumindest im Think Tank etwas, wo wir drüber nachdenken müssen, was können wir denn tun? Dann geht es im Wesentlichen darum: Kann Wasserspeicher geschaffen werden, wo bei höheren Abflüssen gespeichert wird und hinterher wieder zugegeben wird? Kann man sich auch mal über den Bodensee Gedanken machen, ob der bewirtschaftet werden könnte?“
Ungewisse Zukunft als befahrbarer Wasserweg
Stauwehre am Bodensee? Das ist noch Zukunftsmusik – wie auch weitere Staustufen, um den Strom von den Niederlanden bis Basel auch in immer heißeren und trockeneren Sommern schiffbar zu halten: „Natürlich, vom Denken her ist es auch richtig zu prüfen, müssen wir den Rhein weiter stauregeln. Die unterste Staustufe im Rhein ist Iffezheim.“
Iffezheim liegt rund 30 Kilometer südlich von Karlsruhe. Rund 45.000 Schiffe überwinden jährlich mit zirka 25 Millionen Tonnen Fracht diese Staustufe, hinter der es stromabwärts bis jetzt keine weitere gibt – bis zum Mündung in die Nordsee. Würde unterhalb von Iffezheim jedoch auf Dauer zu wenig Wasser aus den Alpen ankommen, müsste irgendwann stromabwärts doch die nächste Staustufe gebaut werden, um den Strom befahrbar zu halten.
„Wir tun alles dafür, Sedimentmanagement im Rhein, damit dies nicht passiert. Ja, denken muss man es. Das ist aber keine Lösung für Morgen oder Übermorgen“, sagt Professor Witte.
In diesem Herbst ist der Pegelstand des nahegelegenen Rheins nach ausgiebigem Regen unbedenklich – der Schiffsverkehr läuft gut. Doch ein trockener Winter könnte das schnell wieder ändern.
Bei Niedrigwasser wird der Rhein zu warm
Noch näher am Rheinufer als die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt liegt ein Büro des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland – kurz BUND. Doch nicht in Bonn, sondern stromaufwärts am anderen Ende des Mittelrheingebietes – am Hindenburgplatz in Mainz. Dort treffe ich Sabine Yacoub, die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Umweltorganisation. Sie macht sich seit langem Sorgen darüber, dass der Rhein insbesondere bei Niedrigwasser zu warm wird. Mit enormen Auswirkungen auf die Wanderfische im Strom:
„Wir haben gerade die Langstreckenwanderer wie den Lachs und die Forelle, die eben ab Wassertemperaturen über 20 Grad anfangen, sich nicht mehr sehr wohl zu fühlen und zum Teil dann einfach nicht mehr weiterwandern. Das heißt, die kommen dann entweder nicht mehr oder nicht mehr rechtzeitig in ihre Laichgebiete. Und so sind eben auch Fischbestände bedroht.“
Ökologische Bedenken
Mehr Staustufen im Rhein, wie sie von der Wasserstraßenverwaltung des Bundes zumindest für die Zukunft diskutiert werden, sähe Sabine Yacoub nicht gerne. Sie verweist auf die Mosel, die heute schon eine „Aneinanderreihung von Stehgewässern“ sei:
„Das ist aus ökologischer Sicht wirklich schlecht. Und gerade bei der Mosel haben wir auch immer wieder das Problem mit Algenblüten im Sommer, die eben weder für das Gewässer, noch für den Menschen, wenn er denn baden gehen will, gut sind. Und wir haben tatsächlich noch so Problematiken, wenn es ganz extrem wird, dass wir in so Staubereichen sogar so etwas wie Methanbildung haben. Was dann eben wieder eine Wirkung ist, die dem Klimaschutz entgegenwirkt.“
Der BUND ist auch Mitglied der internationalen Rheinschutz-Kommission, in der sich länderübergreifend Behörden und Verbände auch um die ökologische Situation des Stroms und seiner Zuflüsse kümmern. Sabine Yacoub plädiert dafür, zunächst die Schiffe an die immer wahrscheinlicher werdenden niedrigen Pegelstände anzupassen, bevor man die Fahrrinne des Stroms ausbaggert oder neue Stauwehre baut:
„Und was natürlich ein grundsätzliches Problem bei uns ist, was auch schwierig anzugehen ist: Wir transportieren einfach viel zu viel Zeug.“
Den Rhein auf der einen Seite vertiefen
Noch einmal rheinaufwärts – nach Bonn. Dort, wo nun die letzten Vorbereitungen laufen, damit die Schiffe trotz tendenziell sinkender Pegelstände am Mittelrhein auch künftig in der Fahrrinne noch genug Wasser unterm Kiel haben. Hans-Heinrich Witte, der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, erklärt wie dies mit technischen Mitteln bewerkstelligt werden soll:
„Vom Ziel her: Wir versuchen den Wasserabfluss in der Schifffahrtsrinne zu konzentrieren. Das heißt auf der einen Seite die Rinne, wo erforderlich, wo Felsspitzen sind, etwas zu vertiefen.“
Anderseits sollen neue, kleine Strömungshindernisse im Uferbereich den Abfluss des dortigen Wassers verlangsamen. Eine Maßnahme, die die hessische CDU-Landtagsabgeordnete Petra Müller-Klepper und ihre Landtagskolleginnen und Kollegen von Grünen und FDP ausdrücklich begrüßen und gerne schneller als bisher geplant 2030 realisiert sehen möchten: „Wir sagen, die Maßnahme ist sinnvoll, ökologisch und ökonomisch“, sagt Müller-Klepper.
Skepsis beim BUND
Die rheinland-pfälzische BUND-Vorsitzende Sabine Yacoub ist auch bei dieser Maßnahme skeptischer: „Auch wenn man sich natürlich bemüht, es behutsam zu machen, sind es natürlich schon immer große Eingriffe. Man weiß dann auch nicht, wie lange sie halten. Denn im Augenblick kann, glaube ich, keiner abschätzen, wie das mit dem Rhein überhaupt so weitergeht.“
Am Fähranleger Rüdesheim hofft man jetzt erst einmal auf einen feuchten Winter- vor allem in den Alpen. Viel Schnee hilft auch dem Mittelrhein und seinen Anwohnern. Doch die Menschen, die hier am Strom leben, ahnen: Das nächste Dauerniedrigwasser kommt bestimmt. Der Klimawandel wird den Schiffsverkehr immer öfter beeinträchtigen.
Mehr zum The
Copyright Deutschlandfunk
NOK keine Stellen nur Binnenschiffahrt geht gar nicht , bin mit 3 MdB’s dran nein NOK muss Stellen haben 50 + 5
100 zusätzliche Stellen ab 2020
Ab 2020 können die zuständigen Ämter insgesamt 100 zusätzliche Stellen aufbauen. Sowohl die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung als auch die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz und die Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe bekommen dann Verstärkung. Sie sollen den Erhalt und den Ausbau der Wasserstraßen vorantreiben.
Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt, Jens Schwanen, erklärte, dadurch könne auch der Ausbau und die Sanierung von Schleusen in Angriff genommen werden.
Laut aktueller Planung soll der Ausbau der Moselschleusen 2036 abgeschlossen sein.
Über dieses Thema wurde auch in den SR-Hörfunknachrichten am 17.11.2019 berichtet.
https://www.boyens-medien.de/artikel/dithmarschen/bund-bewilligt-22-millionen-euro-fuer-neue-faehre-306199.html

Darauf hat die Schleusenstadt lange gewartet: Brunsbüttel bekommt wieder eine dritte 100-Tonnen-Kanalfähre. Wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich mitteilt, will der Haushaltsausschuss des Bundes 22 Millionen Euro für deren Bau locker machen. Das sei am Donnerstagabend in Berlin entschieden worden. Die Pressestelle des Bundestages hat das gestern bestätigt.
Die Fähre soll nach Angaben Helfrichs über einen Hybrid-Antrieb verfügen und mit Landstrom betrieben werden. „Auf die Autofähren sind nicht nur die Brunsbütteler angewiesen, die mit dem Auto, dem Fahrrad oder als Fußgänger übersetzen wollen, sondern sie sind auch für die Logistikwirtschaft von großer Bedeutung“, so der Bundestagsabgeordnete. Umso wichtiger sei es, eine dritte große Fähre als Ersatz bereitzuhalten, die den kurzzeitigen Ausfall einer Fähre kompensieren könne. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn begrüßt die Nachricht: „Genauso wie die Menschen vor Ort erwarte ich, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung jetzt mit Hochdruck loslegt, um die Ausschreibung und den Bau der neuen Fähre zügig voran zu treiben.“ Bis 2004 waren innerstädtisch drei große 100-Tonnen-Fähren in Brunsbüttel im Einsatz, zwei an der Fährstelle Brunsbüttel sowie eine an der benachbarten Fährstelle Ostermoor. Nach einer schweren Havarie wurde die große Fähre Königsberg aus dem Verkehr gezogen und die Fähre in Ostermoor durch eine 45-Tonnen-Fähre ersetzt. Die zwei aktuell pendelnden 100-Tonnen-Fährschiffe stehen im Eigentum des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) und haben bereits einige Jahrzehnte auf dem Buckel: Sie sind seit Mitte der 1960er- und 1970er-Jahre auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Einsatz und haben häufig technische Probleme.
Wenn eine der beiden großen Fähren ausfällt und bestenfalls durch eine kleine ersetzt wird, müssen Autofahrer eine Menge Geduld beweisen, wenn sie per Schiff übersetzen wollen. Vor allem zu Stoßzeiten, wie etwa bei Schichtwechsel in den großen Industriebetrieben, bilden sich lange Staus vor der Fährstelle. Immer wieder hatten die Stadtpolitiker versucht, Druck zu machen, damit der Bund eine große Ersatzfähre anschafft. Lange Zeit vergeblich. Umso größer der Jubel in der Schleusenstadt, dass sich endlich etwas tut. „Ich freue mich sehr über die überaus positive Ankündigung aus Berlin“, sagt Bürgermeister Martin Schmedtje. Seit der Havarie vor 15 Jahren habe die Stadt immer wieder eindringlich „auf den vorhandenen Bedarf aufmerksam gemacht“ und den Bau einer dritten 100-Tonnen-Fähre gefordert. „Ich gehe davon aus, dass es künftig wieder dauerhaft drei große Fähren in Brunsbüttel geben wird und die vorhandenen Schiffe perspektivisch durch Neubauten ersetzt werden“, so der Verwaltungschef.
Laut Helfrich bekommt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Brunsbüttel außerdem ein neues Verwaltungsgebäude für knapp 25 Millionen Euro. Bisher sind die 200 Mitarbeiter auf mehrere Standorte verteilt.
Kasten: Kostenfreie Querung
Der Bund ist rechtlich verpflichtet, eine kostenfreie Querung des Nord-Ostsee-Kanals zu ermöglichen. Im Regelbetrieb sind 14 Fähren an zwölf Fährstellen im Einsatz. Nur in Brunsbüttel pendeln zwei große 100-Tonnen-Fährschiffe, die anderen haben eine Tragfähigkeit von 45 Tonnen. Die ältesten Fähren wurden 1952 gebaut, die jüngsten 1972. Pro Jahr pendeln nach Angaben der Schifffahrtsverwaltung landesweit 5,4 Millionen Menschen per Fähre über den Kanal. Zugleich werden 3,7 Millionen Autos und fast 180 000 LKW per Schiff über die künstliche Wasserstraße transportiert.
Die Zukunft der EU liegt auf dem Wasser
- Stand: 18.10.2019
- Lesedauer: 8 Minuten

Der Rhein – hier der Rheinhafen Krefeld – soll eine verlässliche Option für den Gütertransport bleiben. Doch Hitzewellen wirken sich negativ auf die Wasserstände aus
Quelle: picture alliance / blickwinkel/S
Die EU setzt aus Klimaschutzgründen auf die Binnenschifffahrt. Doch die Infrastruktur ist marode. Brücken sind zu niedrig, Fahrrinnen nicht tief genug. Milliarden sind nötig, um die Wassernetze zu modernisieren. Eine Entwicklung verschärft die Lage zusätzlich.
http://www.giessener-zeitung.de/giessen/beitrag/130929/weitere-hochbruecken-ueber-den-nord-ostsee-kanal/
copyright giessener zeitung

http://zeitung.shz.de/norddeutscherundschau/2205/article/981388/30/3/render/?token=4ae7a33a7de30a14ff48c9dcd7fc1ac4&fbclid=IwAR0a3bzfQOypgL48jUF0X-Ap0SUJ9wwJucwB9OHuzH0sCvrF25YhlBTW928
Copyright Norddeutsche Rundschau
Nord-Ostsee-Kanal feiert 125. – Brunsbüttel lädt zu Meilentagen ein
Brunsbüttel 2020 steht der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt ein besonderes Jubiläum bevor. Zum 125. Mal jährt die Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals. In Brunsbüttel soll dieses historische Ereignis vom 12. bis 14. Juni mit den Brunsbütteler Meilentagen gefeiert werden.
Das Planungsteam aus dem Rathaus ist dabei, ein vielfältiges Programm und gastronomisches Angebot auf beiden Kanalseiten auf die Beine zu stellen. Auskünfte über Schiffe, die einladen werden, möchte Bürgermeister Martin Schmedtje derzeit ebenso wenig preisgeben wie Künstler, die das Bühnenprogramm gestalten. „Zu gegebener Zeit, wenn alles in trockenen Tüchern ist, werden wir detailliert informieren“, kündigt Schmedtje an.
Als überaus „charmant“ bezeichnet Andreas Schmidt vom NDR das Konzept. Überzeugt habe ihn vor allem die Kombination aus hochkarätiger Unterhaltung, in Verbindung mit den informativ gestalteten Veranstaltungsflächen, die von Vereinen, Verbänden, Gastronomen sowie Gewerbetreibenden und Industrieunternehmen aus der Region mit Leben gefüllt werden. „Dieses Fest verfügt über eine Strahlkraft, die weit über die Stadtgrenze hinausragt“, ist sich Schmidt sicher. erb
Copyright THB
Diesen Rat erteilte Peter Harry Carstensen, ehemaliger langjähriger (2005 bis 2012) Ministerpräsident (CDU) für das Bundesland Schleswig-Holstein, jetzt beim Festakt anlässlich der Wiederkehr des 150. Gründungstages des Nautischen Vereins zu Kiel in der Landeshauptstadt. Carstensen gehörte zum Kreis der verschiedenen Gastredner und Ehrengäste bei diesem Festakt. Weiter stellte er fest: „Es wird aber nicht jeder Kapitän bei „Aida“, so wie es auf dem einen Werbebild zu sehen ist. Das Berufsbild muss auch bei der Werbung der Realität entsprechen.“ Der gebürtige Nordfriese mahnte zudem an, dass die maritime Branche mehr Frauen fördern müsse. „Unter den 963 Kapitänen in Deutschland sind nur 13 Frauen. Das ist nicht gerade viel.“

Hans-Hermann Lückert, Vorsitzender des NV Kiel, ging in seiner Rede auf die wichtigen Stationen seit Gründung vor 150 Jahren ein. Dieser Einrichtung gehörten heute praktisch alle wichtigen maritimen Institutionen und Behörden Kiels sowie rund 170 Einzelpersonen an. Lückert freute sich auch darüber, dass eines der Ur-Mitglieder und zugleich Mitbegründer, die heutige Firma Sartori & Berger, den NV Kiel weiter aktiv begleite und nach Kräften unterstütze. Zum Festakt waren auch zahlreiche Vertreter anderer NV in Kiel erschienen. EHA/FB
https://www.cnv-medien.de/news/traditionswerft-in-neuenfelde-schafft-neue-arbeitsplaetze.html
Copyright CNV Medien
Pella Sietas-Chefin Natallia Dean und Projektleiter Alexander Fidler stehen auf dem Vorderschiff des Laderaumsaugbaggers. Durch die großen Rohre gelangt das Baggergut – ein Sediment-Wasser-Gemisch – in den riesigen Bauch
Traditionswerft in Neuenfelde schafft neue Arbeitsplätze
NEUENFELDE. „Wir wachsen weiter“, freut sich Pella Sietas-Chefin Natallia Dean. Ihr Plan: Ende 2020 sollen 400 Schiffbauer auf der Traditionswerft arbeiten – vom Ingenieur bis zum Schweißer.
Weitere Aufträge sind in der Pipeline. Und beim Laderaumsaugbagger für den Bund hat der Innenausbau begonnen.
Auf der Bauplattform P1 der Pella Sietas-Werft an der Este-Mündung in Neuenfelde herrscht Hochbetrieb. Das Schiff versteckt sich an vielen Stellen noch hinter Planen – für die Lackierung. Nicht nur im Deckshaus hat der Innenausbau begonnen, auf der Kommando-Brücke wird Hightech installiert – Schiff und Baggertechnik werden über Touchscreens gesteuert. 200 Kilometer Kabel werden verbaut, rechnet Projektleiter Alexander Fidler vor. Der 100 Millionen Euro teure Laderaumsaugbagger für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ist ein Gigant aus Stahl, rund 3600 Tonnen wurden verbaut. Aus 14 Blöcken, bis zu 400 Tonnen schwer, haben die Werftarbeiter das Schiff zusammengesetzt. „Wir haben das große Glück, dass wir unseren ‚Jucho‘ haben, kein anderer Kran im Norden kann so viel tragen“, sagt Dean. Rund 100 der aktuell 350 Pella Sietas-Mitarbeiter arbeiten auf dem Saugbagger.
Dieser wird mit seinem Saugkopf – wie ein riesiger Unterwasserstaubsauger – im Zuge der Unterhaltungsbaggerung in der Fahrrinne den Sand und Schlick aus einer Tiefe von zehn bis 25 Metern aus der Elbe holen. Rund 7500 Kubikmeter passen in den Bauch des Hopperbaggers, verteilt auf zwei Laderäume. Zum Vergleich: Damit verfügt der Neubau über 1000 Tonnen mehr Ladevolumen als der Bagger „Nordsee“ des Wasser- und Schifffahrtsamts Hamburg – seit 1978 im Einsatz. „In rund einer Stunde“, so Alexander Fidler, ist der neue Saugbagger voll beladen, das Sediment-Wasser-Gemisch rauscht in Riesenrohren (Durchmesser: ein Meter) in die beiden Laderäume. Das Nassbaggergut wird später über acht Bodenventile verklappt. Zwei um 360 Grad drehbare Propeller sorgen für eine top Manövrierfähigkeit des 4500-Tonnen schweren Unterwassersaugers.
Wegen der geringen Wassertiefe an der Este wird der 132 Meter lange und 23 Meter breite Neubau samt Dock im November/ Dezember 2019 zur Endausrüstung die Werft in Neuenfelde mit Schlepperhilfe verlassen müssen – und zum Ausdocken aller Voraussicht nach in den Hamburger Hafen verholt. Im Laufe des ersten Halbjahres 2020 wird das hochkomplexe Schiff an den Bund übergeben, so Dean. Erste Rechnersimulationen laufen bereits zur Vorbereitung.
Das Dock, extra mit zwei Türmen zusätzlich stabilisiert, kommt zügig wieder zurück nach Neuenfelde. Denn die im Jahr 1635 gegründete und 2014 von Pella Shipyard aus St. Petersburg (Russland) übernommene Werft arbeitet parallel an mehreren Neubauten.
Weitere Aufträge sind in der Pipeline. Deshalb soll die Belegschaft bis Ende 2020 um rund 50 auf 400 aufgestockt werden. „Wir wachsen weiter“, betont Pella Sietas-Chefin Dean. Sie sucht Konstrukteure, Ingenieure und Schiffbauer sowie Schlosser, Rohrschlosser und Schweißer. Außerdem starte die Werft eine Ausbildungsoffensive. Ende 2020 wird ein Ausbildungszentrum eröffnet, jährlich sollen mehr als zehn Azubis, Schwerpunkt im gewerblichen Bereich, eingestellt werden.
Von Björn Vasel
https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/industrie-schlaegt-alarm-bei-nrw-wasserstrassen_aid-45569677
Coyright aachener -zeitung
soviel zu Personalbbau
Düsseldorf Schifffahrtskanäle aus Kriegszeiten, verrostete Tore und Poller: Die NRW-Industrie schlägt Alarm. Wenn Schleusen wochenlang gesperrt werden müssen, kann das teuer werden – für Häfen und Verbraucher.
Marode Kanäle, Poller und Schleusen, Personalmangel in den Schifffahrtsverwaltungen: Die NRW-Industrie fordert mit ungewöhnlich scharfen Tönen mehr Tempo beim Ausbau der Wasserstraßen im Land. Der „gegenwärtige Verfall“ bringe ein „nicht mehr kalkulierbares Risiko für den Industriestandort NRW“, erklärte der Sprecher des Verbandes der Chemischen Industrie, Gerd Deimel, am Dienstag. Die Branche ist für ihre Grundstoffe etwa im Chemiepark Marl im nördlichen Ruhrgebiet besonders auf Schiffstransporte angewiesen. An diesem Mittwoch (4.9.) ist die Modernisierung der NRW-Wasserwege auch Thema einer Anhörung im Landtag.
NRW ist ein Schifffahrtsland: Fast 30 Prozent der Gütertransporte laufen vergleichsweise umweltfreundlich über das Wasser. Bundesweit sind es nur rund acht Prozent. Aber an vielen Wasserwegen ist seit Kriegszeiten kaum etwas erneuert worden. Etwa 45 Prozent der Schleusenanlagen sind nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung älter als 80 Jahre.
Wenn Tore rosten, Pumpen den Geist aufgeben und Schleusen gesperrt werden müssen wie in diesem Sommer die wichtige Schleuse Henrichenburg in Waltrop, drohen handfeste wirtschaftliche Nachteile: Der Kanalhafen Dortmund war wegen der Sperrung im Sommer für sechs Wochen vom Schiffsverkehr abgeschnitten. Seitdem läuft voraussichtlich bis zum 18. September ein Notbetrieb in Abend- und Nachtstunden. Das tut auch ökologisch weh: „Ein kanalgängiges Binnenschiff ersetzt rund 50 Lkw“, sagt der Dortmunder Hafenvorstand Uwe Büscher.
An den sechs Schleusen des 60 Kilometer langen Wesel-Datteln-Kanales halten die brüchigen alten Nischenpoller das Gewicht moderner Güterschiffe nicht mehr aus. Als Notmaßnahme helfen deshalb „Festmacher“ wie einst händisch den Schiffen beim Anlegen – ein technischer Rücksturz als würden Telefonverbindungen wieder von Hand gesteckt. Dabei nutzen jedes Jahr rund 20.000 Güterschiffe den Kanal.
CDU/FDP und SPD sind sich mit ihren Anträgen zum Thema weitgehend einig mit der Industrie, den IHKs und Hafenbetreibern im Land. Pläne und Versprechungen gibt es ja nach jahrelangen Debatten reichlich. Der Ausbau des Wesel-Dattel-Kanals für rund 645 Millionen Euro ist etwa seit 2016 als vordringliches Projekt im Bundesverkehrswegeplan verankert. Doch bisher wurde nicht mal mit den Planungen begonnen, klagen CDU und FDP in ihrem Antrag.
Ein zentraler Engpass sind fehlende Stellen bei der Bundesverwaltung der Wasserstraßen. Allein für den Ausbau des Wesel-Datteln-Kanales fehlten bei den zuständigen Bundesbehörden 42 Stellen, sagt der VCI. Sonst drohten jahrelange Verzögerungen – auch wenn das nötige Geld zum Bauen bewilligt ist. Notfalls sollen die raren Fachleute eben aus anderen Bundesländern abgeordnet werden, fordert der VCI.
Mit dem Haushalt 2018 wurden bereits 15 neue Ingenieurstellen für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in NRW genehmigt. Doch sie müssen jetzt auch schnell besetzt werden, fordert die Politik. Für den Bundeshaushalt 2020 und mögliche weitere NRW-Jobs beginnen die Verhandlungen demnächst.
https://www.kn-online.de/Lokales/Nord-Ostsee-Kanal/Bauarbeiten-fuer-neue-Levensauer-Hochbruecke-starten-2020

Im kommenden Jahr sind vorbereitende Bauarbeiten geplant. 2021 soll mit den Fundamenten begonnen werden, zwei Jahre später mit dem Stahlbau. Läuft alles nach Plan, könnten 2025 Züge und Autos die neue Brücke befahren.
Im Etatentwurf des Bundeshaushalts für 2020 sind für den Neubau der Querung 68 Millionen Euro vorgesehen. 2008 war ursprünglich von 47 Millionen Euro die Rede, allerdings für einen Standardbau, wie die stellvertretende Projektleiter Malte Seppmann sagte. Die Stahlkonstruktion mit einem Bogen erinnert optisch an das noch existierende Bauwerk. Zudem wird dort eine der Engstellen des Kanals beseitigt. Die Wasserstraße wird von 101 auf 117 Meter verbreitert, die sogenannte Sohlbreite von aktuell 45 auf 75 Meter erhöht
Klingen gibt Wasserstraßen-Abteilung im BMVI ab
Reinhard Klingen, bislang Leiter der Abteilung »Wasserstraßen und Schifffahrt« im Bundesverkehrsministerium (BMVI), leitet künftig die Zentralabteilung. Seinen Posten übernimmt Norbert Salomon.
Salomon war bisher Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesverkehrsministerium mit der Zuständigkeit für die Nationale Plattform »Zukunft der Mobilität«. Er ist erst seit Beginn dieser Wahlperiode im Verkehrsministerium tätig, zuvor leitete er die Unterabteilung »Immissionsschutz, Anlagensicherheit und Verkehr« im Bundesumweltministerium.
Klingens berufliche Anfänge gehen auf die Mitte der 1980er-Jahre zurück, als er Dezernent bei der WSD Nord-West in Aurich war. In leitender Funktion hat er fast 20 Jahre lang die Geschicke der Branche begleitet und gestaltet: Von 2000 bis 2005 war er Leiter des Referates »Personalangelegenheiten« in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), von 2005 bis 2009 führte er die Unterabteilung »Wasserstraßen« im Ministerium. 2009 wurde er schließlich Nachfolger von Bernd Törkel als Leiter der Abteilung »Wasserstraßen- und Schifffahrt«.
»Für das Schifffahrtsgewerbe bedeutet diese Personalentscheidung eine Zäsur«, sagt Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB).
Nachfolger Salomons und neuer Leiter der Grundsatzabteilung wird Klaus Bonhoff, früherer Manager bei Daimler und bislang Geschäftsführer bei NOW (Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie). Er gilt als Wunschkandidaten von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der etliche Positionen in seinem Haus inzwischen neu besetzt hat.
Die Personalentscheidungen müssen noch vom Bundeskabinett bestätigt werden. Hingegen ist im Bundesverkehrsministerium die Position des Leiters der Unterabteilung WS 1 (Wasserstraßen) nach wie vor vakant, nachdem Hartmut Spickermann Ende Mai 2019 in den Ruhestand getreten war.
https://binnenschifffahrt-online.de/2019/07/featured/7832/wsv-und-25rijkswaterstaat-kooperieren-bei-wasserbauprojekten/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=25-07-2019+Binnenschifffahrt+News+der+Woche+26.07.2019&utm_content=Mailing_11484543
Copyright Binnenschiffahrt online magazin
Die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung (WSV) und Rijkswaterstaat, ihr Pendant in den Niederlanden, haben eine Zusammenarbeit bei Projekten im Wasserbau beschlossen. Ziel ist eine Beschleunigung der Prozesse.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels der Bevölkerung und eines dadurch entstehenden Ingenieurmangels wollen beide Länder bei der Realisierung von Unterhaltungs- und Neubauaufgaben langfristig kooperieren.
Konkret geht es darum, »dringend erforderliche Verkehrsinfrastrukturprojekte an den deutschen und niederländischen Wasserstraßen mit den jeweiligen Erfahrungen und Spezialkenntnissen zu befördern und zu beschleunigen«, teilten die Partner bei der Vertragsunterzeichnung in Duisburg mit.
Wasserbauprojekte schneller umsetzen
»Wir wollen Tempo machen bei der Umsetzung der anstehenden Wasserbauprojekte in Deutschland und den Niederlanden. Deshalb bringen wir unser know how zusammen«, so Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS).
Rijkswaterstaat habe jahrelange Erfahrungen bei Verträgen, die Planen und Bauen verbinden würden und man selbst verfüge über umfassende Kenntnisse bei standardisierten Bauweisen. »Davon wollen wir gegenseitig profitieren«, bekräftigt Witte.
Die GDWS möchte Pilotprojekte starten, bei denene Planen und Bauen in einer Hand liegt. Rijkswaterstaat werde ein Unterstützungsteam bereitstellen, das die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter bei der Vertragsgestaltung und Abwicklung ausgewählter Pilotprojekte unterstütze, heißt es.
Im Gegenzug stellt die GDWS Berater, die Rijkswaterstaat bei Technik und Standardverfahren beraten. Darüber hinaus richten die Kooperationspartner einen Lenkungsausschuss ein und stellen ein Austauschprogramm auf.
Wie die GDWS und Rijkswaterstaat weiter mitteilen, beabsichtigen sie die nun vereinbarte Kooperation weiter auszuarbeiten, um langfristig zusammen zu arbeiten. Gemeinsames Ziel sei es, die Leistungsfähigkeit der deutschen und niederländischen Binnenwasserstraßen zu stärken und mögliche Einschränkungen für die Schifffahrt zu vermeiden.
http://zeitung.shz.de/glueckstaedterfortuna/1618/article/935948/1/1/render/?token=794a2f31926fb97c279b8ecbe8f1bc37&fbclid=IwAR20-AmbcBLA6bRlMaGxpMTPRcSzbtP-x6XPEMZGGPBUWUVJG-T63MiYFDg
Copyright Norddeutsche Rundschau
Glückstadt Im Glückstädter Außenhafen könnten gerne mehr Güter umgeschlagen werden als zurzeit, sagt Frank Schnabel, Geschäftsführer der Schramm-Group.

Drei Wirtschaftsminister kommen am 21. August in das Glückstädter Rathaus. Gefeiert wird die Kooperation der Häfen an der Unterelbe: Hamburg, Brunsbüttel, Cuxhaven, Stade und Glückstadt. Zehn Jahre Elbe–Sea–Ports heißt es an dem Tag. Stolz darauf ist Frank Schnabel, Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports GmbH und Schrammgroup. Denn er hatte die Kooperation initiiert.
Elbe–Sea–Ports wurde in Glückstadt von den damaligen Wirtschaftsministern Philipp Rösler aus Niedersachsen und Jörn Biel (Schleswig–Holstein) sowie Hamburgs Wirtschaftssenator Axel Gedaschko gegründet. Deshalb findet die Feier in der Elbestadt statt. Diesmal kommen aus Schleswig–Holstein Bernd Buchholz, aus Niedersachsen Bernd Althusmann und aus Hamburg Michael Westhagemann. Schnabel erinnert sich an die Anfänge: „Es war damals nicht banal, mit Hamburg zu kooperieren.“ Doch es habe sich ausgezahlt: „Wir haben auf Augenhöhe die gesamte Region vorangebracht – von Hamburg bis Brunsbüttel.“
Der Hafenchef verkündete dies bei einem Besuch in Glückstadt zu einem weiteren wichtigen Anlass. Denn die Schrammgroup betreibt seit 25 Jahren den Außenhafenbetrieb Glückstadt. Ein Jubiläum, zu dem die Industrie- und Handelskammer (IHK) vor Ort gratulierte. Umgeschlagen werden in Glückstadt unter anderem Güter wie Dünger, Baustoffe, Kalk, Zellulose und Kreide.
Frank Schnabel wünscht sich mehr Menge, die umgeschlagen wird. „Der Hafen müsste belebter werden. Wir müssen wieder mehr Kunden gewinnen.“ Während Glückstadt zurzeit nur rund 70.000 Tonnen umschlägt, so sind es im Gesamtunternehmen gleich 17,5 Millionen Tonnen jährlich. Das will Frank Schnabel dann so auch gar nicht vergleichen, ihm liegt der Glückstädter Hafen aber am Herzen. Und er weiß: Es können nicht alle Schiffe reinfahren. Denn der Tiefgang im Hafenbecken beträgt nur fünf Meter, in Brunsbüttel sind es zum Vergleich 15 Meter. „Wichtig ist, dass der Hafen erhalten bleibt.“
Denn in anderen Städten erlebt er den Trend, dass teure Wohnbebauung einem Hafenbetrieb vorgezogen wird. Und so viele gewerbliche Häfen würde es nicht mehr geben, zählt er Kiel, Husum, Büsum und Glückstadt auf. „Wir müssen zeigen, dass dieser Hafen eine Bedeutung hat. Und keiner muss sich sorgen machen. In Glückstadt wird kostendeckend gearbeitet.“ Zuständig sei zurzeit Jürgen Lohmann, der auch den Rendsburger Hafen betreut.
Zum Jubiläum gratulierte Peter Ahrendt von der IHK „Klein aber oho – ein interessanter Hafen“, sagte er über Glückstadt Ports und lobte dann: „Ein leistungsstarkes Unternehmen steht dahinter.“
https://www.rtl.de/cms/neues-wasserstrassen-und-schifffahrtsamt-gestartet-4355050.html
https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/neues-wasserstrassen-und-schifffahrtsamt-mosel-saar-lahn-gestartet-2415302.html
Copyright binnenschifffahrt
https://binnenschifffahrt-online.de/2019/06/featured/7350/neues-wasserstrassen-und-schifffahrtsamt-fuer-mosel-saar-und-lahn/
Neues Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt für Mosel, Saar und Lahn

Michael Güntner, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium hat heute mit Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, das neue Amt »Mosel-Saar-Lahn« eingerichtet.
Das WSA Mosel-Saar-Lahn ist das vierte neu strukturierte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, das im Rahmen der WSV- und Ämterreform jetzt an den Start geht. Bundesweit werden 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter zu 17 neuen Ämtern zusammengeführt. Aus den drei bisherigen Ämtern Koblenz, Trier und Saarbrücken wurde jetzt das WSA Mosel-Saar-Lahn.
Die insgesamt rund 800 Beschäftigten sind nun für über 480 km Wasserstraßen in drei Bundesländern – Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen – zuständig. Dazu zählen Besonderheiten wie die deutsch-französische Grenzstrecke an der Saar, das deutsch-luxemburgische Kondominium an der Mosel und landschaftliche Attraktivitäten wie das Deutsche Eck und die Saarschleife.

Albert Schöpflin (Leiter des WSA MSL), Michael Güntner (BMVI). © WSV
Güntner: »Das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn ist auf einen großen und zusammenhängenden Verkehrsraum zugeschnitten und direkter Ansprechpartner für die länderübergreifende Schifffahrt. Das stärkt die Kompetenz in einer Region, in der Güterverkehr, Wassersport und Naherholung von großer Bedeutung sind. Straffere Strukturen und erweiterte Gestaltungsräume ermöglichen ein flexibles und effektives Agieren.«
»Starke Ämter, erweiterte Verantwortlichkeiten für größere Verkehrsräume – das sind die richtigen Schritte in die Zukunft. Die Beschäftigten der drei Ämter haben jeden Schritt hin zu dem neuen Amt ausgesprochen motiviert und aktiv mitgestaltet und sehr gute Lösungen gefunden«, sagte GDWS-Chef Witte.
Schöpflin neuer Amtsleiter
Leiter des neuen WSA Mosel-Saar-Lahn ist Albert Schöpflin, der zuvor bereits 17 Jahre lang das WSA Saarbrücken leitete und seit über fünf Jahren auch das WSA Trier.
Albert Schöpflin: »Ich bin mir der Bedeutung und Ehre bewusst, das WSA Mosel-Saar-Lahn mit den traditionsreichen Standorten Koblenz, Trier und Saarbrücken und drei Flüssen zu leiten – die Mosel mit der höchsten Wasserstraßenklasse A, die länderübergreifende Saar und die touristisch geprägte Lahn mit ihrem hohen ökologischen Potential. Die Bündelung der Aufgaben und Kompetenzen in einem Amt ist der logische Schritt, um die vielfältigen Aufgaben effizient und kundennah zu erledigen.«
Die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV-Reform) ist eine der größten Verwaltungsreformen der vergangenen vier Jahrzehnte. Bereits umgesetzt wurden die Neuorganisation der wasserstraßenbezogenen Aufgaben des BMVI und die Zusammenlegung der früheren sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn. Im Rahmen der laufenden Ämter-Neuorganisation werden 39 Ämter zu 17 Ämtern zusammengefasst.
Der Neustrukturierung der Ämter ging die Zusammenlegung von sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt voraus. Die Aufgaben und Kompetenzen im Binnen- und Küstenbereich wurden in einer zentralen Behörde zusammengefasst. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der WSV nachhaltig zu steigern.
In den vergangenen beiden Legislaturperioden wurden die Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Wasserstraßeninfrastruktur deutlich erhöht. Darüber hinaus wurde die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit zusätzlichem Personal für wichtige Investitionsmaßnahmen ausgestattet.
Das macht die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
https://binnenschifffahrt-online.de/2019/05/allgemein/7189/bund-verspricht-2-mrd-e-fuer-die-wasserstrassen/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=30-05-2019+Binnenschifffahrt+News+der+Woche+31.05.2019&utm_content=Mailing_11404680
Copyright Binnenschifffahrt
Bund verspricht 2 Mrd. € für die Wasserstraßen
Die Bundesregierung will verstärkt in die Wasserstraßen im Ruhrgebiet investieren. Ein zusätzliches Planungsteam soll den Ausbau der Infrastruktur beschleunigen.
Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium (BMVI), hat bei der »Regionalkonferenz Wasserstraßen im Ruhrgebiet« im Duisburger Landschaftspark angekündigt, die Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen und speziell im Ruhrgebiet stärken zu wollen. das Ministerium werde dafür Investitionsschwerpunkte setzen.
Konkret kündigte der Parlamentarische Staatssekretär in seinem Grußwort an, dass insgesamt rund 2 Mrd. € in die Infrastruktur fließen sollen. 400 Mio. € seien bereits investiert worden, 370 Mio. € würden gerade verbaut und rund 1,22 Mrd. € sollten noch folgen. »Wir wissen, dass dies ein ›riesiger Brocken‹ ist, den wir da vor uns haben. Aber unsere Botschaft heute lautet: Ja, wir machen das.«
Ein komplettes Planungsteam soll außerdem aus einem anderen Wasserstraßengebiet in das Ruhrgebiet verlegt werden. Ferlemann sprach von 5 bis 10 Mitarbeitern, die sich gezielt um die prioritären Projekte an den westdeutschen Kanälen kümmern sollen. Auch weitere Möglichkeiten, um Projekte zu beschleunigen – wie zum Beispiel Maßnahmengesetze für ein schnelleres Baurecht – würden ergriffen.
»Die Wasserstraßeninfrastruktur muss planungssicher, zuverlässig sowie personalfreundlich aufgestellt sein und durchgängig betrieben werden. Außerdem müssen die Brückendurchfahrtshöhen in den Kanälen endlich zeitgemäß ausgestaltet werden, damit künftig die immer wichtiger werdenden Containerverkehre bewältigt werden können«, forderte Dirk Gemmer (Rhenus PartnerShip), Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB).
Zu einer zukunftsfesten Infrastruktur gehöre auch die Herstellung eines flächendeckenden 5G-Mobilfunknetzes an den Wasserstraßen. Dort dürfe man künftig nicht abgehängt werden.
Foto: Martin Wein
Im Sommer 2018 konnten Frachtschiffe den Bonner Hafen monatelang nur mit stark verringerter Ladung erreichen.
Foto: Martin Wein
Diplom-Ingenieur Hans-Heinrich Witte ist Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn.
Foto: Martin Wein
Der Koordinator Marcus Erdmann: „Als Leiter der Abteilung Schifffahrt sorge ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort für einen sicheren und reibungslos fließenden Schiffsverkehr auf allen Bundeswasserstraßen. Dazu zählt die Arbeit der nautischen Experten in den Revier- und Verkehrszentralen genauso wie die Bereitstellung einer modernen und leistungsfähigen verkehrstechnischen Infrastruktur.“
Foto: Martin Wein
Die Bau-Ingenieurin Stephanie Schweitzer: „Ich unterstütze als Dezernatsleiterin die Leitung der GDWS bei der Priorisierung und Koordinierung der mehr als 1300 Baumaßnahmen an 7300 Kilometern Binnenwasserstraßen und 23 000 km² Seewasserstraßen. Dazu zählen aktuell Großprojekte wie die Abladeoptimierungen am Mittel- und Niederrhein oder die Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe.“
Foto: Martin Wein
Der Ökologe Michael Heinz: „Ich beschäftige mich mit der ökologischen Entwicklung der Bundeswasserstraßen und dem Ziel die Emissionen der Binnenschifffahrt zu reduzieren. Mit meiner Abteilung Umwelt, Technik, Wassertourismus suche ich auch Perspektiven für die 2 800 Kilometer Wasserstraßen, die für die Schifffahrt keine entscheidende Rolle mehr spielen“.
01/05
Bonn. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung wächst in den kommenden Jahren von 150 auf bis zu 900 Mitarbeiter. Ihren Sitz hat sie auf dem Hardtberg in Bonn. Noch: Der Umzug an den Probsthof steht schon an.
Von Martin Wein, 08.05.2019
Auf dem Hardtberg – und damit ziemlich weit weg vom Rhein – hat die Generaldirektion der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (GDWS) ihren Sitz. Ein altes Leuchtzeichen im Foyer und maritime Bilder in manchem Büro machen deutlich, dass hier im Trockenen an der Infrastruktur für den Schiffsverkehr auf See und den Flüssen gearbeitet wird. Doch dabei wird es nicht bleiben. Für weitere Mitarbeiter ist im Gebäude an der Ulrich-von-Hassell-Straße kein Platz.
Die neue Mittelbehörde, die bei ihrer Gründung 2013 aus Norddeutschland als „Briefkastenfirma“ des damaligen Bundesverkehrsministers Peter Ramsauer verspottet wurde, soll in den kommenden Jahren in Bonn kräftig wachsen – von aktuell 150 auf dann 700 bis 900 Mitarbeiter. Derzeit werden die Aufgaben der sieben früheren Direktionen in Aurich, Hannover, Kiel, Magdeburg, Mainz Münster und Würzburg sukzessiv und sozialverträglich nach Bonn verlagert. Mitarbeiter können dazu in die neue Zentrale wechseln. Durch Ausscheiden frei werdende Stellen werden in Bonn neu besetzt. In der zweiten Jahreshälfte steht deshalb der Umzug an den Probsthof in ein früher von der Telekom genutztes Gebäude an.
Weitere Links
Reaktion auf Niedrigwasser Warum die Fahrrinne des Rheins tiefer werden soll
Mehr Wasser unterm Kiel Forscher wollen Rheinschiffern helfen
Bilanzziehung in Bonn So stark traf das Niedrigwasser die Schifffahrt
Was sind die Hauptaufgaben?
Die GDWS kümmert sich im Auftrag des Bundes um alle nennenswerten bundeseigenen Wasserstraßen zwischen Flensburg und Passau mit einer Gesamtlänge von 7300 Kilometern. Dazu gehören die Bauunterhaltung und Verkehrsregelungen ebenso wie die Steuerung und Überwachung des Schiffsverkehrs. Außerdem gewinnen der Erhalt und die Verbesserung der ökologischen Qualität der Flüsse sowie deren Freizeitnutzung zunehmend an Bedeutung. Auch die Zufahrten zu den Seehäfen gehören zum Aufgabengebiet. Diese müssen etwa betonnt (ein Fahrwasser durch Seezeichen kennzeichnen) und überwacht werden. Die Arbeit vor Ort erledigen 39 Wasser- und Schifffahrtsämter von Tönning bis Passau mit insgesamt 11.000 Beschäftigten. Diese werden derzeit zu 17 Ämtern fusioniert, um für Schiffsführer die Zahl der Ansprechpartner auf einer Route zu verringern.
Warum und für wen ist diese Arbeit wichtig?
Gründungspräsident Hans-Heinrich Witte hat Zahlen: „70 Prozent des Güterverkehrs in Nordrhein-Westfalen finden auf dem Rhein statt“, sagt er. Auf dem Niederrhein sind das 150 Millionen Tonnen im Jahr, auf dem Mittelrhein noch 60 Millionen. Die Auswirkungen von Einschränkungen des Schiffsverkehrs auf die Stahl- oder Chemieindustrie wurden beim Niedrigwasser im vergangenen Sommer deutlich, als es zu Rohstoffengpässen kam. „Bus und Bahn können den Rhein als Verkehrsweg nicht ersetzen“, sagt Witte. Und ähnlich sehe es mit Weser, Elbe oder Donau aus. Damit Deutschlands Wirtschaft im Flussbleibe, seien die Wasserstraßen unerlässlich.
Niedrigwasser am Rhein
Foto: Dorothea Lauer
Foto: Dorothea Lauer
Foto: Dorothea Lauer
Foto: Horst Bennemann Niedrigwasser am Rhein in Rhöndorf.
Foto: Benjamin Westhoff Unter einem Meter lag der Rheinpegel im vergangenen Spätsommer.
Foto: Horst Bennemann Niedrigwasser am Rhein in Rhöndorf.
Foto: Axel Vogel
Foto: Axel Vogel
Foto: Axel Vogel
Foto: Axel Vogel
Foto: Axel Vogel
Foto: Axel Vogel
Foto: Axel Vogel
01/16
Wo liegen aktuelle Schwerpunkte?
Vor allem die Infrastruktur muss nach Jahren des Sparens instand gesetzt werden. Eine Bestandsaufnahme war nach Gründung der GDWS die erste Aufgabe. „Unsere Bauwerke sind teilweise älter als 100 Jahre und funktionieren immer noch mit derselben Technik“, sagt Witte. Ein besonders markantes Beispiel sei der Nord-Ostsee-Kanal vor allem mit der Schleuse in Brunsbüttel. „Auch viele Wehranlagen in ähnlichem Alter müssen dringend ersetzt werden.“ Witte nennt beispielsweise die Eingangsschleuse in die Mosel bei Koblenz, an der mit Hochdruck gearbeitet werde. Hinzu komme der nötige Ausbau etwa der Außenelbe oder Außenweser, um die Verkehrsströme der Zukunft überhaupt bewältigen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung der Binnenschifffahrt. So sollen Schiffern alle Informationen für ihre Touren digital zur Verfügung gestellt werden, um damit eine optimale Auslastung zu ermöglichen. Um die Schadstoffbelastung zu senken, würden Landstromanschlüsse an Liegestellen installiert. Eigene kleine Schiffe würden auf Elektroantrieb umgestellt.
Warum sitzt die Institution in Bonn?
„Das war eine politische Entscheidung, kein Teil des Bonn-Berlin-Ausgleichs“, sagt Witte. Die Lage der Stadt auf halbem Weg vom Bodensee zur Nordsee an der bedeutendsten Binnenwasserstraße Europas mache den Standort naheliegend.
Wie zufrieden ist sie mit dem Standort?
„Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen“, sagt Witte, der aus Kiel in die Stadt kam. Passend zur GDWS ist die Abteilung Wasserstraßen im Bundesverkehrsministerium in Bonn geblieben. Das schaffe Synergien. Auch die Anbindung ans politische Zentrum in Berlin sei von Bonn aus einfacher als von mancher der früheren Direktionen aus. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum macht Witte angesichts des geplanten Personalaufwuchses etwas Sorgen. Er sagt: „Allerdings haben Sie das in anderen attraktiven Städten ja auch“.
Steckbrief
Adresse: Ulrich-von-Hassell-Str. 76
Seit wann in Bonn: 2013
Mitarbeiter: rund 11 000, davon 150 in Bonn
Leitung: Hans-Heinrich Witte
Berufsgruppen: Ingenieure, Nautiker, Hydrologen, Juristen, Informatiker, Verwaltungsangestellte
Jahreshaushaltsvolumen: 1,05 Milliarden Euro
Finanzierung: Bund
Kontakt:0228/42 96 80; www.gdws.wsv.de
Home Zum nächsten Artikel springen Teilen
Meistgelesene Artikel:
Fahrer stirbt im Führerhaus Polizei und Zeugen stoppen führerlosen Lkw auf A1
Virtual-Reality-Attraktion
Copyright Binnenschiffahrt online
Neues Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt für Donauraum eröffnet
2. Mai 2019
https://binnenschifffahrt-online.de/2019/05/featured/6905/neues-wasserstrassen-und-schifffahrtsamt-fuer-donauraum-eroeffnet/
V.l.: Guido Zander, Leiter des WSA Donau MDK, Hans-Heinrich Witte; Präsident der GDWS, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Alexander Bätz, BPR (Foto: WSV)
Mit der Eröffnung des neuen »WSA Donau MDK« startet das dritte neu strukturierte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Rahmen der WSV- und Ämterreform.
Die Neuorganisation der bundesweit 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter hat heute weiter Fahrt aufgenommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eröffnete mit Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, das neue Amt »Donau Main-Donau-Kanal« (Donau MDK). In dem neuen Amt gingen die beiden bisherigen Ämtern Nürnberg und Regensburg wauf.
Witte »Größere Verantwortung und erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten – das ist eine gute Basis für passgenaue Serviceleistungen und Maßnahmen in der Region. Die Nutzer der Donau und des Main-Donau-Kanals werden davon profitieren.«
Der Leiter des neuen WSA Donau MDK, Guido Zander, sagte: »Bei der Feinplanung unseres neuen Amtes haben die Beschäftigten und Interessensvertretungen beider Ämter aktiv und vertrauensvoll mitgewirkt und sich so bereits kennengelernt und zusammengearbeitet: Beste Voraussetzungen füür einen guten Start!«
Zwei weitere neue Ämter im Sommer und Herbst
Die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV-Reform) ist eine der größten Verwaltungsreformen der vergangenen vier Jahrzehnte. Bereits umgesetzt sind die Neuorganisation der wasserstraßenbezogenen Aufgaben des BMVI und die Zusammenlegung der früheren sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn. Nun beginnt der dritte Abschnitt der Reform: Im Rahmen der Ämter-Neuorganisation werden 39 Ämter zu 17 Ämtern zusammengefasst. Dies betrifft insgesamt rund 10.000 Beschäftigte.
In den kommenden Monaten werden weitere neu zugeschnittene Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter an den Start gehen. Im Juni wird das Amt »Mosel-Saar-Lahn« und im Herbst das WSA »Oberrhein« die Arbeit aufnehmen.
»Bündeln die Kompetenz für rund 400 km Wasserstraße«
Der Neustrukturierung der Ämter ging die Zusammenlegung von sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt voraus. Die Aufgaben und Kompetenzen im Binnen- und Küstenbereich wurden in einer zentralen Behörde zusammengefasst. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der WSV-Verwaltung nachhaltig zu steigern.
In den vergangenen beiden Legislaturperioden wurden die Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Wasserstraßeninfrastruktur erhöht. Darüber hinaus wurde die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit zusätzlichem Personal für wichtige Investitions-maßnahmen ausgestattet.
V.l.: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
Hans-Heinrich Witte; Präsident der GDWS, Astrid Freudenstein, Abteilungsleiterin Z, BMVI, Alexander Bätz, BPR
Bundesverkehrsminister Scheuer: »Wir bündeln die Kompetenz für rund 400 km Wasserstraße in einer Hand: Ab sofort wird das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ›Donau Main-Donau-Kanal‹ für einen großen, zusammenhängenden Verkehrsraum der direkte Ansprechpartner für die Schifffahrt sein.« Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung gehe bei der Umsetzung ihrer Reform voran und könne dank gestrafften Strukturen »flexibler und schneller agieren«.
Anlässlich der Einrichtung des neuen Amtes informierte sich Scheuer auch über den aktuellen Stand der Umrüstung der WSV-Fahrzeugflotte mit neuen Abbiegeassistenten. Rund 60 von insgesamt ca. 260 umzurüstenden Fahrzeugen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes wurden bereits mit Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet. Alle neuen Lkw werden mit dem neuen technischen System beschafft. Bis Ende 2019 soll der gesamte Fuhrpark der WSV nachgerüstet werden. Das Förderprogramm »Abbiegeassistenzsysteme« des Bundesverkehrsministeriums soll dazu beitragen, Abbiegeunfälle zu verhindern.
Schlagworte
Donau
GDWS
Main-Donau-Kanal
Nürnberg
Regensburg
WSA
WSV-Reform
https://www.wochenblatt.de/politik/regensburg/artikel/284949/regensburg-beherbergt-jetzt-das-neue-wasserstrassen-und-schifffahrtsamt
Neues Amt eröffnet Regensburg beherbergt jetzt das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
0
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Donnerstag, 2. Mai, mit Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, das neue Amt „Donau Main-Donau-Kanal“ (Donau MDK) eröffnet. (Foto: Wasserstraßen- und Schifffahrtsa)
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Donnerstag, 2. Mai, mit Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, das neue Amt „Donau Main-Donau-Kanal“ (Donau MDK) eröffnet.
Damit startet das dritte neu strukturierte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Rahmen der WSV- und Ämterreform. Anlässlich der Einrichtung des neuen Amtes informierte sich Bundesminister Scheuer auch über den aktuellen Stand der Umrüstung der WSV-Fahrzeugflotte mit neuen Abbiegeassistenten.
Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: „Wir bündeln die Kompetenz für rund 400 Kilometer Wasserstraße in einer Hand: Ab sofort wird das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt „Donau Main-Donau-Kanal“ für einen großen, zusammenhängenden Verkehrsraum der direkte Ansprechpartner für die Schifffahrt sein. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung geht bei der Umsetzung ihrer Reform voran und kann dank gestraffter Strukturen flexibler und schneller agieren. Auch bei der Umrüstung der eigenen Fahrzeugflotte mit Abbiegeassistenten kommt sie vorbildlich voran.“
Rund 60 von insgesamt ca. 260 umzurüstenden Fahrzeugen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes wurden bereits mit Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet. Alle neuen Lkw werden mit dem neuen technischen System beschafft. Bis Ende 2019 soll der ge-samte Fuhrpark der WSV nachgerüstet werden. Das Förderprogramm „Abbiegeassistenzsysteme“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) trägt entscheidend dazu bei, Abbiegeunfälle zu verhindern.
Die Neuorganisation der bundesweit 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter hat heute weiter Fahrt aufgenommen: Aus den beiden bisherigen Ämtern Nürnberg und Regensburg wurde das WSA Donau MDK. Prof. Dr.- Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt: „Größere Verantwortung und erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten – das ist eine gute Basis für passgenaue Serviceleistungen und Maßnahmen in der Region. Die Nutzer der Donau und des Main-Donau-Kanals werden davon profitieren.“ Leiter des neuen WSA Donau MDK, Guido Zander: „Bei der Feinplanung unseres neuen Amtes haben die Beschäftigten und Interessensvertretungen beider Ämter aktiv und vertrauensvoll mitgewirkt und sich so bereits kennengelernt und zusammengearbeitet: Beste Voraussetzungen für einen guten Start!“
Die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV-Reform) ist eine der größten Verwaltungsreformen der vergangenen vier Jahrzehnte. Bereits umgesetzt sind die Neuorganisation der wasserstraßenbezogenen Aufgaben des BMVI und die Zusammenlegung der früheren sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn. Nun beginnt der dritte Abschnitt der Reform: Im Rahmen der Ämter-Neuorganisation werden 39 Ämter zu 17 Ämtern zusammengefasst. Dies betrifft insgesamt rund 10.000 Beschäftigte. In den kommenden Monaten werden weitere neu zugeschnittene Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter an den Start gehen. Im Juni wird das Amt „Mosel-Saar-Lahn“ und im Herbst das WSA „Oberrhein“ die Arbeit aufnehmen.
Der Neustrukturierung der Ämter ging die Zusammenlegung von sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt voraus. Die Aufgaben und Kompetenzen im Binnen- und Küstenbereich wurden in einer zentralen Behörde zusammengefasst. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der WSV-Verwaltung nachhaltig zu steigern.
In den vergangenen beiden Legislaturperioden wurden die Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Wasserstraßeninfrastruktur deutlich er-höht. Darüber hinaus wurde die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-tung des Bundes mit zusätzlichem Personal für wichtige Investitionsmaßnahmen ausgestattet.
NWZonline.de Nachrichten Wirtschaft Weser-Ems Drei Schifffahrtsämter werden zu einem großen
09.04.2019 – aktualisiert vor 40 Minuten
Leinen Los Für „weser-Jade-Nordsee“ Drei Schifffahrtsämter werden zu einem großen
Inga Wolter
Schiff auf dem Küstenkanal: Das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist für einen großen Verkehrsraum zuständig. Die drei Standorte Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven bleiben bestehen. (Archivbild)
Bild: alfred pfeiffer
1 / 2
Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung der Region setzt die Segel für die Zukunft. Über 900 Mitarbeiter arbeiten in dem neuen Amt „Weser-Jade-Nordsee“. Was sind die Ziele der Neustrukturierung?
Im Nordwesten Neu auf Kurs gebracht hat sich die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) in der Region: Die drei Ämter Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven sind am Montag zu einem neuen Amt zusammengefasst worden. Das neue „Weser-Jade-Nordsee“ soll schneller, moderner, flexibler und unabhängiger von der Generaldirektion in Bonn arbeiten.
„Heute ist ein bedeutender Tag an der Küste“, sagte Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das neue Amt ist für den großen Raum mit den Bundeswasserstraßen Jade, Weser, den Nebenflüssen Hunte, Lesum und Wümme, Teilen des Küstenkanals und einem großen Teil der Nordsee zuständig. „Das ist schon beeindruckend“, so Ferlemann. „Mit über 900 Beschäftigten ist das eines der größten Ämter in der WSV.“
Leiter des neuen Amtes ist Dr. Torsten Stengel, der bereits seit 14 Jahren das Amt in Bremen führt, seit 2015 das WSA Bremerhaven und seit 2018 auch das WSA Wilhelmshaven. Die drei Standorte bleiben bestehen, die Aufgaben werden sich insofern ändern, dass jeder Standort bestimmte Schwerpunkte übernehmen soll – Wilhelmshaven zum Beispiel den Bereich Personalaufgaben. Für die Kapitäne soll sich nichts ändern. Nur die Einsatzgebiete könnten eventuell etwas größer werden, so Ferlemann. Aus Sicht des Personalrates ergeben sich durch die Neuorganisation Vorteile durch einheitliche Vorgehensweisen beim Arbeitsschutz oder bei den Arbeitszeiten. Insgesamt zeigte sich der Personalrat zufrieden mit der Entwicklung. „Es gab keinen Personalabbau und keinen Zwang, an einen anderen Standort zu wechseln“, sagte Alexander Bätz, Vorsitzender des Bezirkspersonalrates. „Wir fühlten uns mitgenommen.“ Für eine Beteiligung der Personalvertretungen an der Reform habe auch gesprochen, dass auf eine externe Unternehmensberatung verzichtet wurde.
In den 90er-Jahren war es in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zu einem drastischen Personalabbau gekommen. Tausende Stellen wurden eingespart. „Jetzt wachsen wir wieder“, sagte Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion. Weitere Einsparungen soll es nicht geben. „Ziel der Reform ist, dass das bestehende Personal die Aufgaben bewältigen und sich hinzukommenden Aufgaben wie Umweltschutz und Digitalisierung widmen kann.“
Das WSA „Weser-Jade-Nordsee“ ist das zweite neue Amt, das im Zuge der WSV-Reform eingerichtet wurde. Insgesamt werden 39 Ämter zu 17 zusammengefasst.
In den kommenden Monaten wird die Neuorganisation auf Ämterebene auf die gesamte Verwaltung der Bundeswasserstraßen – von der Donau im Süden bis zur Eider und Treene an der dänischen Grenze – ausgeweitet. Den Start macht am 11. März 2019 der Zusammenschluss der Ämter Heidelberg und Stuttgart zum neuen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) »Neckar«. Danach folgen die neuen WSÄ »Weser/Jade/Ems«, »Main-Donau-Kanal/ Donau« und »Mosel/Saar«.
Die WSV-Reform ist eine der größten Verwaltungsreformen der letzten Jahre. Bereits umgesetzt sind die Neuorganisation der wasserstraßenbezogenen Aufgaben des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) und die Zusammenlegung der früheren sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) in Bonn. Nun beginnt der dritte Abschnitt der Reform.
Die neuen Reviere sind wie folgt eingeteilt: Ems-Nordsee, Weser-Jade-Nordsee, Elbe-Nordsee, Nord-Ostsee-Kanal, Ostsee, Mittelrhein-Niederrhein, Oberrhein, Mosel-Saar, Neckar, Main, Main-Donau-Kanal/ Donau, Westdeutsche Kanäle, Mittellandkanal/ Elbe-Seitenkanal, Weser, Elbe, Spree-Havel und Havel-Oder.
Erste Erfolge sichtbar
Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, erklärt: »Kompetent, leistungsstark und zuverlässig in der Region verwurzelt – das ist die WSV. Damit dies so bleibt, zünden wir nun die nächste Stufe der WSV-Reform. Zukünftig sind die Ämter für große zusammengehörige Verkehrsräume zuständig und können dank gestraffter Strukturen schneller und flexibler agieren. Die Nutzer und Kunden haben einen einzigen Ansprechpartner im Revier und bekommen ihre Leistungen aus einer Hand.«
Erste Erfolge der WSV-Reform zeigen sich den Angaben des Ministeriums zufolge bereits. So sei es zum Beispiel im vergangenen Jahr erstmals seit vielen Jahren wieder gelungen, die Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur und die technische Ausstattung deutlich zu erhöhen.
Ferlemann: »Unser Dank gilt den fast 10.000 Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen. Sie haben den Wandel der Verwaltung aktiv und konstruktiv mitgestaltet und sie tragen die gemeinsam getroffenen Entscheidungen engagiert, motiviert und mit guten Erwartungen an die Zukunft mit.«

https://www.dvz.de/rubriken/see/detail/news/nachhaltiger-erfolg-fuer-die-wasserstrasse.html
Mit dem am Montag eingeleiteten Zusammenschluss der beiden Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Heidelberg und Stuttgart zu einem neuen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar, beginnt für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) die Umsetzung der Ämterreform. Dem neuen WSA Neckar sollen weitere folgen. Am Ende bleiben von einst 39 Ämtern 17 übrig. Ziel ist eine bessere Betreuung größerer Verkehrsräume.
Die Taktung der Fusionen gehe jetzt in rascher Folge weiter, sagt Hans-Heinrich Witte, Präsident der in Bonn ansässigen Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), im Gespräch mit der DVZ. Im April folgt das neue Revieramt Weser, Jade, Nordsee.Im Mai geht es mit Main-Donau-Kanal, Donau und im Juni mit Mosel, Saar weiter.
Von der Neuausrichtung der WSV sind 10.000 Beschäftigte betroffen. Trotz dieser tiefgreifenden Veränderungen spürt Witte eine „unheimlich hohe Akzeptanz“ bei der Belegschaft. Wenn er auf Betriebsversammlungen der Ämter gefragt wird, wann denn mit der neuen Struktur losgelegt werden kann, müsse er die Mitarbeiter eher bremsen, um organisatorische Fehler zu vermeiden. „Die konzeptionelle Planung und fachaufsichtliche Tätigkeiten stärker zu bündeln, ist ein unheimlicher Mehrwert“, so das Fazit von Witte.
Ingenieurkapazitäten werden hochgefahren
Er macht keinen Hehl daraus, dass die WSV im Zuge der Reform jetzt mit 5.000 Beschäftigten – ein Drittel der einstigen Belegschaft – weniger auskommen muss. Dafür kann die GDWS Wasserstraßenprojekte in der ganzen Republik aus einer Hand abdecken. Erst durch die Gründung der Zentralverwaltung 2013 wurde es möglich, die verschiedenen Projekte zu priorisieren und in eine zeitliche Abfolge zu bringen. „Ein nachhaltiger Erfolg für die Wasserstraße“, findet Witte.
Ähnlich wie andere Arbeitgeber auch muss die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung um Personal werben. Gebraucht werden Ingenieure und Juristen. Dafür hat der Bundestag Planstellen bewilligt. Der Hochlauf der Ingenieurkapazitäten benötigt jedoch Zeit, denn der Personalabbau der Vergangenheit wirkt noch nach. Laut Witte gibt es bei der Ausbildung zum Bauingenieur eine Kooperation mit drei Hochschulen, die speziell für die GDWS arbeiten: Hochschule Koblenz (duales Studium Bauingenieurwesen/Wasserbauer), Universität Bochum (Bachelor Bauingenieur und parallel Verwaltungsausbildung) und Hamburg (Bauingenieur Bachelor/Master). Die ersten Absolventen in Bochum sind demnächst fertig, so Witte, und würden für zwei Jahre übernommen. Obendrein bekomme jeder eine Garantie für eine dauerhafte Beschäftigung.
Was dem Nachwuchs abgesehen von der reinen Beschäftigung ebenfalls geboten werden müsse, seien moderne Arbeitsbedingungen für die Generation Z. Darunter versteht Witte Telearbeit, Homeoffice und andere Formen der flexiblen Tätigkeit, mit denen angesichts der demografischen Entwicklung gepunktet werden soll. Den Ingenieuren, die bauen wollen, bleibe die Reise zur Baustelle trotzdem nicht erspart, sagt Witte mit einem Lachen. „Die Baustelle kommt selten zum Ingenieur.“
Es gibt viele Baustellen, die besucht werden müssen, wobei Witte betont, dass Erhalt vor Ausbau geht, zumal es nicht möglich ist, allein wegen eines Ausbauprojektes eine im Prinzip funktionierende Infrastruktur an anderer Stelle zu sperren. Ein Projekt, dessen zügige Realisierung er sich wünscht, ist die Vertiefung des Mittelrheins.
https://www.dvz.de/rubriken/politik/detail/news/masterplan-binnenschifffahrt-kommt-mitte-mai.html

Mitte Mai wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den bereits für Ende 2018 erwarteten Masterplan Binnenschifffahrt vorstellen. Zuvor will das Ministerium in einer letzten Runde die relevanten Verbände konsultieren und die hausinterne Abstimmung abschließen. Das sagte Ministerialdirektor Reinhard Klingen der DVZ am Freitag am Rande eines Fachforums der Grünen-Bundestagsfraktion zur Binnenschifffahrt und die Herausforderungen bei der Infrastruktur.
Angesichts der anstehenden Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2020 erwartet Klingen bei der Binnenschifffahrt keine großen Änderungen der Mittelausstattung. Kürzlich gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bekannt, dass bis 2023 rund 25 Mrd. EUR Bundesmittel fehlen werden. Am kommenden Mittwoch wird er die Eckwerte des Haushalts vorstellen. „Die Investitionslinie im Verkehrsetat muss erhalten bleiben“ sagte Klingen. Der Haushalt 2019 sieht für die Bundeswasserstraßen 1,3 Mrd. EUR, davon 982 Mio. EUR für Investitionen vor.
Wie die anderen Verkehrsträger auch, leidet die Binnenschifffahrt unter einem großen Sanierungsstau. Jahrelang wurde Personal in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) abgebaut, die Anlagen der Wasserstraßen sind veraltet. Ein Dauerbrennerthema ist die Reform der Verwaltung. „Wir sind damit im Plan. Bis Mitte der 20er Jahre wird die WSV-Reform abgeschlossen sein“, versicherte Klingen.
Schon in den vergangenen Jahren habe sich die Arbeit der WSV verbessert. Im Laufe der letzten Legislaturperiode habe sie 250 zusätzliche Stellen für den investiven Bereich bekommen, die auch weitestgehend besetzt seien. „Im vergangenen Jahr haben wir nahezu alle Mittel, die aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung standen, verbaut“, fügte der Ministerialdirigent hinzu.
Klingen beklagt die langen Vorbereitungs- und Planungszeiten bei Wasserstraßenprojekten. Die Vorbereitungen dauerten mitunter fünf Jahre, die Planfeststellungsverfahren etwa zweieinhalb Jahre und die Baurechtsvergabe zuletzt noch einmal 18 Monate. Deshalb seien der Personalaufbau und eine bessere Ablauforganisation in der Verwaltung zentral. Zudem will die Regierung bei Vergaben künftig mehr auf die Wirtschaftlichkeit und nicht so sehr auf die preisgünstigsten Angebote setzen. „Höhere Angebotspreise sollen möglich sein, dann muss man nicht mit Nachträgen rechnen“, sagte Klingen. Die Verwaltung will zudem in den Niederlanden erprobte Vergabeprozesse einführen.
„Marode Schleusen halbieren die Wirtschaftskraft“, sagte Gerd Deimel, Geschäftsführer der Beratungsfirma c2i (Consulting to Infrastructure) und Sprecher des Aktionskreises Verkehrsinfrastruktur des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) Nordrhein-Westfalen. Als Beispiel nannte Deimel den Wesel-Datteln-Kanal, auf dem 2017 etwa 20.000 Schiffe 18 Mio. t Güter transportierten. Allein defekte Poller schmälerten die Leistung des Kanals um 50 Prozent und die Volumina um 25 Prozent.
Problematisch ist Deimel zufolge, dass gemäß dem Bundesverkehrswegeplan die Leistung des Wasserstraßennetzes vorgegeben ist, dafür aber 500 Stellen in der Verwaltung fehlen. Auch hier könne Deutschland von den Nachbarn lernen wie den Niederlanden. Dort gebe es digitale Bordbücher, Platooning in der Binnenschifffahrt und ein digitales Schleusenslot-Management.
Thema des Fachgespräches waren auch alternative Antriebe für die Binnenschiffe. Reinhard Klingen ist der Ansicht, dass synthetische Kraftstoffe in der Binnenschifffahrt künftig eher eine Rolle spielen als E-Antriebe oder Flüssiggas LNG. Für letzteres sei der Antrieb zu teuer. Die Umrüstung der derzeitigen Flotte würde 1 Mrd. EUR kosten. Angesichts der Klimaziele sagte Klingen: „Die Ära der Binnenschifffahrt steht uns noch bevor.“ Klimaschutz sei nur mit der Wasserstraße zu schaffen.
Begegnungsbox bringt ersten Gewinn
Auch die Zufahrten zu den deutschen Seehäfen beschäftigen die Behörde von Witte. Allen voran die Elbvertiefung, die jetzt mit ersten wasserbaulichen Maßnahmen begonnen hat. Die eigentlichen Baggerarbeiten können starten, sobald das Vergabe-Nachprüfverfahren abgeschlossen ist – nach derzeitigem Stand am 18. März. „Dann kommt die Bauphase mit einer Nettobauzeit von 21 Monaten – danach kann die Elbe freigegeben werden“, so Witte. Aber schon Ende 2019 sind erste Erleichterungen für den Zu- und Ablauf des Schiffsverkehrs des Hamburger Hafens spürbar, wenn die sogenannte Begegnungsbox fertig ist. „Wir gehen zwar erst in die Breite und dann in die Tiefe, dennoch ist das der erste wirkliche Gewinn aus der Maßnahme Fahrrinnenanpassung“, erläutert Witte.
Fast genauso lange wie an der Elbe wird an der Vertiefiung der Unter- und der Außenweser geplant. Das Bundesverwaltungsgericht verkündete 2016 ein Urteil, das die Vertiefung der Weser vorerst stoppte. Allerdings beanstandete das Gericht nur die Rechtswidrigkeit der behördlichen Entscheidung. Witte rechnet damit, dass der Planfeststellungsbehörde neue Unterlagen im dritten oder vierten Quartal vorgelegt werden. Danach geht es ins Planfeststellungsverfahren. Ein Beschluss kann frühestens Ende 2020 kommen. „Die Weser lernt vom Elbeverfahren.“
https://www.dvz.de/rubriken/see/detail/news/nachhaltiger-erfolg-fuer-die-wasserstrasse.html
Copyright Kieler Nachrichten
Erhöhung der Gebühren ist vom Tisch
Höhere Gebühren für die Nutzung des Nord-Ostsee-Kanals sind für die nächsten Jahre erst einmal vom Tisch. Einstimmig lehnte der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages den Antrag des Verkehrsministeriums ab, bereits ab dem kommenden Jahr eine um 35 Prozent erhöhte Befahrensabgabe zu erheben.
Dillingen/Saarbrücken. Der oberste Schifffahrts-Beamte macht nur wenig Hoffnung auf eine Beschleunigung beim Bau neuer Kammern.Von Lothar Warscheid
„Der Warentransport auf Saar und Mosel ist für die saarländische Stahlindustrie alternativlos. Daher muss die zweite Kammer an jeder der zehn Moselschleusen möglichst schnell kommen.“ Diesen Appell richtete Tim Hartmann, Chef der Dillinger Hütte und von Saarstahl, an Abgeordnete des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR), die sich am Freitag in Dillingen trafen, um sich über den Ausbau-Stand der Schleusen zu informieren. Allein an fertigen Stahlprodukten „transportieren wir jährlich vier Millionen Tonnen über den Wasserweg“, erinnerte Hartmann.
…………………………………… siehe Link oben und NOK21 Binnenschifffahrt

„Wir stehen zu diesem wertvollen Projekt!“ Bettina Hagedorn und Mathias Stein besuchten den Bau der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel
Ja, es wird teurer und ja es dauert länger – aber wir stehen zu diesem für Deutschland so wertvollen Projekt!“ – so die Bilanz der beiden SPD-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein. Der Bau der 5. Schleusenkammer am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) beunruhigte in den vergangenen Wochen mit Negativschlagzeilen. Vorausgegangen waren Berichte des Bundesrechnungshofes sowie des Bundesverkehrsministeriums: Aufgrund von Komplikationen am Bau (unter anderem Kampfmittelräumung) hinkt das Projekt bereits jetzt zwei Jahre hinter der Bauzeit hinterher, die Inbetriebnahme verzögert sich wohl um zwei bis vier Jahre – also auf 2024. Zudem könnte auf den Bund eine Kostenexplosion auf gut 800 Mio. Euro zukommen (bisher waren 540 Mio. Euro eingeplant).
Doch das Projekt ist zu wertvoll für die Volkswirtschaft im Norden: Der NOK hat immerhin mehr Schiffsverkehr als der Suez- und der Panamakanal gemeinsam. Nachdem 100 Jahre lang (fast) nichts investiert wurde, soll endlich eine komplette Grundsanierung für insgesamt mehr als 2 Mrd. Euro erfolgen. Erst durch das Bündnis „SOS für den Nord-Ostsee-Kanal – der Norden steht auf!“ ist es Bettina Hagedorn im Haushaltsausschuss gelungen, im November 2011 ca. 1,2 Mrd. Euro zusätzlich im Verkehrshaushalt bereitzustellen, um damit ein klares Signal für den Ausbau des NOK zu setzen – ein echter Erfolg.
Mit dem Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), Prof. Dr. Hans-Heinrich Witte, dem kommissarischen Leiter des WSA Brunsbüttel, Detlef Wittmüß und dem Unterabteilungsleiter im Bundesverkehrsministerium für Wasserstraßen, Hartmut Spickermann, haben die beiden SPD-Abgeordneten Klartext gesprochen und deutlich gemacht, dass sie den kritischen Bericht des Bundesrechnungshofs voll unterstützen. Das gilt insbesondere auch für die Forderung, dass künftige Berichte des Bundesverkehrsministeriums zur 5. Schleusenkammer deutlich transparenter werden müssen, damit das Parlament den tatsächlichen Sachstand beurteilen kann. Mathias Stein erwartet auch, dass sich die Kommunikation der GDWS zu diesem und anderen Großprojekten deutlich verbessert.
Auf Initiative der SPD gab es nach dem schwarz-gelben Kahlschlag in den vergangenen Jahren endlich eine massive Personalaufstockung bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung: Zwischen 2014 und 2019 wurden allein durch das Parlament 388 Stellen geschaffen (2014: 35, 2015: 50, 2016: 10, 2017: 78, 2018: 103, 2019: 113). Das klare Signal an die Beschäftigten in der WSV: Die SPD-Abgeordneten werden auch langfristig dem Fachkräftemangel an technischem Personal begegnen. Verspätete Ausschreibungen und der Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt führten allerdings zu einer verspäteten Einstellungswelle – immerhin, so die Verantwortlichen der WSV, seien die Stellen am NOK endlich alle mit engagierten Mitarbeitern besetzt. Bereits 2014 wurde ein Beschluss im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gefasst, der das Bundesverkehrsministerium auffordert, ein Konzept zu entwickeln, das auch außertarifliche Bezahlung zur Attraktivitätssteigerung bei Fachkräftemangel ermöglichen soll – bisher leider ohne Erfolg, denn ein Konzept fehlt immer noch.
Neben dem Bau der 5. Schleusenkammer waren auch die anderen Projekte entlang des NOK Gesprächsthema: das Trockeninstandsetzungsdock, die Levensauer Hochbrücke, die Begradigung der Oststrecke, der Kanalbau, die Schwebefähre Rendsburg und die Erneuerung der zwei kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau. Der Bau des Trockeninstandsetzungsdocks für 21 Mio. Euro soll 2020 beginnen.

Mathias Stein, Abgeordneter für Kiel, ist im Verkehrsausschuss mit dem Thema betraut. Bettina Hagedorn, ehemalige Berichterstatterin im Haushaltsausschuss für das Verkehrsressorts, ist jetzt als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium für die Finanzierung von Projekten in Deutschland zuständig. Die Berichte des Verkehrsministeriums und des Bundesrechnungshofes sollen noch in diesem Jahr im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ausgewertet und diskutiert werden.
worddatei neuesete BPR Info für alle Kollegen ohne Dienstmail WSA Brunsbuettel WSA Holtenau und
Rendsburg
Copyright Norddeutsche Rundschau
Kritik aus dem Norden am CSU-Abo aufs VerkehrsressortKiel In Schleswig-Holsteins Wirtschaft und Politik stößt die Ministerriege der neuen Groko weitgehend auf Zustimmung. Nur dass zum dritten Mal hintereinander ein CSU-Politiker Verkehrsminister wird, führt bei den Unternehmensverbänden Nord zu leisem Grummeln. „Wir sind nicht gerade euphorisiert darüber“, sagte gestern Verbandschef Michael Thomas Fröhlich. Es sei „zu befürchten, dass weiter eher Ortsumgehungen in Bayern gebaut werden als norddeutsche Projekte“. Dagegen begrüßte Fröhlich, dass Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz dem früheren Finanzminister Wolfgang Schäuble nachfolgt. „Er wird den Kurs von Schäuble fortsetzen“, hofft Fröhlich. Eine andere Erwartung hat man bei den Gewerkschaften: „Der Finanzminister kann das Kaputtsparen beenden – hier und in Europa“, sagte DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn. Scholz habe „den Schlüssel in der Hand für mehr Investitionen, für den Ausbau der lebensbegleitenden Bildung und auch für die Kontrolle des Mindestlohns“. Aus der Kieler Landesregierung äußerte sich Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Der FDP-Politiker setzt auf seinen künftigen CDU-Bundeskollegen Peter Altmaier: „Ich hoffe, dass der neue Bundeswirtschaftsminister die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes so vernünftig umgestaltet, dass wir in Schleswig-Holstein aus der Energiewende auch wirtschaftspolitisch richtig was machen können“, sagte Buchholz. Gleichzeitig appellierte er an Scholz’ neue Staatssekretärin und Fehmarnbelttunnel-Gegnerin Bettina Hagedorn, auf ihrem künftigen Posten nicht gegen das Beltprojekt zu arbeiten. Hagedorn sagte dazu, dass sie ihre Meinung nicht ändern werde, es aber in ihrem neuen Job „nicht in erster Linie um den Tunnel“ gehe. SPD-Landeschef Ralf Stegner zeigte sich zumindest mit den SPD-Ministern zufrieden. Zudem freute er sich, dass die Nord-SPD mit Hagedorn nach neun Jahren „wieder in der Bundesregierung vertreten ist“. Zu Wort meldete sich auch Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, die im Kampf um den SPD-Vorsitz gegen Fraktionschefin Andrea Nahles antreten will. Sie hoffe auf „nahbare Ministerinnen und Minister“ und werde „als Bundesvorsitzende besonderen Wert darauf legen“, mit ihnen „gut zusammenzuarbeiten“, sagte Lange. Das Aus für Umweltministerin Barbara Hendricks und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nannte sie bedauerlich. bg https://netzpolitik.org/2018/nun-offiziell-bundesrechnungshof-zerpflueckt-ex-minister-alexander-dobrind
t/
https://www.hansa-online.de/2018/02/schifffahrt/92701/mehr-als-100-freie-stellen-der-wsv/
Hoffnungsvolle Nachrichten aus Berlin: Die neue Regierung will die Binnenschifffahrt künftig stärker fordern. Die Schifffahrtsabgaben werden abgeschafft, Ausnahme ist der Nord-Ostsee-Kanal. Am Ende wurde es noch einmal äußerst zäh, zuletzt haben Union und SPD zwölfeinhalb Tage und eine ganze Nacht miteinander verhandelt, zuletzt gut 24 Stunden am Stück. Dann stand die Einigung, rund viereinhalb Monate sind seit der Bundestagswahl inzwischen vergangen. 177 Seiten stark ist das Papier, das die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD ausgehandelt haben. Darunter sind 11 Seiten dem Verkehrssektor gewidmet, die von der maritimen Wirtschaft und der Logistikbranche sicherlich besonders intensiv studiert werden. Naturgemäß sind die Aussagen noch sehr allgemein gehalten. Aber was steckt drin? Nach Auskunft des Zentralverbands der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) sind in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) derzeit 104,8 Planstellen und Stellen nicht besetzt. Darüber hinaus befänden sich 54 Dienstposten im laufenden Ausschreibungsverfahren und 224 Dienstposten im laufenden Besetzungsverfahren. Die Zahlen gehen aus einer schriftlichen Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Frage des Abgeordneten Mathias Stein (SPD, Kiel) hervor. Das fehlende Personal behindere die Arbeit der WSV und beeinträchtige damit die Leistungsfähigkeit der deutschen Verkehrsinfrastruktur. Personalengpässe würden die ohnehin schon viel zu langwierigen Planungs- und Bauverfahren zusätzlich verzögern, so der ZDS. Für die neue Legislaturperiode des Bundestages fordert der Verband daher eine »konsequente und nachhaltige Aufstockung der Planungs- und Umsetzungskapazitäten des Bundes«. Dies ist ebenso wichtig wie die dauerhafte Ausstockung der Investitionsmittel für Verkehrsinfrastruktur und das dringend erforderliche Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz. Und auch die Bundesländer müssten für ausreichende Kapazitäten sorgen. Bei allen Verkehrsträgern muüsse gewährleistet sein, dass wichtige, im Bundesverkehrswegeplan und im Nationalen Hafenkonzept vorgesehene Infrastrukturprojekte zügig umgesetzt werden könnten. Die WSV betreibt und unterhält die Bundeswasserstraßen und die dazugehörigen Anlagen wie Schleusen, Brücken und Schiffshebewerke. Copyright netzpolitik.org
https://www.loz-news.de/politik/bundespolitik/1567-norbert-brackmann-wieder-obmann-der-cdu-csu-fraktion-im-haushaltsausschuss
Nun offiziell: Bundesrechnungshof zerpflückt Ex-Minister Alexander DobrindtAuf unser Drängen hin hat der Bundesrechnungshof einen Bericht veröffentlicht, der mit der Amtsführung von Alexander Dobrindt als Infrastrukturminister hart ins Gericht geht. Konsequenzen hat der rechtskonservative Polemiker aber kaum zu befürchten. Ein Kommentar. 
Seit Jahren schon geistert ein für den CSU-Politiker Alexander Dobrindt desaströser Bericht des Bundesrechnungshofes durch die Öffentlichkeit. Große Wellen schlug das Papier bislang nicht. Zum einen, weil es von zahllosen anderen Skandalen des ehemaligen Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur überschattet wurde. Zum anderen, weil die große Koalition kein Interesse zeigte, den Bericht offiziell zu veröffentlichen und ihn lieber in parlamentarischen Ausschüssen versacken ließ. Nun aber hat der Bundesrechnungshof die Analyse aus der politischen Versenkung geholt und die finale Fassung auf seine Webseite gestellt. Wir finanzieren uns zu fast 100 % aus Spenden von Leserinnen und Lesern. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder einem Dauerauftrag. Darin üben die Prüfer scharfe Kritik am Chaos im Infrastrukturministerium, das beim Aufbau der Abteilung „Digitale Gesellschaft“ schwere Fehler begangen habe. Unter anderem seien „wesentliche Grundsätze eines geordneten Verwaltungshandelns nicht beachtet“ worden, genauso wie es an einer „strukturierten Vorgehensweise“ gemangelt habe. Die Folgen sind bekannt: Anstatt auf echte Glasfaseranschlüsse zu setzen und Deutschlands Infrastruktur zukunftsfähig zu machen, versenkt das BMVI Milliardenbeträge in die kupferbasierte Übergangstechnik Vectoring, stärkt dabei die Marktmacht der Deutschen Telekom und sorgt insgesamt dafür, dass die Wirtschaftslokomotive Europas in einschlägigen Ranglisten weiterhin auf den hintersten Plätzen rangieren wird. Und all dies, ohne das versprochene Ausbauziel von bescheidenen „50 MBit/s für alle“ rechtzeitig zu erreichen. In anderen Worten: Dobrindt hat eine grundsätzlich falsch ausgerichtete Breitbandpolitik zu verantworten, an der Deutschland noch lange knabbern wird. Die schützende Hand der großen KoalitionDabei wäre es beinahe gar nicht zu einer offiziellen Veröffentlichung des Bundesrechnungshofberichts gekommen. Wie in einem schwarzen Loch verschwand die finale Fassung, nachdem sie Anfang 2016 bei den Berichterstattern des zuständigen Haushaltsausschusses im Bundestag ankam. Auf Anfrage sagte uns damals das Pressereferat, dass eine Ausschussbehandlung gar nicht beabsichtigt war. Auch eine Veröffentlichung sei von Seiten des Bundestages nicht vorgesehen gewesen. Und da in der Zwischenzeit Bundestagswahlen stattfanden und das Diskontinuitätsprinzip zuzuschlagen drohte, deutete alles darauf hin, dass der Bericht niemals offiziell an die Öffentlichkeit gelangen würde. Also kontaktierten wir den Bundesrechnungshof. Und der entschied schließlich, nach einer rechtlichen Prüfung, den explosiven Bericht auf eigene Faust zu veröffentlichen. Inhaltlich hat sich im Vergleich zu der von uns Ende 2015 publizierten Entwurfsfassung nichts geändert. (Hier lassen sich die Damals verzichtete das BMVI auf eine Stellungnahme gegenüber dem Bundesrechnungshof, teilte uns aber mit, die Anmerkungen für „nicht nachvollziehbar“ zu halten. Auf eine aktuelle Anfrage hieß es nun, das Ministerium habe im Rahmen einer parlamentarischen Behandlung im Oktober 2015 alle Fragen „uneingeschränkt beantwortet und die erforderlichen Konsequenzen gezogen“. Ob das Ministerium die Verbesserungsvorschläge der Prüfer zufriedenstellend umgesetz t hat, bleibt jedoch offen: „Die vom BMVI veranlassten Maßnahmen werden derzeit vom Bundesrech nungshof geprüft“, sagte uns ein Sprecher. Unbeantwortet blieb unsere Anfrage an die CSU-Landesgruppe im Bundestag, warum sie unerschütterlich an Dobrindt festhält. Flurschaden wohin man blicktNicht erst seit seinem Abschied als Bundesminister fällt der CSU-Mann in erster Linie als rechtskonservativer Sprücheklopfer auf. Dass er dabei einen gewaltigen Flurschaden hinterlässt, scheint ihn nicht weiter zu jucken. „Ich habe keine Angst davor, dass später von mir nur in Erinnerung bleibt: Das war nur ein Raufbold“, sagte der damalige CSU-Generalsekretär der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2011. Viel scheint dem nunmehrigen CSU-Landesgruppenchef nicht übrig zu bleiben, denn mit Fach- oder Managementkompetenz konnte der langjährige Politiker bislang nicht überzeugen. Überraschen kann diese traurige Bilanz aber nur die Wenigsten. Von der Diesel-Affäre über den Autobahnskandal bis hin zur verfehlten Breitbandpolitik, um nur einige Beispiele der letzten Legislaturperiode zu nennen: Wie ein roter Faden ziehen sich Skandale und verunglückte Projekte durch die Karriere von Dobrindt, der aus nur schwer nachvollziehbaren Gründen weiterhin eine politische Rolle spielen darf. Seine einzige Leistung besteht augenscheinlich darin, politisch links der Union stehende Menschen regelmäßig auf die Palme zu treiben. Der CSU scheint dies nicht nur auszureichen, sondern zu gefallen. Jedoch verlieren die Unionsparteien ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie eine zunehmende Politikverdrossenheit beklagen. Denn wenn sich ein Politiker aus ihren Reihen konsequent durch Inkompetenz auszeichnet, aber keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, dann werden sich Teile der Bevölkerung angewidert abwenden. Einzig Erfolge als Krawallmacher aufzuweisen, sollte für einen Politiker mit Regierungsverantwortung zu wenig sein. Copyright Ioz-news
Norbert Brackmann wieder Obmann der CDU/CSU-Fraktion im HaushaltsausschussFoto: W. Reichenbächer Zuständigkeit für Verkehrsetat bestätigtLesezeit: 2 Minuten Berlin (LOZ). Norbert Brackmann wurde heute von der CDU/CSU-Fraktion wieder zum Obmann im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bestimmt. Nachdem die Haushaltsmitglieder der CDU/CSU Brackmann einstimmig zum Obmann wählten, wurde er im Anschluss auch mit 95,5 Prozent der Stimmen von der gesamten CDU/CSU-Fraktion bestätigt. „Das große Vertrauen meiner Fraktionskolleginnen und -kollegen freut mich sehr. Es ist auch eine schöne Bestätigung für meine bisherige Arbeit als Obmann in den letzten 3 Jahren“, sagte Norbert Brackmann gleich nach seiner Wahl in Berlin. „Die Funktion des Obmanns bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. So bin ich zugleich stellvertretender haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und mitverantwortlich für die Koordinierung der Arbeit im Haushaltsausschuss. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Eckhardt Rehberg stimme ich die Haushaltspolitik der Fraktion ab und nehme so auch wieder Einfluss auf die Haushaltspolitik einer möglichen Großen Koalition“, erklärt Norbert Brackmann die Rolle als Obmann. Neben der Wahl zum Obmann, wurde Norbert Brackmann von der Arbeitsgruppe Haushalt der Unionsfraktion auch wieder als Berichterstatter für den Etat des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bestimmt. Für diesen mit Abstand größten Investitionshaushalt des Bundes war Norbert Brackmann bereits in den letzten 3 Jahren verantwortlich. „Es war mein Wunsch und Ziel wieder die Verantwortung für den Verkehrsetat zu bekommen. Denn hier wird die Infrastruktur Deutschlands gestaltet. Und hier kann ich auch für Schleswig- Holstein etwas bewirken. Der Verkehrsetat ist mit bisher rund 14 Milliarden Euro der größte Investitionsetat im Bundeshaushalt. Er bietet unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten. In den letzten Jahren konnte ich als Berichterstatter für den Verkehrsetat für Schleswig-Holstein dort etwas bewegen, wo der Einfluss des Landes alleine nicht ausgereicht hat. Gerade beim Nord-Ostsee-Kanal, der wirtschaftlich so bedeutend für Schleswig-Holstein ist, konnte ich für dessen schnellere Ertüchtigung zahlreiches Personal und Bundesmittel zur Verfügung stellen. Auch den Bau eines neuen Trockendocks zur Schleusentorinstandsetzung in Brunsbüttel oder den Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals konnte ich von Berlin aus initiieren. Diese erfolgreiche Arbeit für unser Land will ich nun fortsetzen. Gerade bei der Förderung der LNG-Hafeninfrastruktur, beim weiteren Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals oder dem Lärmschutz an der Fehmarnbelt-Hinterland- anbindung will ich mich für unser Land einsetzen und etwas für die Wirtschaft und die Bürger bewegen“, erläutert Norbert Brackmann seine Ziele in der neuen Legislaturperiode. http://www.kn-online.de/News/Aktuelle-Nachrichten-Schleswig-Holstein/Nachrichten-Schleswig-Holstein/Kanal-Passage-Skipper-sollen-jetzt-wieder-zahlen
https://www.shz.de/lokales/stormarner-tageblatt/hochwasserlage-entspannt-sich-glatte-strassen-in-der-nacht-zu-sonntag-id18739376.html
Skipper sollen jetzt wieder zahlenEigner von Privatjachten sollen ab wieder für die Passage auf dem Nord-Ostsee-Kanal zahlen. Z wei Jahre mussten sie keine Gebühren entrichten, weil der Weg zu den Zahlstellen zu riskant war Jetzt sollen eine App und Automaten Abhilfe schaffen. Der Kanalverwaltung sind bislang 350.000 Euro entgangen. Die Grundstruktur des deutschen Rettungssystems wird von der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) und den Nautischen Vereinen kritisiert. In einem Positionspapier fordern sie seit Längerem die Schaffung einer Deutschen Küstenwache. Darin könnten die vorhandenen Kräfte der Bundespolizei See, des Havariekommandos, des Zolls und der Fischereiaufsicht zusammengefasst werden. Die Schnittstellen zur Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sowie zur Marine und der Wasserschutzpolizei könnten davon zunächst unberührt bleiben. Am Ende könnten alle See-Vollzugsorgane auf Bundes- und Länderebene in einer Küstenwache zusammengefasst werden. https://idw-online.de/de/news681294 Copyright idw-online
WSV unterstützt Studiengang »Bauingenieur« Copyright Hansa online Startsignal – neue Chance für Bauingenieure Dietmar Strey Pressestelle Kooperationsvertrag zwischen Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg und Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes unterzeichnet In der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg wurde heute der Kooperationsvertrag zur Einrichtung eines neuen Bachelor- und Masterstudiengangs„Bauingenieurwesen“ unterzeichnet. Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt: „Der neue Bachelor- und Masterstudiengang denn wir bieten den Absolventen einen Arbeitsplatz in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes an und damit eine echte Perspektive.“ Ab dem Oktober 2018 können jährlich 30 Studentinnen und Studenten das Studium „Bauingenieur-wesen“ an der Helmut-Schmidt-Universität aufnehmen. Die Einteilung des Studienjahres in Trimester ermöglicht einen sehr viel schnelleren Abschluss des Studiums als an öffentlichen Universitäten. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt wird pro Jahr mit bis zu 18 Studentinnen/Studenten einen Studienvertrag für den neuen Studiengang abschließen, mit dem Ziel dieAbsolventen nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiengangs in die Wasserstraßen-und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu übernehmen. Die weiteren zwölf Studienplätze werden durch die Helmut-Schmidt-Universität besetzt. 19.09.2017 11:15 http://www.boyens-medien.de/artikel/dithmarschen/schlickbaggerung-verzoegert-schleusenbau.html Schlickbaggerung verzögert Schleusenbauvon Marc Thaden · 12. September 2017 · 13:15 Uhr Der vom Bundesverkehrsministerium angepeilte Eröffnungstermin für die fünfte Schleusenkammer ist passé: Ende 2020 sollte eigentlich das erste Schiff durch die neue Schleuse fahren – dieser Termin lässt sich offiziell nicht mehr halten. Hauptgrund für die Verzögerung von derzeit mehreren Monaten sei die „Schlickbaggerung unter Kampfmittelverdacht“, wie das Verfahren offiziell heißt. Mehr dazu in unserer Ausgabe am Mittwoch. Doch die Kritik fällt scharf aus. So fühlt sich die SPD von Dobrindt schlecht informiert, verlangt Aufklärung. „Sollte es zu falschen Mehrausgaben und damit Mindereinnahmen bei der Lkw-Maut gekommen sein, muss der Deutsche Bundestag vom Minister umgehend informiert werden und zwar noch vor der Bundestagswahl“, erklärte Martin Burkert (SPD), Chef des Verkehrsausschusses, am Montag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Bisher hat es für uns als Abgeordnete keinerlei Informationen dazu gegeben. Wir können uns keine Löcher im Verkehrshaushalt erlauben, brauchen Geld für unsere Straßen, Schienen und Wasserstraßen.“ Grüne fordern TransparenzDie Grünen erheben schwere Vorwürfe. „Offenbar ist Minister Dobrindt den Mautbetreibern nicht gewachsen und hat sich über den Tisch ziehen lassen. Seine leichtfertige Politik kostet den Steuerzahler viel Geld und klebt am Hacken der nächsten Bundesregierung“, sagte Grünen- Fraktionschef Anton Hofreiter der „Schwäbischen Zeitung“. „Dobrindt muss sofort sämtliche Zahlen und die Mautverträge offenlegen.“ Die neue Ministerin oder der neue Minister dürfe keine weiteren ÖPP im Straßenbau zulassen Erst die Berichte über die mögliche Pleite des norddeutschen Autobahnbetreibers „A1 mobil“, jetzt der Wirbel um die Lkw-Maut-Zahlungen: Kurz vor der Bundestagswahl gerät Verkehrsminister Dobrindt noch einmal unter Druck. Und dann wären da noch sein Umgang mit dem Dieselskandal und die Endlos-Geschichte um die Pkw-Maut. Seine Kritiker in der Opposition halten den CSU-Mann für „den schlechtesten Verkehrsminister, den die Bundesrepublik je hatte“. Für den 47-Jährigen dürften sich nach der Bundestagswahl ohnehin neue Perspektiven ergeben: Dobrindt gilt als gesetzt für den Posten des CSU-Landesgruppenchefs im Deutschen Bundestag. Copyright Schwäbische
http://www.infranken.de/regional/hassberge/schifffahrt-begleitet-ihn-bis-nach-hause;art217,2885700Region // HaßbergeArbeitsjubiläumSchifffahrt begleitet ihn bis nach HauseSeit 50 Jahren arbeitet der Limbacher Hans Schnös bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Er kennt die Wasserstraße wie seine Westentasche. Hans Schnös an seinem Arbeitsplatz in der Leitzentrale für die Schleusen am Main
zwischen Viereth und Ottendorf. Er hat die Arbeit im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
von der Pike auf gelernt. Foto: privat
Früh, wenn Hans Schnös seinen Kaffee trinkt und zum Fenster hinausschaut, „weiß ich wie der Laden läuft“, und abends hält er durchaus mal einen Ratsch mit denen, die täglich auf der großen Wasserstraße von der Donau bis zur Nordsee unterwegs sind. Der Limbacher ist seit 50 Jahren im Dienst der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und im Besonderen der Betriebsstellenleiter der Leitzentrale für die Schleusen von Viereth bis Ottendorf. Offiziell würdigte Amtsleiter Heinrich Schoppmann die „hervorragend geleistete Arbeit“ von Hans Schnös und überreichte die Dankurkunde. als Wasserbauwerker beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Schweinfurt begann für den 14-Jährigen im Schweinfurter Hafen auf einem Schwimmbagger, wo er mithelfen musste, den Rost zu entfernen. Aber, erzählt er schmunzelnd, das Wetter passte, und die Kollegen auch – bis heute hält der herzliche Kontakt. am Main zwischen Frankfurt und Nürnberg am Main-Donau-Kanal. Ab 1974 war er Schleusenwärter in Limbach, 1990 wurde er an der Schleuse Knetzgau Betriebsstellenleiter. Seit 2007 in Haßfurter ZentraleSeit der großen Umstrukturierung im März 2007, als in Haßfurt die Leitzentrale Haßfurt in Betrieb genommen wurde, ist Hans Schnös hier Betriebsstellenleiter. Von Haßfurt aus werden die Schleusen Viereth, Limbach, Knetzgau und Ottendorf ferngesteuert. Entwicklung in der Technik. „Fernsteuerung war früher nicht denkbar“, erinnert er sich. In den 17 Jahren an der Schleuse Limbach und den 16 Jahren in Knetzgau hat er die Schiffer und ihre Familien, die Matrosen und die ganze Besatzung bis hin zum Schiffshund persönlich gekannt. In den letzten zehn Jahren in der Leitzentrale ist das dem telefonischen und dem Funkkontakt gewichen: Die Hauptsprache auf dem Main ist deutsch, aber in den Ferngesprächen braucht man ein geübtes Ohr, um das internationale Personal, die Kapitäne und Besatzung aus Kroatien, Bulgarien, oft aus Donau-Anrainerstaaten, zu verstehen. Auf Du und DuAuf Du und Du mit den Menschen auf dem Main ist Hans Schnös immer noch, das bleibt ihm auch im Ruhestand: Er wohnt direkt an der Limbacher Schleuse, es ist eine Herzensverbindung, und nach Feierabend geht er schon mal vor die Tür zu einem Plausch mit den Schiffern, die in Limbach gerade Halt machen. „Man trinkt ein Bier oder einen Schoppen miteinander“, meint Schnös. Holländer, Belgier, andere Nationalitäten, man redet über die Arbeit auf dem Wasser und über manches Problem, etwa wegen der Terminfracht. Die Leitzentrale ist 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr besetzt, die Schifffahrt ruht nie. „So mancher trauert dem Steuerrad im Führerhaus hinterher“, weiß Schnös, es ist heute dem Joystick gewichen, der Raum ist vollgestopft mit Technik. Bei aller Arbeitserleichterung durch Radar und Elektronik ist es aber nicht wirklich so viel besser, denn die Arbeit fordert hohe Konzentration. Eines ist aber geblieben, das lieben die Binnenschiffer wie Hans Schnös: der Duft des Wassers, die Freiheit auf dem Fluss und die Schönheit der Landschaft. kra ………………………………………………………http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/versaeumnisse-in-der-verkehrspolitik-grillstunde-fuer-dobrindt/20271558.html?share=twitterCopyright Handelsblatt BerlinIn 15 Jahren hat Bettina Hagedorn (SPD) so etwas noch nicht erlebt. Seit dem 20. Januar bittet die SPD-Politikerin das Bundesverkehrsministerium, dem Bundestag einen Bericht zur geplanten Reform der Wasserstraßenverwaltung vorzulegen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will den Bau von Wasserstraßen durch Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP-Projekte) teilprivatisieren. Kritiker fürchten ein ähnliches Debakel wie jüngst bei den ÖPP-Projekten beim Autobahnbau. Am 30. August sollte Dobrindt den Bericht dem Parlament endlich vorlegen. Doch am gleichen Tag schrieb er, der Bericht werde leider nicht rechtzeitig fertig. A1 MobilAutobahnbetreiber fordert 787 Millionen Euro vom Bund Hagedorn platzte daraufhin der Kragen. Sein Schreiben habe sie „mit Erstaunen“ zur Kenntnis genommen, schrieb die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschuss an Dobrindt. Am Tag der Abgabe um Fristverlängerung zu bitten sei „ein Affront“ gegen die Beschlüsse des Parlaments, ein „einmaliger“ Vorgang, der ihr in 15 Jahren noch nie untergekommen sei, schreibt Hagedorn in dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt. Der Haushaltsausschuss des Bundestages werde sich am 5. September mit dem Vorgang befassen. Es wird nicht das einzige unangenehme Thema sein, zu dem das Verkehrsministerium in der Sitzung Stellung beziehen muss. Eigentlich war vor der Bundestagswahl keine Sitzung des Haushaltsausschusses mehr vorgesehen. Doch in den vergangenen Wochen sind so viele Themen hochgekocht, dass der Bundestag nun eine Sondersitzung anberaumt hat: die Bundesbürgschaft für die Pleite-Fluggesellschaft Air Berlin, der Diesel-Skandal, die drohende Pleite des ÖPP-Projektes der Autobahn A1. Insgesamt geht es um über eine Milliarde an Steuergeldern, die kurz vor der Wahl plötzlich im Feuer stehen. Und immer mittendrin im Getümmel: Verkehrsminister Dobrindt. Dobrindt selbst wird sich nicht den Fragen der Abgeordneten stellen, das dürfte er seinem Staatssekretär Enak Ferlemann überlassen. Der hat vor der Wahl nun noch eine Menge Arbeit. Noch am angenehmsten dürfte für ihn das Thema Bundesbürgschaft von Air Berlin werden. Hier gibt es etliche ungeklärte Fragen: Die Abgeordneten wollen wissen, ob es schon vor der Sommerpause Gespräche über eine Bürgschaft gab, wann die 150 Millionen Euro an die Fluggesellschaft ausgezahlt werden und was die Pleite von Air Berlin für den immer noch nicht fertigen Hauptstadtflughafen BER bedeutet. Allerdings ist neben dem Verkehrs- auch das Wirtschaftsministerium für das Thema zuständig. Beim Diesel-Skandal ist das nicht der Fall. Hier interessiert die Haushaltspolitiker, wo denn das Verkehrsministerium das Geld für einen neuen Fonds hernehmen will, der auf dem Diesel-Gipfel vor gut vier Wochen beschlossen wurde. So will die Bunderegierung einen Topf schaffen, aus dem Projekte finanziert werden sollen, mit denen der Schadstoffausstoß von Diesel-Autos in Großstädten reduziert werden soll. Bund und Autoindustrie wollen jeweils 250 Millionen Euro bereitstellen. Inzwischen sei sogar von insgesamt einer Milliarde Euro die Rede, berichtet der „Spiegel“. Diese Mittel muss Dobrindt aus seinem eigenen Etat aufbringen. Dort liegen zwar noch ungenutzte Gelder herum, etwa nicht abgerufene Fördermittel für den Breitbandausbau. Doch wenn Dobrindt die Mittel umschichten will, muss er das erst vom Bundesfinanzministerium genehmigen lassen und dann dem Haushaltsausschuss zur Kenntnis vorlegen. Das sei bislang aber nicht passiert. Der Betreiber des Autobahnabschnitts zwischen Bremen und Hamburg fordert einem Bericht zufolge knapp 800 Millionen Euro vom Bund. Das Konsortium mache Einnahmeausfälle geltend – und soll Klage eingereicht haben. mehr… Besonders sauer aber sind die Abgeordneten aber über Dobrindts Verhalten im Streit um den Ausbau der Autobahn A1. Die sogenannte Hansalinie zwischen Hamburg und Bremen wird von einer privaten Gesellschaft, der „A1 Mobil GmbH“, betrieben. An der Gesellschaft sind der mittelständische Bauunternehmer Johann Bunte und ein britischer Infrastrukturfonds beteiligt. Die Zusammenarbeit mit den Investoren galt aus Sicht der Bundesregierung als Beispiel, wie gut Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) beim Autobahnbau funktionieren. Doch dann geriet die Betreibergesellschaft in Schieflage und verklagte den Bund auf 770 Millionen Euro Schadenersatz. Begründung: Der Bund habe die vertraglich geregelte Vergütung des seit Langem defizitären Pilotprojektes nicht angepasst. Für den Bundesverkehrsminister liegt die Sache dagegen anders: A1 Mobil habe sich verkalkuliert und wesentlich mehr Güterverkehr auf der Strecke erwartet, als tatsächlich gerollt ist. Entsprechend geringer waren die Einnahmen aus der Lkw-Maut. Berichten zufolge soll das Verkehrsministerium schon seit vielen Jahren die Schieflage von A1 Mobil kennen, aber nichts dagegen getan haben. Das bringt die Parlamentarier gegen Dobrindt ebenso auf wie der Umstand, von dem ganzen Vorgang nur aus Presse erfahren zu haben. Bis heute liegt ihnen nichts Schriftliches zu dem Thema aus dem Bundesverkehrs.minist. rium vor, klagen sie. Gerade vor diesem Hintergrund ärgert sich Hagedorn besonders darüber, dass Dobrindt es nicht für nötig hält, einen Bericht zur Reform der Wasserstraßen und der Schifffahrtsverwaltung vorzulegen, wo Ähnliches geplant ist. WSV: Streit um die ReformEs gibt neuen Ärger um die umstrittene Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Artikel veröffentlicht: Freitag, 01.09.2017 20:10 Uhr Artikel aktualisiert: Freitag, 01.09.2017 20:31 Uhr
Berlin. Es gibt neuen Ärger um die umstrittene Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Nach Informationen der LN konnte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) den eigentlich für den 31. August vorgesehenen Fortschrittsbericht nicht den zuständigen Bundestagsausschüssen – Haushalt und Rechnungsprüfung – vorlegen. Vielmehr teilte BMVI-Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) den Abgeordneten am 30. August mit, wegen „erforderlicher Nacharbeiten“ könne der Bericht erst am 15. Oktober, also nach der Bundestagswahl, vorgelegt werden. In beiden Ausschüssen ist man verärgert. Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Bettina Hagedorn (SPD), erklärte, man werde der Bitte um Fristverlängerung nicht nachkommen. Das Thema WSV-Reform werde in der Sondersitzung des Haushaltsausschusses am Dienstag zur Sprache gebracht. Auch in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, in der viele WSV-Mitarbeiter organisiert sind, sorgte die Verzögerung für Kritik. Zudem haben Berichte über mögliche Privatisierungen einzelner Wasserstraßenprojekte, etwa des Instandssetzungs-Trockendocks in Brunsbüttel oder der Großinvestition am Elbe-Lübeck-Kanal, für Verunsicherung gesorgt. Die Verdi-Verantwortliche Antje Schumacher-Bergelin sagte den LN, man werde einer Privatisierung oder auch nur Teilprivatisierung einzelner Projekte keinesfalls zustimmen. Sie erneuerte die Verdi-Forderung, wonach die Präsenz der WSV im Küsten- und Binnenbereich flächendeckend gewährleistet bleiben müsse. Eine Ausgliederung touristisch genutzter Wasserstraßen lehnt Verdi ab. Vielmehr müssten Qualifizierungsprogramme für die WSV-Beschäftigten aufgelegt werden. https://news.google.com/news/search/section/q/Dobrindt%20Wasserstrassen/Dobrindt%20Wasserstrassen?hl=de&ned=de Copyright DVZ Bilanz der Bundesregierunghttp://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/alexander-dobrindt-erwaegt-oepp-modelle-fuer-wasserstrassen-a-1165082.html
Copyright Spiegel
Betriebsmodell für Wasserstraßen Dobrindts private KanäleSeit Jahren steckt Deutschland zu wenig Geld in seine Wasserstraßen. Nun erwägt Verkehrsminister Dobrindt, den Ausbau mithilfe privater Investoren voranzutreiben. Kritiker befürchten ein Desaster wie beim Autobahnbau. DPA
Der Staat bestellt neue Infrastruktur, private Unternehmen planen, bauen und pflegen sie: Dieses Prinzip, auch bekannt als öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP), steht seit vergangener Woche wieder in der Kritik. Da wurde bekannt, dass eine private Betreibergesellschaft der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen den Bund auf bis zu 640 Millionen verklagt und zugleich mit Insolvenz droht. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Kooperation mit der Privatwirtschaft entgegen allen Versprechen teurer wird.  ARCHIV – Das Containerschiff ´Independent Conceptª fâ°hrt am 12.07.2013 auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Kiel (Schleswig-Holstein) unter der Levensauer Hochbr¸cke. Das Institut f¸r Weltwirtschaft verËffentlicht am 15.06.2017 in Kiel die Konjunkturprognose f¸r den Sommer. Foto: Andre Klohn/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Trotz solcher Erfahrungen erwägt die Bundesregierung, ÖPP-Projekte künftig auch für Wasserstraßen zu nutzen. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor, der dem SPIEGEL vorliegt. Demnach plant die Regierung an den Bundeswasser- straßen „eine stärkere Einbeziehung von Dritten in die Planung und Baudurchführung sowie die Nutzung der Bandbreite der vorhandenen Vergabeverfahren“. In diesem Zusammenhang würden auch Vergaben über ein sogenanntes PBU-Modell geprüft, was für „Planung, Bau und Unterhaltung“ steht. Ein privates Unternehmen würde dabei nicht nur im Auftrag des Staates planen und bauen, sondern die Wasserstraßen auch anschließend betreiben. Dabei würden bisherige Aufgaben der Wasserstraßenverwaltung langfristig an private Unternehmen übertragen. „Eine Fremdfinanzierung ist beim ‚PBU-Modell‘ nicht vorgesehen“, heißt es weiter in einem Schreiben an Sven-Christian Kindler, den haushaltspolitischen Sprecher der Grünen. Das wäre ein Unterschied zu Projekten wie an der A1, wo ein privates Konsortium den Bau vorfinanziert hatte. Es sollte die Kosten über Einnahmen aus der Lkw-Maut wieder zurückerhalten , diese fielen aber geringer aus als kalkuliert.  ARCHIV – Ein Container-Frachter fâ°hrt am 22.01.2015 in HËhe von Gr¸nental (Schleswig-Holstein) neben einem anderen Schiff ¸ber den Nord-Ostsee-Kanal (NOK)â in Richtung Ostsee. In Berlin wird am 16.03.2016 der Bundesverkehrswegeplan bis 2030 vorgestellt. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Ansonsten entspricht das PBU-Modell aber weitgehend dem sogenannten V- oder Verfügbarkeitsmodell, welche das Verkehrsministerium bereits seit 2009 bei ÖPP-Projekten nutzt. Dabei wird mit einem Betreiber vereinbart, in welchem Umfang eine Strecke uneingeschränkt verfügbar sein muss. Werden die Vorgaben nicht erfüllt, erhält der Betreiber weniger Geld. Steht die Strecke dagegen länger zur Verfügung als vereinbart, gibt es einen Bonus. Die Investitionen sind seit Jahren zu niedrig Dass die Verfügbarkeit deutscher Wasserstraßen derzeit deutlich zu wünschen lässt, ist unbestritten. Seit Jahren kritisieren Binnenschiffer den schlechten Zustand des Netzes und zum Teil stundenlange Wartezeiten. Das eigentlich erforderliche Investitionsvolumen wird im Bundesverkehrsministerium auf 1,1 Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt, die tatsächlichen Ausgaben liegen aber seit 2012 nur zwischen 400 und 450 Millionen Euro. Als wichtiger Grund gilt, ähnlich wie bei anderen Infrastrukturprojekten, ein Mangel an Planungsressourcen. Nach SPIEGEL-Informationen erwägen Dobrindts Beamte nun vorerst in vier Fällen, über das PBU-Modell private Unternehmen an Bord zu holen:
 Ein mit Getreide beladenes Lastschiff fâ°hrt auf dem Stichkanal im Hildesheimer Hafen (Foto vom 05.07.2012). Auf dem Weg zu den norddeutschen Seehâ°fen ist das Binnenschiff eine umweltfreundliche Entlastung zu ¸berf¸llten Autobahnen und Bahngleisen. Sparplâ°ne des Bundes gefâ°hrden aber den Ausbau von Kanâ°len, Schleusen und Wasserstraï¬en. Unternehmen und Politiker schlagen Alarm. Foto: Emily Wabitsch dpa/lni (zu lni-Korr „Berliner Sparkurs bedroht Niedersachsens Wasserstraï¬en“ vom 16.07.2012) +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Wäre die Einbindung von Privaten in diese Projekte tatsächlich problematisch? Immerhin ist der Investitionsstau immens, zugleich scheint das Risiko durch den Ausschluss von Fremd- finanzierung überschaubar. Grünen-Politiker Kindler überzeugt das nicht. Die Verträge würden dennoch „riesig und intransparent und damit von Parlament und Öffentlichkeit kaum zu kontrollieren“. Der Bund binde sich über 30 Jahre an ein einzelnes Unternehmen, wobei sich aufgrund der Größe des Projekts nur Großunternehmen oder Konsortien bewerben könnten. „Es entstehen Monopolstrukturen durch die kleine und mittelständische Unternehmen benachteiligt werden.“ Skepsis gibt es auch vor Ort. Nina Scheer vertritt im Bundestag den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg-Stormarn-Süd, durch den der Elbe-Lübeck-Kanal fließt. Den Ausbau lehnt die SPD-Politikerin nicht prinzipiell ab, solange dabei nicht allein die Interessen des Güterverkehrs berücksichtigt würden. Scheer ist aber klar gegen einen Ausbau über ein ÖPP-Projekt. „Man kommt dabei an Gewinnerzielung nicht vorbei“, sagt die Abgeordnete. Die Probleme an der A1 hätten gerade noch einmal gezeigt, dass dies nicht der richtige Ansatz sei. „Es ist nicht der Zweck von Infrastruktur, Gewinne abzuwerfen.“ Das Bundesverkehrsministerium bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass es für die Wasserstraßen auch PBU-Modelle prüft. Diese seien keine ÖPP „im eigentlichen Sinn, da hier keine Fremdfinanzierung erforderlich ist“. Bislang wurden dem Ministerium zufolge „erste Vorüberlegungen“ zu geeigneten Projekten angestellt, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. http://www.dvz.de/rubriken/politik/single-view/nachricht/lotsen-beklagen-versandung-von-ostsee-haefen.html
Copyright DVZ
Ansonsten ist es Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. Was hat die Große Koalition bei Straße, Schiene, Wasserstraße, Seeschifffahrt, Digitalisierung und bei den Klimazielen erreicht? Die Verkehrs branche äußerte sich in vielen Punkten recht zufrieden mit der Regierungsarbeit. Vor allem für die Verkehrs- infrastruktur ist viel passiert. Konzepte im Luftverkehr, in der Hafenwirtschaft und für die Planung und Umsetzung von Verkehrsprojekten sind entstanden. Der kommenden Regierung obliegt es nun, diese umzusetzen. Weniger rühmlich sieht es mit den grundlegenden Zielen aus, zum Beispiel der Verlagerng von der Straße auf die Schiene, der Einführung alternativer Kraftstoffe oder der Senkung klimaschädlicher Treibhausgase, von Feinstaub oder Stickoxiden. GeschafftDer Bundesverkehrswegeplan 2030 und die Ausbaugesetze sind verabschiedet, Erhalt vor Neu- und Ausbau ist festgeschrieben, für die Infrastruktur gibt es mehr Geld, und die Infrastrukturgesellschaft Verkehr ist auf den Weg gebracht. Für Wesentliche Forderungen sind unter anderem, den Klageweg gegen Infrastrukturprojekte auf eine Instanz zu beschränken und bei identischen Brücken-Ersatzneubauten auf ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren zu verzichten. Für den Luftverkehr sind in dieser Legislaturperiode die Flugsicherungsgebühren gesunken. In der Binnenschifffahrt fördert die Regierung die Umrüstung von Schiffen und mit einer novellierten Förderrichtlinie Umschlaganlagen im Kombinierten Verkehr. Zuletzt sind Konzepte wie das Nationale Hafenkonzept und das Luftverkehrskonzept erschienen sowie der Aktionsplan Güterverkehr und Logisitk weiterentwickelt worden. Das Bundesverkehrsministerium trägt seit dieser Legislaturperiode die Digitale Infrastruktur i m Titel. Gelungen ist es auf jeden Fall, das hochautomatisierte Fahren voranzubringen. Auf dem digitalen Testfeld A 9 untersuchen Wissenschaftler und Unternehmen, wie Fahrzeuge miteinander oder mit der Infrastruktur kommunizieren können. Das Bundesverkehrsministerium hat außerdem die Plattform um neue Mobilitätsdienste zu entwickeln. In ArbeitDas gilt ebenso für die Infrastrukturgesellschaft Verkehr. Die Grundgesetzänderungen sind durch, doch der Aufbau der Gesellschaft obliegt der neuen Regierung. Die Koalition hatte sich 2013 dazu verpflichtet, alle zwei Jahre einen Verkehrsinfrastrukturbericht vorzulegen. Das hat sie im Mai 2016 auch gemacht, allerdings fehlen Transparenz und Informationen über das nachgeordnete Netz. Auch eine Evaluation, ob die Investitionen tatsächlich zu einer Verbesserung der Infrastruktur geführt haben, ist im Bericht nicht explizit erwähnt. Die Berichte sind eine Daueraufgabe, der nächste wird voraussichtlich 2018 erscheinen. Bei der Schiene ist noch die genaue Festlegung der Trassenpreise in Arbeit. Zwar gibt es die Zusage des Ministeriums, dass die Senkung in den Haushalt 2018 eingestellt wird. Auch die Bundestagsparteien sind sich einig, dass dieser Schritt nötig ist. An das Konzept und die Finanzierung muss sich die neu gewählte Regierung nun aber setzen. Die EU betrachtet das deutsche Lärmschutzgesetz als eine Einschränkung des Wettbewerbs. Für die Deutschen hingegen ist es ein Muss, um den prognostizierten Zuwachs des Güterverkehrs auch auf der Schiene abwickeln zu können. Noch in Arbeit ist der flächendeckende Ausbau des Internets. Alle Versuche, Fahrzeuge autonom fahren zu lassen, sind obsolet, wenn LKW beispielsweise in ein Funkloch geraten. Kommt nochTrotz vieler vollendeter Projekte bleibt die Liste der unerfüllten Versprechen lang. Im Straßenbau fehlt eine echte Mehrjährigkeit, so dass Mittel, die in einem Jahr nicht verbaut wurden, definitiv im folgenden Jahr in dasselbe Projekt fließen. Misslich ist auch, dass die Mittel für den Bundes- verkehrswegeplan (BVWP), immerhin knapp 270 Mrd. EUR, auf der Basis des Jahres2010 errechnet wurden. Die bisher angefallenen Preissteigerungen und auch die künftigen sind nicht eingerechnet, so dass der BVWP jetzt schon unterfinanziert ist. Was auch fehlt, sind die Neubewertungen der Schienenprojekte. Diese sollen erst 2018/2019 fertig werden. Die Schienenlobby sagt, dass der Verkehrsträger Schiene insgesamt nicht gestärkt und ausgebaut wurde. Ihr Anteil am Modal Split verharrte bei rund 17 Prozent, so viel wie seit 1995. Die EEG-Umlage wurde erhöht und schwächt die Schiene zusätzlich. Auch das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag 2013, „die Planung der Schienenwege am Ziel des Deutschland-Taktes mit bundesweit aufeinander abgestimmten Anschlüssen sowie leistungsfähigen Güterverkehrstrassen auszurichten“, konnte die Regierung nicht umsetzen. In einer BMVI-Studie wird derzeit die Machbarkeit geprüft. Die Luftverkehrsbranche wartet immer noch auf die Senkung der Luftverkehrs- steuer. Zuletzt hat sich in der Seeschifffahrt bei der Flaggenstaatsverwaltung nichts bewegt. Sie sollte „grundlegend modernisiert und vereinheitlicht“ werden, so wie es in anderen Ländern schon üblich ist. https://www.svz.de/regionales/brandenburg/weiter-aerger-ueber-schleusenzeiten-id17348976.html Copyright SVZ Verkürzte Öffnung : Weiter Ärger über SchleusenzeitenWasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes macht den Hobbykapitänen zunehmend das Leben schwer. Sie heißen „Sommerwind“, „Seebär“ oder „Flipper“. Vor der Schleuse in Storkow stauen sich bei schönem Wetterdie Sportboote. Wer am Morgen in Berlin losgetuckert ist, und über die Dahme den Scharmütze-lsee erreichen will, der muss hier durch. Doch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes macht den Hobbykapitänenzunehmend das Leben schwer. An der Bundeswasserstraße „Storkower Gewässer“ endet der Schleusenbetrieb werktags um 18 Uhr, und am Wochenende ist um 19 Uhr Schluss. Wichtigster Grund dafür ist die fehlende Frachtschifffahrt. Die „Storkower Gewässer“ stehen deswegen auf der Prioritätenliste nichtweit oben. Bei der örtlichen Tourismuswirtschaft sorgt das für Verärgerung. „Die Kunden müssen jetzt früher losfahren“, sagt Otmar Burchhardt, der in Erkner und Wolzig Boote verleiht. „Auf die kleinen Wassersportler nimmt hier keiner mehr Rücksicht.“ Bei den Sportbootkapitänen sei die Stimmung schlecht. Im vergangenen Jahr waren die Schleusenöffnungszeiten schon Thema im Brandenburger Landtag. Damals forderte das Landesparlament Minister Albrecht Gerber (SPD) auf, einen Bericht zum Wassertourismus vorzulegen. Am Dienstag wurde dieser Bericht im Kabinett beschlossen. „Wasser ist unser touristisches und kulturhistorisches Alleinstellungsmerkmal“, sagte Gerber nach der Kabinettssitzung – und hatte Glück, dass kein Zuhörer aus Mecklenburg-Vorpommern gerade in der Nähe war. „Nicht zuletzt aufgrund unserer Seenund Flüsse kommen von Jahr zu Jahr mehr Gäste nach Brandenburg.“ Bei der Entwicklung des Bundesverkehrs- wegeplans, und der damit einhergehenden Kategorisierung der Wasserstraßen, sei nur auf Gütermengen geschaut worden – und nicht auf die am Wassertourismus hängenden Arbeitsplätze. „Bei Bootsvermietungen,Häfen, Marinas und in der Fahrgastschiffahrt arbeiten 2100 Menschen, die jährlich mehr als 200 Millionen Euro erwirtschaften.“ Weswegen Gerber die Bundesregierung am Dienstag aufforderte, die Verkürzungen der Schleusenöffnungszeiten zurückzunehmen. Zudem solle man klar sagen, welche Wasserstraßen künftig renaturiert, und damit weniger stark für die Schifffahrt unterhalten werden sollen. „Wir haben bereits in der Unteren Havelniederung bewiesen, dass das Land Naturschutz und Tourismus in Einklang bringen kann.“ Zudem plädierte Gerber dafür, wieder mehr Güter auf dem Wasser zu transportieren: „Der Transport auf dem Binnenschiff ist vergleichsweise preiswert und umweltverträglich“, sagte der Wirtschaftsminister. Dass auch die Schleusen an manchen Landeswasserstraßen nur sehr kurze Öffnungszeiten haben, fiel dagegen am Dienstag nicht sonderlich ins Gewicht. An den „Ruppiner Gewässern“ etwa haben die Schleusen „Tiergarten“,„Hohenbruch“ und „Altfriesack“ nur von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dort allerdings fahren auch in der Saison weniger Boote durch als auf den wichtigen Bundeswasserstraßen, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium Denn auch auf dem Wasser gibt es nun einmal Haupt- und Nebenstraßen. Aus dem aktuellen Koalitionsvertrag 2017 – 2022 Schleswig Holstein „Wasserstraßen und Häfen“ Wir werden darauf hinwirken, dass der Bund seiner Verantwortung beim Erhalt und Ausbau der Bundeswasserstraßen in Schleswig-Holstein konsequent nachkommt. Vor allem der Nord-Ostsee- Kanal hat eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Wir erwarten, dass der Bund deutlich mehr Mittel für den Erhalt und den Ausbau der Schleusen in Kiel und Brunsbüttel und auch für die Vertiefung des Kanals und den Ausbau der Oststrecke bereitstellt. Auch bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes fehlt es an ausreichenden Planungskapazitäten.Hierfür muss der Bund ebenfalls mehr Mittel zur Verfügung stellen. Die immer wiederkehrenden Pläne auf Bundesebene zur Einführung einer Maut für Sport- und Freizeitschiffe sowie zur Aufgabe von Bundeswasserstraßen in Schleswig-Holstein werden wir nicht unterstützen. Das Land wird seiner Verantwortung für die in Landeszuständigkeit verbleibenden Häfen wahrnehmen und damit z.B. auch die Funktionsfähigkeit der entsprechenden tideabhängigen Häfen an der Westküste sicherstellen. Die Hinterlandanbindungen der Häfen müssen insgesamt verbessert werden. Wir werden ein Schleswig-Holsteinisches Hafenkonzept erarbeiten und daraus Förderkriterien ableiten.
werden können. Dazu werden wir über den Bundesrat die Befreiung des Landstroms von den Umlagen nach dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) anstreben.
Transport die notwendigen Betankungs- und Bunkereinrichtungen in Schleswig-Holstein zu schaffen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass beim Vollzug der vorhandenen Rechtsregelungen eine einheitliche Vorgehensweise in allen norddeutschen Bundesländern angewendet wird, um Standortnachteile zu verhindern. Wir werden veranlassen, dass die Vollzugsbehörden dazu kurzfristig eine standardisierte Gefährdungsbeurteilung für Bunkerstationen und Tankstellen (risk assessment) erarbeiten.In unserem Tourismusland achten wir die Traditionsschifffahrt. Wir werden uns weiter beim Bund dafür einsetzen,dass Traditionsschiffe die gesetzlichen Rahmenbedingungen erhalten, die einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten. Insgesamt werden wir über die Legislaturperiode zusätzlich zehn Millionen Euro Landesmittel
Info GDWS Umgang mit Personal Reduzierung auf 65 % nach der WSV Reform
Einspruch BPR und Anfrage Aufgabenreduzierung GDSW Beschäftigte , sprich Vergabe Vergabe
Vergabe an Private
ohne Ende mit sehr viel höheren Ausgaben, wie mit eigenem Personal.
neu aufgestellt
Anbei gebe ich vorab die Verfügung der GDWS vom 18.01.2017 hinsichtlich des
Fortbestehen der nautischen Befähigungszeugnisse bekannt.
Ich bitte um Beachtung und um Bekanntgabe an die Nautiker in Ihrem Zuständigkeitsbereich.
http://www.shz.de/lokales/flensburger-tageblatt/seebaeren-im-feinen-zwirn-id16294056.html
Copyright Norddeutsche Rundschau
. Am 9. März spricht Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn, zum Thema „Wasserstraßen – Herausforderungen für die Zukunft“ Schifffahrt in Flensburg : Seebären im feinen Zwirn50 Jahre Nautischer Verein: Wer mit See und Schifffahrt zu tun hat, ist bei der traditionellen Flensburger Vereinigung dabei. Die Lage am Wasser ist für Flensburg auch heute noch von lebenswichtiger Bedeutung. Seine Rolle als Hafenstadt ist jedoch …….. http://www.wzonline.de/nachrichten/wilhelmshaven/newsdetails-wilhelmshaven/artikel/maritime-kompetenz-gehoert-an-die-kueste.html Copyright wz online
Wilhelmshaven13.02.2017Maritime Kompetenz gehört an die KüsteFür die die Wilhelmshavener Hafenwirtschaft gab es viel zu besprechen. In Berlinsoll der CDU-BundestagsabgeordneteHans-Werner Kammer den Entscheidungsträgern einige maritime Anliegen vermitteln.Tauschten sich einmal mehr angeregt über wichtige maritime Themen (v.l.) aus: Heiner Holzhausen und John H. Niemann (beide WHV), MdB Hans-Werner Kammer (CDU) und Hans-Joachim Uhlendorf (WHV). Foto: WHV/P Wilhelmshaven/HL – MdB Hans-Werner Kammer ist unser Mann in Sachen maritimer Wirtschaft in Berlin“, so fasst John H. Niemann, Präsident der Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung (WHV), die gute Kooperation mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten zusammen. An dem Gespräch nahmen neben Niemann WHV-Vizepräsident Hans-Joachim Uhlendorf und Vorstand Heiner Holzhausen teil. Ein Thema war die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen wurden in einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) mit Sitz in Bonn gebündelt; zur weiteren Umsetzung der Reform gehört eine gestraffte Struktur der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter. Aus bisher 39 zuständigen Ämtern werden künftig 17. „Wichtig ist, dass die im Rahmen der WSV-Reform zugesagte Verlagerung von Fach- und Personalkompetenzen auf die Ebene der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter tatsächlich gelebt wird, damit immer mehr Entscheidungskompetenz vor Ort und nicht in Bonn bei der GDWS angesiedelt bleibt“, so Niemann. Ein weiterer Punkt des Gespräches bezog sich auf die Zukunft der am Bontekai liegenden Museumsschiffe „Feuerschiff Weser“ und „Kapitän Meyer“. Ruckzuckelnd voran Copyright DVZVerwaltungsvorschriften, doppelte Umweltprüfungen, Auflagen: Die Realisierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten geht in Deutschland oft nur im Schneckentempo voran. (Foto: Illustration: Carsten Lüdemann) V
iele Infrastrukturprojekte in Deutschland dauern von der Idee bis zum Abschluss zu lange. Um das zu ändern, hat das Bundesverkehrs ministerium (BMVI) im Juli 2016 ein Innovationsforum Planungsbeschleunigung einberufen. Das rund 100-köpfige Gremium hat seitdem mehrmals getagt und zum Abschluss einen Bericht erstellt, der der DVZ vorliegt. Ende März will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) das knapp 80-seitige Papier präsentieren. Die Autoren machen darin Vorschläge, wie Verkehrsprojekte künftig schlanker und schneller realisiert werden können. „Jetzt für die Logistik News anmelden“ Zwei Arbeitsgruppen haben sich mit den Verwaltungsabläufen und naturschutzrechtlichen Prüfungen beschäftigt. Neben einem besseren fachlichen Austausch zwischen den Beamten innerhalb der Bauverwaltungen, aber auch mit Ingenieurbüros plädieren sie auch für einen Genehmigungsverzicht für kleinere Vorhaben, beispielsweise Ersatzneubauten von Brücken. Auch sollten die Entwicklungen des Umweltrechts und des Infrastrukturrechts besser miteinander verknüpft werden. Außerdem empfehlen sie eine Reform des Planungsrechts und sinnvolle Anpassungen des europäischen und internationalen Rechts. Genehmigungen erleichternBesonderes Augenmerk legen die Arbeitsgruppen auf die komplizierten Planungs- und Genehmigungsverfahren . Übliche Praxis ist derzeit, dass jedes Verkehrsinfrastrukturprojekt verschiedene Stufen durchläuft, angefangen bei den Voruntersuchungen bis hin zum Planfeststellungsbeschluss (siehe Kasten). Erst dann darf gebaut werden. Dieses Verfahren allein ist schon langwierig genug. Dem Bericht zufolge kommt noch hinzu, dass unterschiedliche Behörden aus unterschiedlichen Blickwinkeln jedes Verkehrsinfrastrukturprojekt in unterschiedlichen Planungsständen prüfen. So werde beispielsweise sowohl im Raumordnungsverfahren als auch im Planfeststellungsverfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Das koste Zeit, und es entstünden Doppelarbeiten. Deshalb empfehlen die Autoren dem Bundesverkehrsministerium, die Schaffung einer einheitlichen Planfeststellungs behörde für alle Planfeststellungsverfahren in der Zuständigkeit des Bundes zu prüfen. Zur Vereinfachung empfiehlt das Innovationsforum, das Raumordnungsverfahren in das Planfeststellungsverfahren zu integrieren und die Linienbestimmung im Fernstraßen- und Wasserstraßenrecht abzuschaffen. Letztere ist Aufgabe des BMVI, für die Schiene legen die Eisenbahnunternehmen des Bundes die Trassen fest. Differenzen gibt es mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) als einziger Umweltschutzorganisation. DieNaturschützer sind mit einigen der Lösungen des Gremiums komplett überkreuz und haben das Innovationsforum deshalb Anfang Februar 2017 verlassen. Als Grund nennen sie unter anderem Eingriffe in die Rechte der Umweltverbände. Das Forum schlägt beispielsweise vor, den sogenannten Einwendungsausschluss (Präklusion) wieder in die europäische Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung aufzunehmen. Diese Regel hatte der Europäische Gerichtshof erst im Oktober 2015 für europarechtswidrig erklärt. Deutschland musste daraufhin das nationale Recht anpassen und die Rechte der Umweltverbände stärken. Diesen Erfolg wollen sich die Umweltschützer nun nicht wieder nehmen lassen. Schutzstandards erhaltenAuch den Vorschlag, nicht gefährdete Arten aus der Vogelschutzrichtlinie herauszunehmen und die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu überarbeiten, hält der BUND für nicht tragbar. Im Bericht heißt es, dass für zahlreiche Vorhaben beim Ausbau von Wasserstraßen künftig ein Fachbeitrag zu den Belangen der WRRL notwendig werde. Dieser könne sehr umfangreich ausfallen und zu zeitlichen Verzögerungen und einem zusätzlichen finanziellen Aufwand führen. Das Innovationsforum betont, dass es Schutzstandards nicht abschwächen wolle. Allerdings seien die umwelt- und naturschutzrechtlichen Anforderungen bei der Planung von Verkehrsinfrastruktur in den vergangenen Jahren immer mehr gestiegen. Um im Dschungel von Vorgaben, Leitfäden und Handlungsempfehlungen noch durchzufinden, schlägt es eine Wissensplattform zum Umweltschutz vor. Auf europäischer Ebene hält es zudem eine Stelle für sinnvoll, die in Brüssel die Interessen der Bundesverkehrs verwaltungen vertritt und damit den Einfluss des Verkehrssektors stärkt. Am 24. November 2016 trafen sich ver.di-Aktive aus HPR BMVI, BPR GDWS und der ver.di-
Bundesfachkommission sowie die Bundesfachgruppenleiterin mit Gustav Herzog im Bundestag, um über die
mangelnden
Fortschritte der WSV-Reform zu berichten. 16-11-24-flugi-im-gespraech-mit-gustav-herzog Im Mittelpunkt stand die zögerliche Umsetzung der im 6. Bericht beschlossenen Maßnahmen. freiwerdende Stellen mit erheblicher Verzögerung oder gar nicht besetzt werden. Das führt einer- ausgebildeten Beschäftigten, die nicht oder nur befristet übernommen werden. Damit präsentiert Fachkräften interessante Perspektiven bieten kann. Entgegen der Maßgabe im 6. Bericht, nach der ein Personalaufbau geprüft werden sollte, kommt straßen der Kategorie A angehören. Gustav Herzog sagte seine Unterstützung zu, damit die WSV-Reform, wie im 6. Bericht be- Gustav Herzog berichtete von dem beschlossenen Bundesverkehrswegeplan, mit dem Erhalt vor te Vorhaben und Finanzierung. Dafür wird allerdings ebenso Personal benötigt, dass ggf. aufge- Dafür wird sich ver.di einsetzen und die Unterstützung von Politikern wie Gustav Herzog, MdB, ver.di engagiert sich. Mitmachen! ver.di Bundesverwaltung Ressort 12, Fachbereich 6, verantwortlich: Wolfgang Pieper, Bearbeitung: Antje Schumacher-Bergelin, Im Mittelpunkt stand die zögerliche Umsetzung der im 6. Bericht beschlossenen Maßnahmen. freiwerdende Stellen mit erheblicher Verzögerung oder gar nicht besetzt werden. Das führt einer- ausgebildeten Beschäftigten, die nicht oder nur befristet übernommen werden. Damit präsentiert Fachkräften interessante Perspektiven bieten kann. Entgegen der Maßgabe im 6. Bericht, nach der ein Personalaufbau geprüft werden solle, kommt Wasserstraßen der Kategorie A angehören. Gustav Herzog sagte seine Unterstützung zu, damit die WSV-Reform, wie im 6. Bericht be- Gustav Herzog berichtete von dem beschlossenen Bundesverkehrswegeplan, mit dem Erhalt vor te Vorhaben und Finanzierung. Dafür wird allerdings ebenso Personal benötigt, dass ggf. aufge- Dafür wird sich ver.di einsetzen und die Unterstützung von Politikern wie Gustav Herzog, MdB, ver.di engagiert sich. Mitmachen! ver.di Bundesverwaltung Ressort 12, Fachbereich 6, verantwortlich: Wolfgang Pieper, Bearbeitung: Antje Schumacher-Bergelin, Minister Dobrindt beim HPR
Am 23.11.2016 hat Herr Minister
Dobrindt an der Sitzung des Hauptpersonalrates teilgenommen.Zu Beginn bedankte er
sich ausdrücklich für die gute Arbeit aller Beschäftigten im gesamten Geschäftsbereich
. Diesen Dank geben wir hiermit gernean unsere Kolleginnen und Kollegen weiter. Im Anschluss gab es einen kritischen, aber ko
nstruktiven Austausch zwischen ihm nund dem HPR-Gremium zu nachfolgenden Themen:
Wassertourismuskonzept
Keine eigene Behörde, neuer Verwaltungszweig in der WSV!
Wie bereitsvom HPR berichtet,fand eine enge Einbindung des HPR’s entgegen den Aussagen im
Wassertourismuskonzept nicht statt. Auf Nachfrage des HPR’sinformierte Herr Minister Dobrindt
, dass die Errichtung einer eigenen Behörde oder Betriebsgesellschaft nicht beabsichtigt ist. Es ist geplant, dass die
Umsetzung in einem eigenen Verwaltungszweig der WSV erfolgen soll.
Hierzu ist beab sichtigt Haushaltsmittel und Personalbedarf anzumelden.
Diese Information stützt die Auffassung des HPR’s, dass Teile der geplanten Umsetzung des Wassertourismuskonzeptes
Bestandteil der WSV -Reform sind und somit die entsprechenden Vereinbarungen zur WSV-Reform gelten.
Herr Minister Dobrindt sicherte die zukünftige Beteiligung und enge Einbindung des HPR in den weiteren Prozessen
zu.
WSV Reform Gemeinsame Problemlösungen!
Herr Minister Dobrindt wurde vom HPR eindringlich auf Probleme bei der Aufgaben erledigung in allen Bereichen
der Wasser -und Schifffahrtsverwaltung hingewiesen.Insbesonderem auf die wachsenden Arbeitsbelastung
en der Beschäftigten innerhalb der WSV.
Ein Grund hierfür ist das zentrale Nachbesetzungsverfahren der Generaldireiktion.Dies führt zu Unmut und Unverständnis in der Be
legschaft. 43 Monate nach Gründungder Generaldirektion wächst die Frustration in allen Bereichen und Ebenen der WSV.
Auf Nachfrage des Herrn Ministers wurden anhand von konkreten Beispielen die entstandenen Probleme benannt und erörtert.
Im Ergebnis sagte erseine persönliche Unterstützung zu und wird sich zwei konkrete Fälle genauer ansehen.
Darüber hinaus wird Lenkungsgruppe WSV-Reform (AL‘inZ und WS) eine Auflistung der entstandenen Probleme vom HPR erhalten.
Hierbei wird sich der HPR vom PR und BPR der GDWS unterstützen lassen.
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft Neubauämter der WSV nicht betroffen!
Zur Verkehrsinfrastrukturgesellschaft informierte Herr Minister Dobrindt
zum aktuellen Sachstand.
Der HPR fragte hierzu nach,inwieweit geplant sei, noch andere Bereiche wie
Schiene oder Wasserstraße in die Gesellschaft aufzunehmen
.
Hierzu antwortete Herr Minister unmissverständlich, dass wedergeplant noch beabsichtigt sei, den
Neubaubereich der WSV oder dasEisenbahnbundesamt in die Gesellschaft einzugliedern.
Infrastrukturabgabe Personalvertretungen werden beteiligt! Auf Nachfrage informierte Minister Dob
rindt , dass die Verhandlun gen mit der EU – Kommission noch nicht abgeschlossen sind. Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfa
hrens wird im KBA und BAG eine gemeinsame Besprechung anberaumt in der die künftigen Abläufe erörtert werden sollen.
Hierzu wurde auf Wunsch des HPR’s von Herrn Minister zugesagt, dass diezuständigen Personalvertretungen eingeladen werden.
Frau Dr. Hinricher (AL’in Z),Herr Minister Dobrindt,Kai Müller (HPR-Vorsitzender), Thomas Traut (Stellv. HPR-Vorsitzender)
und Walter Vignold (HPR-Vorstandsmitglied)
Zum Abschluss der Besprechung bedankte sich Herr Minister Dobrindt beim HPR für den
offenen Meinungsaustausch.
Brackmann/Hagedorn: Koalitionshaushälter beschließen massiven Personalaufwuchs für die WSV, die Ausweitung der Lkw-Maut und Deutschland geschaffen, um mit dem geeigneten Fachpersonal die Planungen und die 100-Jahre alten Kanäle zu sichern. Damit unterstützen wir gezielt die Mitarbeiterinnen Reform der WSV Reform der WSV struktur – für alle drei Revier statt. Teilnehmer sind die Revier-/Amtsleiter, Sachbereichsleiter, beauftragten. Informationen zum augenblicklichen Sachstand und dem weiteren Vorgehen, durch die Stabstelle herausgegeben. Arbeitssicherheit bei Arbeiten mit Freischneidern
Der Erlass zur Aufhebung der bisherigen, WSV-spezifischen Erlass regelung, zur Arbeitssicherheit bei Arbeiten mit Freischneidern wurde
durch das BMVI aufgehoben und die jährliche Berichtspflicht entfällt. Die Unfälle mit Freischneidern sind in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Die Wasserstraßen und Schifffahrtsämter können
jetzt wieder selbst, per Hausverfügung, Regeln für den Einsatz von Freischneidern, festlegen. Versicherung für Selbstfahrerinnen und Selbstfahrer:
Die GDWS hat (Vorangegangen war eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof) alle Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter aufge
fordert, die Versicherungen für unsere Selbstfahrerinnen und Selbstfahrer zu kündigen. Ab dem 01.01.2017 gilt dann die aktuelle
Rechtsprechung nach TVöD, u. Beamtenrecht. Die GDWS hat uns mitgeteilt, dass es zurzeit geprüft wird, ab dem 01.01.2017 die Haf
tungsgrenzen für die Beschäftigten festzulegen. Hier geht es nur um den Bereich grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz
Berufsaus- und Fortbildung, Jugend Fortbildungsmaßnahme zum Wasserbaumeister:
Obwohl die Vorlage der Verwaltung erst am Tag vor der Sitzung eingegangen ist und ÖPR´s nicht mehr beteiligt werden konnten, hat der BPR der Maßnahme zugestimmt, um den gemeldeten Teil nehmern nicht zu schaden. Die nächste BPR-Sit zung findet erst nach dem geplanten Start der Fortbildung statt Tarifrecht/Beamtenrecht
Gewinnung von qualifizierten Fachkräften in der WSV Mit der Verfügung der GDWS vom 31.10.16 – Durchführungshinweise zu § 16 (Bund)
TVÖD – neue Fassung, Erlass BMVI vom 25.10.16 (Z12/2112.2/6) gibt es jetzt klar stellende Vorgaben zum Umgang bei der Gewinnung von qualifizierten Fachkräften so wie der Bindung unserer eigenen Beschäftigten. Leider stellt sich bei diesen Ausführungen wieder einmal heraus, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Während im Prozess der Gewinnung von neuen Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit der Zahlung einer Zulage unbestritten ist, um die Attraktivität der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung als neuer Arbeitgeber noch zu steigern, wird beim „Bestandsper sonal“ Wert darauf gelegt das möglichst schon der „unterschriebene Arbeitsvertrag“ bei einem möglichen neuen Arbeitgeber vorliegt. Ein Schelm wer Böses dabei denkt! Der Bezirkspersonalrat bedauert die geringe Wertschätzung die unserem eigenen qua lifizierten Fachpersonal damit entgegengebracht wird. Ein großer Schub für die Schifffahrt Copyrigth Norddeutsche Rundschau
Bund kauft erstmals Flüssiggas–Schlepper und schafft mehr Stellen für den Nord–Ostsee–Kanal
Berli………………………………………. siehe unten
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/haushalt-2017-kaputt-gespart/14832434.html
Copyright Handelsblatt
Kaputt gespart
BerlinDer Bund will 2017 so viel investieren wie nie zuvor: 36 Milliarden Euro, nochmal eine
Milliarde mehr für
Verkehr zum Beispiel, sollen es 2017 werden. Dabei treibt die Bundestags-Haushälter eine
ungewohnte Luxussorge:
Sie fürchten, dass sie das eigentlich dringend benötigte Geld gar nicht loswerden, wie schon
2015 und 2016.
„Das Geld liegt“, sagt Unions-Haushälter Eckhardt Rehberg (CDU). „Weil wir in den letzten
Jahren, da müssen wir
auch selbstkritisch sein, zu viel beim Personal gespart haben“, ergänzt sein SPD-Kollege
Johannes Kahrs.
In der Nacht zu Freitag einigten sich die Bundestagshaushälter darauf, wie viel und wofür
genau der Bund 2017
Geld ausgeben darf. 329,1 Milliarden Euro stehen bereit, unterm Strich 400 Millionen mehr
als Schäuble plante.
Es fehlen Experten, die Bauten, Straßen und Kanäle planen und Aufträge vergeben können –
bei Bund, Ländern
und Kommunen gleichermaßen. „Finden Sie mal einen Wasserbauingenieur in Deutschland“,
seufzt Kahrs.
Es werde ein paar Jahre dauern, Fachkräfte zu gewinnen und auszubilden. Befristete Stellen
wandelt der Bund in
unbefristete um: Sonst, so die Erfahrung der jüngsten Zeit, gehen die Leute nicht in ein Ministerium.
Die Kehrseite jedoch: Was der Bund aus seinen prall gefüllten Kassen jetzt zahlt, sind dauerhafte
Ausgaben.
Jedes Jahr fallen die Kosten erneut an. Doch ab 2018 bekommen Länder und Kommunen mehr vom
Steuerkuchen.
„Das wird dann wieder eng“, fürchtet Rehberg. Steuersenkungspläne, da ist er sich mit Kahrs einig,
sollten die Parteien
im Wahlkampf nur vorsichtig versprechen. Sonst war’s das demnächst wieder mit der Schwarzen
Null.
Ein großer Schub für die Schifffahrt Copyrigth Norddeutsche Rundschau
Bund kauft erstmals Flüssiggas–Schlepper und schafft mehr Stellen für den Nord–Ostsee–Kanal
Berlin
Der Bund geht bei der Einführung von umweltfreundlichen Schiffen mit gutem Beispiel voran: Die große Koalition hat in der Nacht zu gestern im Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen, die geplanten Nachfolgebauten für die veralteten bundeseigenen Notfallschlepper „Scharhörn“ und „Mellum“ mit abgasarmem Flüssiggas–Antrieb auszurüsten. Beide neuen Schiffe sollen sogenannte „Dual–Fuel–Motoren“ erhalten, die wahlweise mit Flüssiggas (LNG) oder Schweröl betrieben werden können. Dafür haben die Haushälter für die je 107 Millionen Euro teuren Neubauten noch mal zusätzlich jeweils 6,5 Millionen Euro bewilligt. Die Mehrzweckschiffe sollen in drei Jahren fertig sein und in der Nordsee stationiert werden. „Mit der Entscheidung für Dual–Fuel–Motoren setzen wir ein Zeichen für klimafreundliche Schifffahrt“, erklärten in Berlin die beiden für Verkehrspolitik zuständigen Haushaltsobleute Norbert Brackmann von der CDU und Bettina Hagedorn von der SPD. Auch die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste zeigte sich erfreut: „Dass der Bund Vorreiter bei der klimafreundlichen LNG–Technik wird, ist vorbildlich“ sagte ihr Sprecher Hans von Wecheln. Bisher sind in deutschen Gewässern nur eine Handvoll Schiffe mit einem Flüssiggas–Antrieb unterwegs, weil es den Treibstoff i n Häfen kaum gibt. Unter anderem verkehren zwei Fähren mit LNG – zwischen Cuxhaven und Helgoland sowie zwischen Emden und Borkum. Um zudem die Schifffahrtswege zu stärken, bewilligte der Haushaltsausschuss 78 zusätzliche Jobs für Ingenieure und Techniker in der Wasserstraßenbehörde von Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Genau ein Drittel von denen wird für den Nord–Ostsee–Kanal angeheuert – allein 22 für den Neubau der beiden kleinen Schleusen in Kiel–Holtenau, aber auch vier für den Ausbau der „Oststrecke“ vor Kiel. Für die Planung des umstrittenen und 838 Millionen Euro teuren Elbe–Lübeck–Kanal–Ausbaus erhält ferner das Schifffahrtsamt in Lauenburg 20 neue Posten. „Damit treiben wir den dringlichen Ausbau des Elbe–Lübeck–Kanals deutlich voran“, sagte der Abgeordnete Brackmann, der selbst aus Lauenburg kommt. Und da neue Planer–Stellen angesichts des leergefegten Arbeitsmarkts für Ingenieure derzeit kaum zu besetzen sind, will der Bund die Ausbildung gleich selbst verstärkt in die Hand nehmen. Dazu richtet die Koalition einen neuen Studiengang für Bauingenieure an der Helmut–Schmidt–Universität der Bundeswehr in Hamburg ein. Elf Professorenstellen sowie 54 weitere für Assistenten, Laborkräfte oder Sekretärinnen haben die Haushälter genehmigt. Der Studiengang soll 2018 mit 30 Studenten starten und seinen Schwerpunkt im Verkehrswegebau haben. Wer ihn absolvieren will, muss nicht zur Bundeswehr, sondern nur ins Verkehrsministerium. Ungewöhnlich ist eine weitere Maßnahme in der Schifffahrtsverwaltung: Dobrindts Behörde wird neun Ausbilder einstellen, die Flüchtlingen durch eine Lehre helfen sollen. Schließlich investiert die Koalition auch in mehr Sicherheit auf See. Dazu hat sie zum einen den Kauf von drei Bundespolizeibooten für 165 Millionen Euro endgültig festgeschrieben, obwohl Innenminister
Thomas de Maizière
die zunächst gar nicht haben wollte. Zwei der neuen Patrouillenschiffe werden im ostholsteinischen
Neustadt stationiert,
eins in Rostock. Sie sollen alte, noch aus DDR–Zeiten stammende Exemplare ersetzen.
Zum anderen erhält CDU–Mann
de Maizière für seine Bundespolizei drei moderne Hubschrauber für Rettungseinsätze über Nord-
und Ostsee. Einer wird neu gekauft,
zwei andere werden umgerüstet. „So stärken wir die maritime Notfallvorsorge“, freute sich die
Ostholsteiner Abgeordnete Hagedorn.
Auch die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste
lobte: „Der Haushaltsausschuss hat sich um den maritimen Küstenschutz verdient gemacht“, sagte Sprecher von Wecheln. Henning Baethge
Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1, 11011 Berlin 10.11.2016 Brackmann/Hagedorn: Koalitionshaushälter beschließen massiven Personalaufwuchs für die WSV, die Ausweitung der Lkw-Maut und Deutschland geschaffen, um mit dem geeigneten Fachpersonal die Planungen und die 100-Jahre alten Kanäle zu sichern. Damit unterstützen wir gezielt die Mitarbeiterinnen Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen, Genehmigungen beim Kraftfahrtbundesamt sowie Für die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt, den Nord-Ostsee-Kanal Schleusenkammern in Kiel-Holtenau und vier Stellen für die Planung der Oststrecke, im Jahr 2014 gesichert wurde. Die neuen Stellen sind sowohl Ingenieursstellen als Darüber hinaus gibt es 20 neue Stellen – ebenfalls im höheren und mittleren Dienst – rund 60 Kilometer lange Elbe-Lübeck-Kanal war bereits im März 2016 durch das Beschlüsse des Haushaltsausschusses stärken den maritimen Standort und setzen ein Zeichen für die Zukunft des NordensBundestagsabgeordnete Dr. Birgit Malecha-Nissen begrüßt die Beschlüsse des Haushaltausschusses zum Verkehrsetat 2017  Berlin, 11.11.2016 Dr. Birgit Malecha-Nissen Berliner Büro: „Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner „Bereinigungssitzung“ zum Bundeshaushalt 2017 ein starkes Zeichen für die Zukunft des maritimen Standorts Deutschland gesetzt“, freut sich die schleswig-holsteinische SPD-Bundestagsabgeordnete, im Verkehrsausschuss zuständig für Schiffsverkehr. „Unsere Haushälter haben für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) einen massiven Personalaufwuchs beschlossen. Insgesamt 78 zusätzliche Stellen wurden für ganz Deutschland geschaffen. Für die meistbefahrenste künstliche Wasserstraße der Welt, den Nord-Ostsee-Kanal (NOK), gibt es 26 neue Stellen, davon 22 Stellen für die Planung und den Ausbau der Schleusenkammern in Kiel-Holtenau und vier Stellen für die Planung der Oststrecke, inklusive Bau der Levensauer Hochbrücke“, sagt Birgit Malecha-Nissen. Die neuen Stellen sind sowohl Ingenieursstellen als auch Stellen für den mittleren Dienst, wie z.B. Betriebstechniker oder Elektriker. Darüber hinaus gibt es 20 neue Stellen am Elbe-Lübeck-Kanal für das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg. Die SPD-Fraktion hat die künftige verkehrspolitische Bedeutung des Elbe-Lübeck-Kanals für den Norden durch die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan unterstrichen. „Die Große Koalition setzt damit ihre im Koalitionsvertrag beschlossene Trendwende bei der WSV gegenüber der Vorgängerregierung konsequent fort und gibt der Investitionsoffensive im Wasserstraßennetz in bundesbehördlicher Zuständigkeit die ihm gebührende Priorität und beschleunigt wichtige Infrastrukturprojekte in Schleswig-Holstein“, so Malecha-Nissen weiter. Der Beschluss, den Ersatzneubau der Mehrzweckschiffe „Scharhörn“ und „Mellum“ ausschließlich mit Dual-Fuel-Motoren (LNG/Diesel) zu finanzieren und dafür insgesamt 13 Mio. Euro zusätzlich zu bewilligen, setzt ein zukunftsweisendes Zeichen für eine klimafreundliche Schifffahrt. Jedes der beiden Schiffe ist mit gut 113 Mio. Euro im Bundeshaushalt 2017 abgesichert, wovon 2017 insgesamt 67 Mio. Euro bereitgestellt werden. „Alternative Kraftstoffe wie LNG (Flüssigerdgas) sind eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele leistet“, betont die Bundestagsabgeordnete. Durch die Bereitstellung von insgesamt neun Mio. Euro – davon drei Mio. Euro im Haushalt 2017 – zur Gründung eines „Deutschen Maritimen Zentrums“ (DMZ) am Standort Hamburg wird eine weitere Innovationsoffensive gestartet, damit die herstellende maritime Industrie in Deutschland weltweit Marktführer in der maritimen Technologie bleibt und diese Stellung weiter ausbauen kann. Malecha-Nissen: „Mit der Einrichtung des DMZ unterstützen wir die Koordinierung von Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich der maritimen Wirtschaft. Der Arbeitsbereich des DMZ umfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette in den Bereichen Schiffbau, Schifffahrt und Meerestechnik.“ Ebenso haben die Haushälter die Barmittel im Jahr 2017 für die drei Polizeischiffe bei der Bundespolizei See in Höhe von 75 Mio. Euro wieder in den Haushalt aufgenommen. Die drei Schiffe kosten insgesamt 165 Mio. Euro. Der Haushaltsausschuss hat die Gelder nun für 2017 beschlossen und wird für 2018 40 Mio. Euro bereitstellen. Das Bundesinnenministerium will schon im Dezember 2016 die Aufträge für die drei Ersatzschiffe unterschreiben. „Für die Zukunft können wir nun sicher sein, dass die Bundespolizei See weiterhin auf Nord- und Ostsee ihre gute Arbeit fortsetzt und durch neue Schiffe sogar noch verbessern kann“, so Malecha-Nissen abschließend. „Behörden finden keine Ingenieure für Baumaßnahmen“ , so die Schlagzeile heute im Wirtschaftsteil der Kieler Nachrichten. Viel zu lange wurde in diesem Bereichen Personal abgebaut, Ausbildungskapazitäten abgebaut und das Heil in irgendwelchen Privatisierungsmodellen gesucht. Gustav Herzog Das wird auch Thema der vier öffentlichen Anhörungen im Verkehrsausschuss sein.
Wichtig ist nicht mehr, dass die Investitionsmittel rasanter steigen, sondern wir eine Verstetigung hin
bekommen!
Andreas Fleck Das gilt leider auch für viele andere Bereiche. Privatisierung und Rückzug aus Verantwortung war so was von cool in der Politik. Sparte ja Geld. Jetzt können wir kaum noch die eigenen Projekte selbst ausschreiben. Vom Umsetzen nicht zu reden.
Bettina Hagedorn Mitglied des Deutschen Bundestages Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1, 11011 Berlin 10.11.2016 Brackmann/Hagedorn: Koalitionshaushälter beschließen Aufbau eines neuen Studiengangs „Bauingenieurwesen“ in Hamburg Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute den Bundeshaushalt in seiner Bereinigungssitzung abschließend beraten und dabei einen neuen Studiengang „Bauingenieurwesen“ an der Helmut- Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg beschlossen. Dazu erklären die Koalitionsberichterstatter Norbert Brackmann (CDU) und Bettina Hagedorn (SPD) als Initiatoren: „Wir haben mit den heutigen Beschlüssen einen vollständig neuen Studiengang im Bauingenieurwesen an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg geschaffen und über dafür zusätzlichen Personalbedarf von insgesamt 11 Professorenstellen samt entsprechendem Mitarbeiterstock im Bundeshaushalt 2017 entschieden. Die zunehmende Tendenz, dass immer weniger ausreichend geeignete Bewerber für die Laufbahnen des gehobenen und teilweise des höheren technischen Dienstes gewonnen werden können, hat die Einrichtung eines komplett neuen Studiengangs auf den Plan gerufen, für die sich die Bundeswehruniversität in Hamburg anbot. Mit dieser Maßnahme werden wir in Zukunft dem zunehmenden Mangel an Ingenieuren entschieden entgegenwirken können. Der Standort Hamburg ist auf Grund der vor Ort benötigten Dienststellen von besonderer Attraktivität für zukünftige Studentinnen und Studenten. Der neue Studiengang wird alle wesentlichen Kompetenzen eines bauingenieurwissenschaftlichen Studiums vermitteln. Vertiefungen sollen vorrangig zu Fragestellungen des Verkehrswegebaus angeboten werden (Straßen-, Wasserstraßen-, Eisenbahnstraßen- und Brückenbau).“ Bei Ladung Nord-Ostsee-Kanal schafft 90 Millionen TonnenÜber den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) sind in diesem Jahr nach einer ersten Prognose rund 90 Millionen Tonnen Güter transportiert worden. Das zeige, dass der Kanal nicht an Attraktivität eingebüßt habe, sagte der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Prof. Hans-Heinrich Witte. Über den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) sind in diesem Jahr nach einer ersten Prognose rund 90 Millionen Tonnen Güter transportiert worden. Quelle: Frank Behling Copyright KN online danke Frank Behling
Kiel/Brunsbüttel . Und dies trotz umfangreicher Reparaturarbeiten wegen Karambolagen in Schleusenanlagen, trotz niedriger Treibstoffpreise und trotz des Russlandembargos, so Witte am Dienstag. Der NOK bleibe als eine der meist befahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt eine unverzichtbare Verbindung zwischen den deutschen Nordseehäfen und dem wirtschaftlich starken Ostseeraum. Verifizierte Verkehrszahlen, Hintergründe und Erläuterungen für das Jahr 2015 werden Mitte Januar 2016 in der jährlichen NOK-Jahresbilanz veröffentlicht. Erst dann könnten belastbare Schlussfolgerungen für den NOK gezogen werden, hieß es. Der gut 100 Kilometer lange NOK verbindet Nord- und Ostsee. Im Schnitt transportieren täglich 95 Frachter knapp 300 000 Tonnen Ladung durch den NOK. Dafür wären auf der Straße bis zu 15 000 Lastwagen notwendig. |
Bettina Hagedorn 19.10.2016
 neuester Stand immer auf mehr…….. drücken ………..
neuester Stand immer auf mehr…….. drücken ………..
Haushaltsausschuss beschließt: Fehmarnbeltquerung wird Schnellfahrtras-
se und entlastet so ostholsteinischen Kommunen um Millionen
Hagedorn: 10 Mio. Euro für den Elbe-Lübeck-Kanal, Mittel für den NOK und den
Hafen Hörnum beschlossen – mehr WSV-Personal folgt!
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute den Regierungs- entwurf für den Verkehrshaushalt 2017 beraten und bereits jetzt weitreichende Änderungen beschlossen. Dabei wurde die Schienenhinterlandanbindung der ge- planten Festen Fehmarnbeltquerung als Schnellfahrtstrecke ausgewiesen und die Maximalgeschwindigkeit von 160 auf 200 Stundenkilometern angehoben. Zudem haben die Haushälter für den Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals 10 Mio. Euro Pla- ngskosten für den Gesamtausbau beschlossen und den Hafen Hörnum auf Sylt namentlich in den Haushaltsplan aufgenommen, wodurch dessen Sanierung nun durch Bundesmittel bezuschusst werden kann – und alles mit solider Gegenfinan-zierung. Bettina Hagedorn, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ostholstein und im Haushaltsausschuss SPD-Vize-Chefin und zuständige Berichterstatterin für Ver- kehr, erklärt die wichtigsten Auswirkungen der Beschlüsse:
„
Mit dem weiteren Beschluss, zusätzlich 10 Mio. Euro für die Planungsarbeit
en für den Komplettausbau des Elbe-Lübeck-Kanals (ELK) einzustellen,
treiben wir Haushälter dessen dringlichen Ausbau deutlich voran. So unter-
streichen wir die künftige verkehrspolitische Bedeutung des Kanals für den
Norden in Vernetzung mit dem gesamten deutschen und europäischen Binn-
enwasserstraßennetz.“
Darüber hinaus hat der Haushaltsausschuss namentlich den bereits im Jahr 2014
finanziell abgesicherten Ausbau der Oststrecke am Nord-Ostsee-Kanal (NOK)
sowie den Ersatzneubau für die Schwebefähre Rendsburg, die bei einem
Zusammenstoß mit einem Frachter im Januar 2016 vollkommen zerstört wurde
und nun nach historischem Vorbild neu gebaut wird, in den Bundeshaushal
t aufgenommen und somit ausdrücklich finanziell gesichert. Ebenfalls namentlich
aufgenommen wurde der Hafen Hörnum auf Sylt, um die hälftige Finanzierung
desBundes für die Sanierung des – ehemaligen WSV-Hafens des Bundes – in H
öhe von insgesamt 8 Mio. Euro zu ermöglichen.
Seite 2 von 2
Hagedorn: „Die Beratungen zum Bundeshaushalt sind damit noch nicht zu Ende: Am 10. November findet die Schlussberatung statt, die so genannte Bereinigungssitzung oder „Nacht der langen Messer“. Dort werden wir uns für einen massiven Personalaufwuchs bei der Wasserstraßen- und Schiff- fahrtsverwaltung insbesondere im Norden zu Gunsten der milliardenschwe- ren Investitionsvorhaben am Nord-Ostsee-Kanal, am Elbe-Lübeck-Kanal, am Hafen Rostock und an der Schleuse Scharnebeck starkmachen, damit der bisherige blamable Investitionsstau des Verkehrsministers bei Wasserstra- ßen und Häfen endlich zuverlässig beendet wird. Weiterhin liegen uns bei
der anstehenden Stärkung der Bundespolizei nicht nur die zugesagte Finan-
zierung der drei Küstenwachboote für 165 Mio. Euro am Herzen, sondernau
ch die Stärkung der Bundespolizei Küste mit ihrem erfolgreichen Ausbil-
dungszentrum in Neustadt insgesamt.“
neuester Stand BPR WSV Reform
Reform der WSV
Reform der WSV Seite 1
Stellennachbesetzung Seite 2
Lohnrechnung Seite 2
Einheitliche Bereederung Seite 3
Sozialwerkinfo Seite 4
WSV-Flotte wechselt zu Lloyd’s Register
Nord-Ostsee-Kanal kann ausgebaut werden
m Bundeshaushalt werden in den kommenden Jahren mehr als 250 Mio. EUR für den Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) bereitgestellt. Entsprechende Mittel hat der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt. Das teilten die schleswig-holsteinischen CDU-Bundestagsabgeordneten Johann Wadephul und Norbert Brackmann am Mittwoch mit. „Im Haushaltsjahr 2017 werden das zunächst eine Million Euro sein, ab 2018 und in den Folgejahren insgesamt weitere knapp 252 MIO: EUR“, sagte das Mitglied im Haushaltsausschuss, Brackmann.
Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) hat sich der Bereich der Oststrecke zwischen den Weichen Königsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Binnenhafen Kiel-Holtenau für den Schiffsverkehr zu einem Flaschenhals entwickelt. (dpa/sm)
Copyright Hansa Online
WSV-Flotte wechselt zu Lloyd’s Register

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes wechselt mit 67 seegängigen Behördenschiffen von DNV GL zur Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register (LR).
Vorausgegangen war eine Ausschreibung für Schiffe der Wasser- und Schifffahrtsämter entlang der deutschen Küste, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), der Bundespolizei und des Zolls, aus der Lloyd’s Register EMEA mit seiner Niederlassung in Deutschland siegreich hervorgegangen ist. Der Vertrag gilt für fünf Jahre.
»Wir sind sehr stolz, dieses Prestige-Auftrag gewonnen zu haben«, sagte Thomas Aschert, LR’s Marine & Offshore Area Manager für Nordeuropa. Die Entscheidung, in Hamburg das Kompetenzzentrum für Marine und Offshore in Nordeuropa zu etablieren, habe sich als richtig erwiesen. Künftig werden
Nach eigenen Angaben betreut Lloyd’s Register mit mehr als 300 Mitarbeitern eine wachsende Zahl von Kunden in Deutschland. Gegründet 1760 ist Lloyd’s Register eine der weltweit führenden Klassifikationsgesellschaften mit 9.000 Mitarbeitern in 78 Ländern.
Grundmodell des inneren Aufbaus der zukünftigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
Die Sommerpause neigt sich dem Ende und 2 Projektaufträge (Revier Weser-Jade-Nordsee und Revier Main-Donau-Kanal, Donau) sind unterschrieben. Die Unterschrift des 3. Projektauftrages Revier Neckar folgt in Kürze. Wir rechnen damit, dass die designierten neuen Revieramtsleiter umgehend ihre Arbeit aufnehmen und die Auftaktveranstaltung terminieren. Die Unterlagen, Sachstände zur Umsetzung der Ämterstruktur sind ins Netz gestellt und können unter
https://intranet.wsv.bvbs.bund.de/wsv_reform/ nachgelesen werden.
Seite 2
Info des BPR bei der GDWS (viSdP: Vorstand des BPR bei der GDWS)
Erstellt durch die Arbeitsgruppe Kommunikation
Bezirkspersonalrat
beiderGeneraldirektionWasserstraßenundSchifffahrt
Ulrich-von-Hassell-Str.76
53123Bonn
Stellennachbesetzung
Die 22. Priorisierungsrunde der GDWS steht an und es wurden ca. 600 Stellen zur Nachbesetzung beantragt. Wie im letzten BPR Info mitgeteilt ist der BPR im Entscheiderkreis nicht mehr vertreten. Zahlreiche Personalräte haben uns zum Thema angeschrieben und die Resonanz von seitens der ÖPR‘s war überwiegend geprägt von der Meinung, der BPR hat Recht, nicht mehr an den Entscheider kreis- Runden teilzunehmen. Wenn keine Möglichkeit besteht, selbst den Prozess der Nachbesetzungen mitzugestalten. Wenn nur die Meinung der GDWS zählt, dann war es die richtige Entscheidung. Eine für den 22.09.2016 geplante „Klausurtagung“, mit der Leitung der GDWS, zum Thema wurde abgesagt. Hier sollten die Rahmenbedingungen für die weitere Zusammenarbeit in Bezug auf Stellennachbesetzungen zwischen dem BPR und der Verwaltung, vereinbart werden. In der gemeinsamen Besprechung mit der GDWS (Augustsitzung) wurde dem BPR mitgeteilt, dass geprüft wird, unter welchen Rahmenbedingungen Nachbesetzungen zurück auf die nachgeordneten Dienststellen verlagert werden könnten.
Ein Fünkchen Hoffnung? Ja, aber nur wenn es klare verbindliche Regelungen gibt.
Am 21.09 2016 wird es Vorgespräche der Leitungsrunde für die Entscheidung zur 22. Runde geben.
Im Anschluss bekommt der BPR alle relevanten Unterlagen zur anstehenden Runde formal übergeben. Der BPR wird dann alle Mitwirkungs- und Mitbestimmungspflichtigen Personalentscheidungen in der BPR AG Tarifrecht sichten und in der Oktobersitzung auf die Tagesordnung nehmen.
Die nächste Stellennachbesetzungsrunde soll dann schon im November starten.
Die Entscheidung ist gefallen. Es wurden mehrere Varianten untersucht und wie uns die Leitung der GDWS mitteilte hat man sich für die Variante „5“ entschieden die besagt, dass eine Vergabe der 4 Fährstellen plus einer 24- Stunden Fähre
sowie die Tagesfähre Fischerhütte erfolgt. Die GDWS hat hier eine Organisationsentscheidung getroffen.
Fährbetrieb auf dem Nord-Ostsee Kanal
Kommentar: Die Verantwortlichen vor Ort haben sich viel Mühe gegeben und hatten insgesamt 7 mögliche Varianten untersucht und diese auch fachlich begründet. Die vom WSA und dem ÖPR favorisierte Variante fand keine Zustimmung durch die GDWS. Somit folgt, was in einer hierarchischen Verwaltung geht, eine Leitungsentscheidung. Nicht schön, aber effektiv – Schade.
Seite 3
I nfo des BPR bei der GDWS (viSdP: Vorstand des BPR bei der GDWS) Erstellt durch die Arbeitsgruppe Kommunikation Bezirkspersonalratbeider
GeneraldirektionWasserstraßenundSchifffahrt
Ulrich-von-Hassell-Str.76
53123Bonn
Einheitliche Bereederung
Der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Prof. Dr. Witte hat entschieden, die Bereederung der Mehrzweckschiffe an der Nord- und Ostseeküste zu optimieren, d. h. den Einsatz der Besatzungen zentral zu steuern. Eine eingerichtete Arbeitsgruppe soll das WANN, WIE und WO eines Kompetenzzentrums in einem Feinkonzept erarbeiten. Die Umsetzung dieses Konzeptes darf dann erwartet werden, sobald die Neubauten der Mehrzweckschiffe abgeschlossen sind. Die Heimathäfen sollen unverändert bleiben!
Aus den Arbeitsgruppen (AG)
Nach Informationen des BPR kam es bei der Anwendung der Besteuerung und Vergütung für Prüfer und Dozenten/innen zu unterschiedlichen Anwendungen innerhalb der WSV. Nach Überprüfung durch die GDWS ist nun sichergestellt, dass hier zukünftig eine Erlasskonforme einheitliche Vorgehensweise sichergestellt ist.
AG „Aus- und Fortbildung/Jugend“
Dozentenvergütung:
Sonderstelle für Aus- und Fortbildung (SAF):
Die Leitung der SAF hat dem BPR den Jahresarbeitsplan 2017 vorgestellt. Geplant sind ca. 270 Seminare, zusammengestellt nach Priorisierungen und Vormerkungen der Bildungsstellen. Der bedarfsorientierte und nachvollziehbare JAP 2017 wurde vom BPR zur Kenntnis genommen.
Seite 4
I nfo des BPR bei der GDWS (viSdP: Vorstand des BPR bei der GDWS) Erstellt durch die Arbeitsgruppe Kommunikation
Bezirkspersonalratbeider
GeneraldirektionWasserstraßenundSchifffahrt
Ulrich-von-Hassell-Str.76
53123Bonn
Informationen vom
BMVI – Pressemitteilungen-Ferlemann: Nächste Stufe der WSV-Reform startet
So fing es an hier werden die Infos fortgesetzt :
Parlamentarische Debatte im Bundestag über den Ausbau Wasserstrassen und die WSV Reform Aug. 2011
https://bund-laender-nrw.verdi.de/bund/bundesverkehrsverwaltung/++co++b6824e2c-36c4-11e6-9ed1-525400a933ef
|
|
||||||
|
||||||
http://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/verkehr/bundesverkehrswegeplan-fuer-diese-projekte-in-sh-gibts-geld-vom-bund-id14442936.htmlCopyright Norddeutsche Rundschau Die wichtigsten Verkehrsprojekte Schleswig-Holsteins auf einer Karte.
4.389 Ansichten
Kiel/Berlin | Der Bund will bis 2030 fast 270 Milliarden Euro in Straßen, Schienen und Wasserwege investieren. Das sieht der neue Bundesverkehrswegeplan vor, den das Kabinett am Mittwoch unter Leitung von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) beschlossen hat. Das Konzept von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) legt einen Schwerpunkt auf den Erhalt des bestehenden Netzes und will vor allem überregional bedeutende Engpässe beseitigen. Knapp die Hälfte der Gesamtsumme von 269,6 Milliarden Euro fließt in Bundesstraßen und Autobahnen. Fast 42 Prozent bekommt die Bahn. Als nächstes muss der Bundestag nun noch entsprechende Ausbaugesetze verabschieden. Auch Schleswig-Holstein ist mit mehreren Projekten im Topf. Wie aus dem Entwurf für den neuen Bundesverkehrswegeplan im März bekannt wurde, stehen einige Vorhaben ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. Dabei: der vierspurige Ausbau der A21 von Bargteheide bis Schwarzenbek für 135 Millionen Euro, der sechsspurige Ausbau des A23-Engpasses zwischen Tornesch und Hamburg-Eidelstedt für 145 Millionen und die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals für 235 Millionen Euro. Zum Originalentwurf des Bundesverkehrswegeplans geht es hier. Die Karte zeigt die Projekte in SH, welche in die Stufen „Vordringlicher Bedarf Plus“ (rot), „Vordringlicher Bedarf“ (orange) und „Weiterer Bedarf“ (grün) eingeteilt wurden: Vertiefung Nord-Ostsee-Kanal
SPD-Fraktionsvize Sören Bartol sagte: „Wir bauen dort, wo der Verkehr wirklich stattfindet und die Menschen tagtäglich im Stau stehen.“ Der Plan sei ehrlich gerechnet und setze richtige Prioritäten. So habe der Erhalt Vorrang vor neuen Vorhaben. „Bröckelnde Brücken, lange Staus und Verspätungen sollen der Vergangenheit angehören“, sagte Bartol. Wichtige Bahnprojekte seien endlich berechnet worden. Bis 2030 werde in den Neu- und Ausbau der Schiene mindestens in gleicher Höhe investiert wie in die Straße. Von der Opposition kam Kritik. Der Plan sei „eine unbezahlbare Wünsch-dir-was-Liste“, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der dpa. Klima und Umwelt seien „die große Leerstelle“ darin. „Statt immer neuer teurer Spatenstiche muss auf das bereits dichte Verkehrsnetz gesetzt werden“, forderte Krischer. Nötig sei, wirklich alle Verkehrsträger sinnvoll aufeinander abzustimmen. Nach dem Kabinettsbeschluss muss der Bundestag noch entsprechende Ausbaugesetze verabschieden. Der jetzige Verkehrswegeplan stammt von 2003. Kabinett beschließt Bundesverkehrswegeplan 2030 |
||||||
| Das Bundeskabinett hat heute den von Bundesminister Alexander Dobrindt vorgestellten Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 sowie die Ausbaugesetze für die Bundesschienen-, Bundesfernstraßen- und Bundeswasserstraßenwege beschlossen. Der neue Bundesverkehrswegeplan umfasst rund 1.000 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 269,6 Milliarden Euro. Diese teilen sich auf in 112,3 Milliarden Euro für Schienenwege, 132,8 Milliarden Euro für Bundesfernstraßen, und 24,5 Milliarden Euro für Bundeswasserstraßen.
Dobrindt:
Der neue BVWP 2030 enthält rund 1.000 Projekte. Davon entfallen 49,3 Prozent auf die Straße, 41,6 Prozent auf die Schiene und 9,1 Prozent auf Wasserstraßen. Die dringlichsten Aus- und Neubauprojekte sind nach nationalem Prioritätenkonzept als „Vordringlicher Bedarf“ (VB) eingestuft, darin gekennzeichnet die Projekte zur Engpassbeseitigung (VB-E). Der BVWP 2030 setzt fünf wesentliche Eckpunkte um: 1. Klare Finanzierungsperspektive Investitionsmittel und Projekte sind synchronisiert, so dass die Projekte des vordringlichen Bedarfs im Zeitrahmen des BVWP 2030 umgesetzt werden können. 2. Erhalt vor Aus- und Neubau Rund 70 Prozent der Gesamtmittel fließen in den Erhalt der Infrastruktur (BVWP 2003: 56 Prozent). 3. Stärkung der Hauptachsen Stärkung der Hauptachsen und Knoten und damit der Leistungsfähigkeit des Gesamtnetzes: 87 Prozent der Mittel gehen in großräumig bedeutsame Vorhaben. 4. Engpassbeseitigung Beseitigung von Engpässen auf den Hauptachsen, um den Verkehrsfluss im Gesamtnetz zu optimieren. Rund 2.000 Kilometer Engpässe auf Autobahnen und rund 800 Kilometer Engpässe auf Schienenstrecken werden beseitigt. 5. Breite Öffentlichkeitsbeteiligung Erstmals konnten sich Bürgerinnen und Bürger am BVWP beteiligen – von der Grundkonzeption über Projektvorschläge bis zum Entwurf, der sechs Wochen öffentlich auslag. Die Stellungnahmen sind im Bericht zur Beteiligung zusammengefasst. Den Bundesverkehrswegeplan flankieren die Ausbaugesetze für Schiene, Straße und Wasserstraße. Die drei Gesetze bilden dann die Grundlage für die Finanzierung und Realisierung der Verkehrsprojekte im Bundesverkehrswegeplan. |
||||||
|
||||||
|
http://www.hl-live.de/aktuell/textstart.php?id=107433
Copyright HL live
der 22. Juni 2016
http://www.bundesverkehrsportal.de/berlin/6-berlin/ferlemann-naechste-stufe-der-wsv-reform-startet-neue-revierbezogene-aemterstruktur-der-wsv-steht-fest.html
Wir beabsichtigen in der neuen Wahlperiode wieder regelmäßig und zeitnah über die Arbeit im HPR zu berichten. Neben den regelmäßigen Informationen in dieser Form möchten wir auf unseren INTRANET-Auftritt verweisen, der sich gegenwärtig auch in einer grundlegenden Aktualisierung und Modernisierung befindet. Da dies einen erheblichen zeitlichen Aufwand erfordert, bitten wir um Verständnis, dass noch nicht alles geschafft werden konnte.Zahlbarmachung und Nachvollziehbarkeit des Entgeltes
Der HPR wurde mit der eingetretenen Problematik wiederholt konfrontiert und hat bereits im März d. J. unseren Minister angeschrieben und ihn aufgefordert ,die Missstände zu beseitigen.
Die Nachvollziehbarkeit hat sich seitdem grundsätzlich nicht verbessert, insbesondere für die unständigen Bezügeanteile.Die Bereitstellung der monatlichen Abrechnungen erfolgt in einigen Fällen erst nach der Auszahlung.
Die zwischenzeitlich ergangene Antwort des Ministers versichert, im Rahmen der Möglichkeiten des Ministeriums für Abhilfe zu sorgen.
Der HPR bleibt weiter mit der Verwaltung im Gespräch um die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Abrechnungen zu verbessern.
Der HPR empfiehlt daher jedem Beschäftigten,der weiterhin berechtigte Zweifel an seinen Abrechnungen hat , einen „Widerspruch dem Grunde nach“ zur Fristwahrung einzulegen! Hintergrud ist die tarifliche Ausschlussfrist von 6 Monaten, nachdem jeglicheForderungen verfallen. Eine generelle Vereinbarung zur Hemmung der Ausschlussfrist wurde mit der Verwaltung erörtert, ist jedoch formal rechtlich nicht möglich.
Dienstvereinbarung zur Nutzung qualifizierter digitaler Signaturen
Die bestehende Dienstvereinbarung galt bisher lediglich für die Anwendung der Vergabe und der elektronischen Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen. Die Einführung der elektronischen Bestellung von Binnenschifferpatentkarten, machte neben redaktionellen Anpassungen, eine Fortschreibung erforderlich. Anlässlich der letzten HPR-Sitzung konnte die DV unterschrieben werden, somit sind die betroffenen Beschäftigten bei ihrer Aufgabenerledigung jetzt geschützt.
IT-Sicherheit im BMVI
–
WAN
Das BMVI beabsichtigt gemeinsam mit dem BSI, ein automatisiertes System zur Erkennung und Analyse von Gefahren zur Verbesserung der IT-Sicherheit einzusetzen. Es handelt sich hierbei um ein spezielles Schadprogramm-Erkennungssystem (SES) gegen zielgerichtete Angriffe aus dem INTERNET, dass bestehende Systeme ergänzen soll. Innerhalb der Regierungsnetze, v.a. IVBB,wird dieses Instrument bereits eingesetzt. Betreiber ist das Netzkompetenzzentrum im DWD.
Alle Beschäftigten des BMVI werden vor Inbetriebnahmedes SES noch gesondert informiert.
Einheiten. Copyright main news
Ämter werden verbandelt
Für den Main bedeutet das: Die bisherigen Wasser- und Schifffahrtsämter Aschaffenburg und Schweinfurt werden zum Revier Main verbandelt. Das ist zuständig ist für den Bereich von Frankfurt bis Bamberg.
Die beiden Ämterstandorte bleiben erhalten, teilt Stephan Momper mit, der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Aschaffenburg. Nicht betroffen, weil von der Reform zunächst ausgenommen, ist das Wasserstraßen-Neubauamt in Aschaffenburg.
Mit Beschäftigten abgestimmt
Die neue Struktur soll es der WSV ermöglichen, »ihre Arbeit vor Ort noch starker auf die Anforderungen des jeweiligen Reviers auszurichten«, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesverkehrsministeriums. Die Einteilung der Reviere sei in enger Abstimmung mit den Beschaftigten erarbeitet worden. Das Aschaffenburger Amt hat rund 390 Leute, das Schweinfurter 370. Den Mitarbeitern wurde zugesichert, dass die Neuausrichtung der WSV sozialverträglich abläuft, wobei sich vor Ort erst einmal nichts ändert. Die Strukturen der Wasser- und Schifffahrtsämter »bleiben zunächst unberührt«, hatte Verkehrsminister Alexander Dobrindt 2014 den Beschäftigten mitgeteilt. Dabei geht es um die Außenbezirke und Bauhöfe, in denen die Arbeit an der Wasserstraße geleistet wird.
Wegen der Reform muss bei der WSV offenbar niemand Angst um seinen Arbeitsplatz haben. Im Gegenteil. Denn seit 2014 baut die Behörde wieder Personal auf, nachdem seit den 1990er-Jahren rund 5000 Stellen gestrichen worden waren. In der Folge kam die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung an die Grenzen ihren Möglichkeiten, wie im 5. Bericht zur Reform im Jahr 2012 geschildert wird: Strategische und konzeptionelle Aufgaben werden zunehmend verdrängt. Das Ziel früherer Reformbemühungen, Effektivität und Effizienz zu steigern, »wurde nicht erreicht«. Festgestellt worden seien hingegen Defizite bei Aufgabenerledigung und Personalausstattung.
Fachkräftemangel in der WSV
Durch den stetigen Personalabbau sei »vor allem die Erledigungsqualität gesunken«. Im Prüfbericht ist auch von Fachkräftemangel in der WSV die Rede. Gesetzliche Regelungen könnten aufgrund der begrenzten Personalressourcen und Arbeitsverdichtung teils nicht oder nicht mehr vollständig und zeitgerecht nachvollzogen werden. Eine zeitnahe Nachbesetzung von Schlüsseldienstposten sei nicht mehr möglich. Es entstünden »Brüche in der Aufgabenerledigung, die zu erheblichen Schwierigkeiten beim Betrieb führen«. Außerdem »fehlen für die zielgerichtete Aufgabenerledigung der WSV auf allen Verwaltungsstufen verbindliche Ziele, Vorgaben und Standards«.
Anlagen sind veraltet
Unterdessen ist die Verwaltung nicht das einzige Problem der Binnenschifffahrt. Denn viele bauliche Anlagen sind veraltet, es besteht großer Investitionsbedarf. Hinzu kommt ein Bedeutungsverlust der Schifffahrt als Verkehrsträger. So ist der Güterumschlag im Maingebiet von 5,92 Millionen Tonnen im Jahr 2006 auf 4,13 Millionen Tonnen im vorigen Jahr gesunken.
Die WSV-Reform steht erst am Anfang. Nun folgt die schwierige Umsetzung bei laufendem Betrieb. Der Zeitplan sieht vor, dass revierbezogene Organisationspläne bis Ende 2016 erstellt werden. Der Betrieb der Dienststellen soll bis Ende 2017 neu geregelt werden. Später kommen weitere Punkte wie Außenbezirke, Bauhöfe und Neubauämter an die Reihe. Ende der Umsetzungsphase: 2025.
Heinz Scheid
Zahlen und Fakten: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) gehört zum Bundesverkehrsministerium. Mit rund 11 000 Beschäftigten ist sie eine der größten Behörden des Bundes. Die WSV wird geleitet von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn, die auch einen Standort in Würzburg hat (früher Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd). Regional zuständig sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter sowie die Wasserstraßen-Neubauämter. Zu den Bundeswasserstraßen zählen rund 7300 Kilometer Binnen- und 23 000 Quadratkilometer Seewasserstraßen.
Bei der WSV-Reform wird aus den Ämtern Aschaffenburg und Schweinfurt eine neue revierbezogene Behörde für den Main von Bamberg bis Frankfurt gebildet. Die bisherigen Dienstsitze bleiben erhalten.
Zum Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg gehören der Bauhof in Aschaffenburg sowie die Außenbezirke Frankfurt, Hanau, Erlenbach und Hasloch. Eine Besonderheit sind die bundeseigenen Wasserkraftwerke Griesheim und Eddersheim.
Zum Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt gehören ein Bauhof in Würzburg sowie die Außenbezirke Gemünden, Marktbreit, Volkach und Haßfurt.
Das Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg bleibt erhalten. Es ist zuständig für Aus- und Neubauvorhaben an Main und Main-Donau-Kanal.
(Heinz Scheid)
Hiller-Ohm: WSA Lübeck wird Stralsund unterstellt
Das Bundesverkehrsministerium hat jetzt die neue Ämterstruktur der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) festgelegt. Die derzeit 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter (WSÄ) werden zu 17 Revieren zusammengeführt, wobei alle Standorte der jetzigen Ämter erhalten bleiben. Während die Nordsee in drei Reviere unterteilt wird, ist die gesamte Ostsee zu einem Revier zusammengefasst. Dessen Hauptsitz soll Stralsund – und nicht das WSA Lübeck – erhalten.
Dazu erklärt die Lübecker Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm (SPD):
(„)Ich bedauere die Entscheidungen des Bundesverkehrsministeriums. Mir bleibt unverständlich, warum ein Revier künftig die gesamte Ostsee umfasst, während die Nordsee in gleich drei Reviere – Ems-Nordsee, Weser-Jade-Nordsee und Elbe-Nordsee – unterteilt wird. Denn Nord- und Ostsee haben nahezu die gleiche Reviergröße. Das Schiffsverkehrsaufkommen in beiden Revieren unterscheidet sich kaum. Und durch den Baustellenverkehr des geplanten Belttunnels wird die Ostsee die Nordsee sogar deutlich überholen. Ein zweites Ostseerevier wäre deshalb notwendig und sinnvoll.
Zudem ist sehr bedauerlich, dass CSU-Verkehrsminister Dobrindt bei der Auswahl des Hauptsitzes des einzigen Ostseereviers nicht auf die vorgetragenen sachlichen Argumente eingegangen ist, die eindeutig für einen Hauptsitz in Lübeck sprechen: Das WSA Lübeck ist größer als das Amt in Stralsund und liegt deutlich zentraler an der 1.600 Kilometer langen deutschen Ostseeküste, die von Flensburg bis an die polnische Grenze reicht. Lübeck ist als größter deutscher Ostseehafen führende Verkehrsdrehscheibe und Kernhafen im Transeuropäischen Netz der EU. Zudem ist die Trave eine der wichtigsten Bundeswasserstraßen, Travemünde verfügt über eine hochmoderne Verkehrszentrale.
Dank des hartnäckigen Einsatzes der SPD wird es im Zuge der WSV-Reform keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das ist gut für die Beschäftigten – auch am Standort Lübeck. Das WSA Lübeck muss auch künftig eine starke Rolle im Ostseerevier innehaben.
Die WSV wird nun die Einrichtung aller revierbezogenen Ämter bundesweit vorbereiten. Dies soll unter Einbindung der Revierverantwortlichen und der Beschäftigten erfolgen. Dazu sollen drei Pilotreviere ausgewählt werden, die als erste Feinstrukturen erarbeiten und damit Vorreiter für die künftige Ämterstruktur aller Reviere wären. Diese Rolle wäre für das neue große Ostseerevier wünschenswert und mit Sicherheit auch positiv für den Standort Lübeck.(„)
http://www.bundesverkehrsportal.de/berlin/6-berlin/ferlemann-naechste-stufe-der-wsv-reform-startet-neue-revierbezogene-aemterstruktur-der-wsv-steht-fest.html
|
http://www.nok21.de/2016/06/12/0914-wv-reform-teil-2/
09/14 WSV Reform
http://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/726969/knapp-40-000-burgereingaben-zum-bundesverkehrswegeplan
Copyright NOZ
Verabschiedung im Kabinett Knapp 40.000 Bürgereingaben zum Bundesverkehrswegeplan
Es seien jeweils etwa 20.000 Stellungnahmen via Internet und per Post eingetroffen, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe . Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei dem Projekt sei „ein großer Erfolg“.
Gesamtsumme: 264,5 Milliarden Euro
Bürger konnten bis zum 3. Mai knapp sechs Wochen lang Eingaben zu den vorgesehenen Infrastrukturprojekten machen. „Die Stellungnahmen werden nun geprüft und ausgewertet“, sagte Dobrindt. Anschließend soll der Entwurf für den Bundesverkehrswegeplan überarbeitet und dem Bericht zufolge im Juli vom Bundeskabinett beschlossen werden. Insgesamt enthält der bisherige Entwurf rund 1000 Projekte mit einer Gesamtsumme von 264,5 Milliarden Euro.
. Insgesamt bündelt der Plan 1000 Projekte in allen Bundesländern. ( Weiterlesen: Bund investiert Milliarden in Verkehrsnetz )
„Engpässe“ sollen beseitigt werden
Etwa die Hälfte des Geldes entfallen nach Angaben des Verkehrsministeriums auf die Straße, 41,3 Prozent auf die Schiene und 9,3 Prozent auf Wasserstraßen. Mehr als zwei Drittel sind für den Erhalt von bereits vorhandenen Verkehrsstrecken vorgesehen. Außerdem sollen „Engpässe“ mit einer Gesamtlänge von 1700 Kilometern auf Autobahnen und 700 Kilometern auf der Schiene beseitigt werden.
http://www.derwesten.de/politik/erst-reden-dann-bauen-aimp-id11906986.html
Copyright der Westen
Mehr als 260 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren für die Investitionen ausgegeben werden – das sind 91 Milliarden Euro mehr als im Plan 2003. 130 Milliarden Euro sind für Straßen vorgesehen, fast 110 Milliarden Euro fließen in Schienenwege, der Rest ist für Wasserstraßen bestimmt. Zwei Drittel des Geldes steckt der Bund in den Erhalt der Infrastruktur. Der Entwurf des Verkehrswegeplans 2030 soll Ende Juli vom Kabinett beschlossen werden.
Erst reden, dann bauen | WAZ.de – Lesen Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/politik/erst-reden-dann-bauen-aimp-id11906986.html#plx2106297218








 https://www.wiwo.de/unternehmen/handel/suezkanal-panamakanal-und-co-das-sind-die-wichtigsten-wasserstrassen-der-welt/27044478.html?xing_share=news
https://www.wiwo.de/unternehmen/handel/suezkanal-panamakanal-und-co-das-sind-die-wichtigsten-wasserstrassen-der-welt/27044478.html?xing_share=news
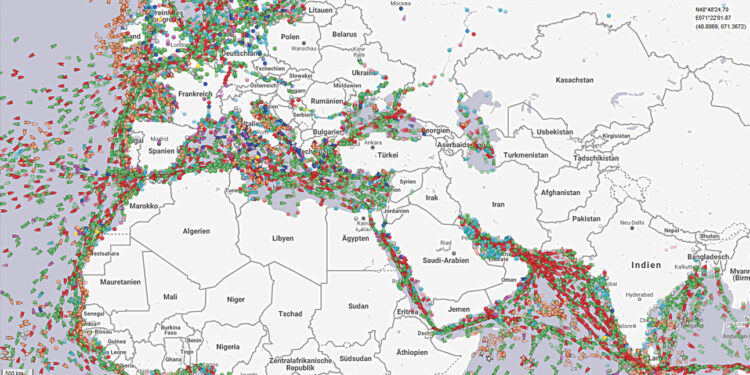

















































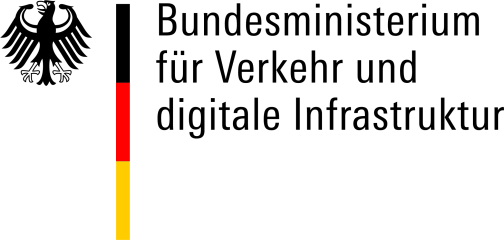























Ein Gedanke zu „09/14 WSV Reform Teil 3 Scheuer BMVI GDSW Verwaltung der Wasserstraßen fehlen Fachkräfte Berlin“
Auf der Schleusenbaustelle geht es seit geraumer Zeit langsamer voran als gedacht. Nun ist es
offiziell: Bis Ende 2020 lässt sich die fünfte Schleusenkammer nicht fertigstellen. Foto: Wasser-
und Schifffahrtsamt Bild vergrößern
Der vom Bundesverkehrsministerium angepeilte Eröffnungstermin für die fünfte Schleusenkammer
ist passé: Ende 2020 sollte eigentlich das erste Schiff durch die neue Schleuse fahren – dieser
Termin lässt sich offiziell nicht mehr halten. Hauptgrund für die Verzögerung von derzeit mehreren
Monaten sei die „Schlickbaggerung unter Kampfmittelverdacht“, wie das Verfahren offiziell heißt.
Mehr dazu in unserer Ausgabe am Mittwoch.