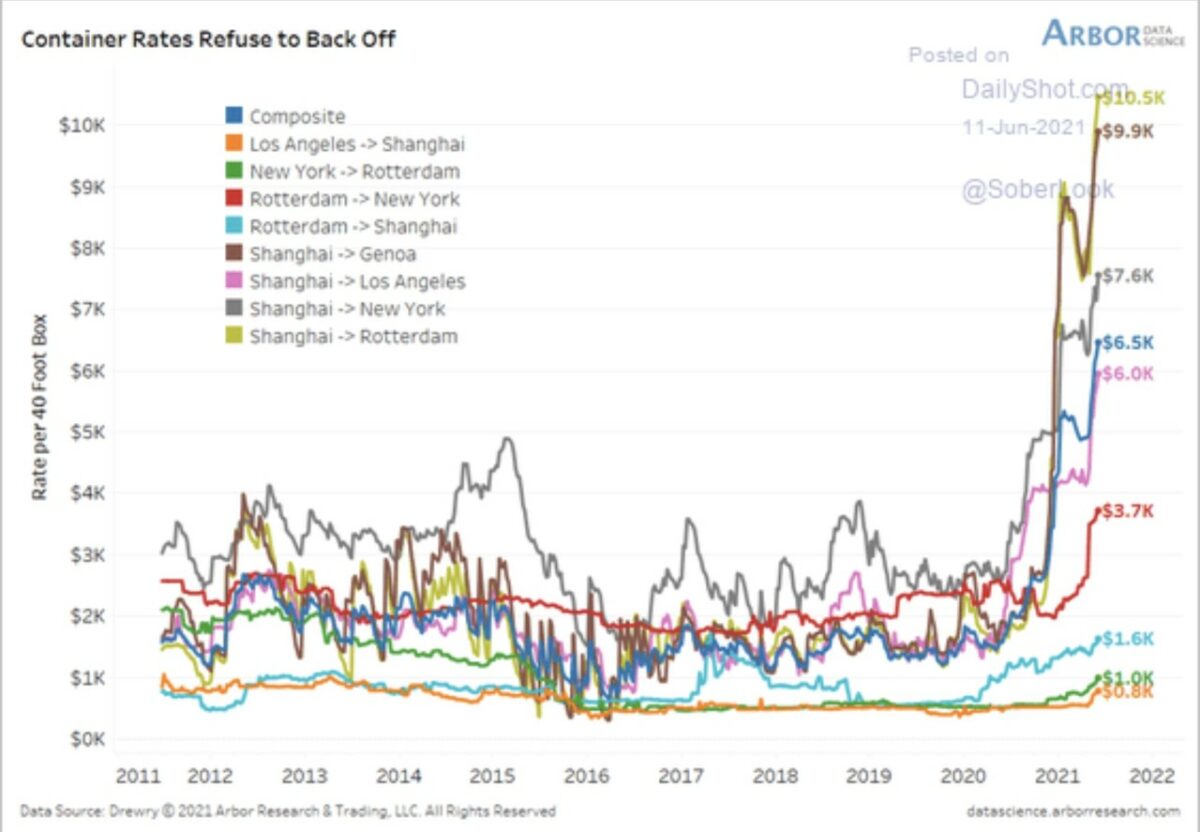Deutschlands Seehäfen und warum sie so wichtig sind
20. März 2024 | Quelle: dpa
Die deutschen Häfen sollen mit einer Hafenstrategie gestärkt werden. Quelle: dpa
Die deutschen Häfen sollen mit einer Hafenstrategie gestärkt werden.
Bild: dpa
60 Prozent des Außenhandels laufen über die deutschen Seehäfen. Die Küstenländer finden deshalb, dass sich der Bund deutlich mehr an der nationalen Aufgabe Hafen beteiligen muss.
Der gesamtdeutsche Außenhandel läuft in großen Teilen über die Seehäfen der Nord- und Ostsee sowie über Hamburg mit dem größten Hafen des Landes. Obwohl es ganz Deutschland betrifft, liegt die Zuständigkeit für die sehr teure Infrastruktur allein bei den Ländern. Das finden die ungerecht. Die Bundesregierung will nun ihre nationale Hafenstrategie beschließen. Ob es damit besser wird? Der aktuelle Zustand:
Warum sind die deutschen Häfen so wichtig für das Land?
Ohne die deutschen Häfen dürfte einerseits die exportorientierte Wirtschaft in weiten Teilen kollabieren, andererseits müsste die Bevölkerung auf zahlreiche auch lebensnotwendige Waren verzichten, mindestens aber deutlich mehr bezahlen. Deutschland wickelt rund 60 Prozent seines Im- und Exports über den Seeweg ab.
Im vergangenen Jahr waren dies nach Angaben des Statistischen Bundesamts rund 267,8 Millionen Tonnen Güter, darunter Energie, Lebensmittel, Kleidung, Technik und Medikamente. Im Vergleich zu 2022 ging der deutsche Außenhandel im vergangenen Jahr wegen der schwierigen geopolitischen Lage und der schwachen Dynamik des Welthandels zurück – beim Export um 2,0 Prozent und beim Import um 10,1 Prozent, wie die Statistiker feststellten.
Hapag Lloyd und Maersk: Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg
Hapag Lloyd und Maersk
Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg
Die Hamburger Reederei will mit seinem dänischen Konkurrenten Maersk in einer neuen Allianz zusammenarbeiten. Verlierer ist vor allem der Hamburger Hafen.
von Artur Lebedew
Was sind überhaupt die wichtigsten Häfen in Deutschland?
Der mit Abstand größte und wichtigste Hafen des Landes liegt in Hamburg. In ihm wurden nach Angaben der Statistiker im vergangenen Jahr mit 99,6 Millionen Tonnen so viele Waren umgeschlagen wie in allen anderen relevanten Seehäfen Deutschlands zusammen. Danach folgte Bremerhaven mit 39,2 Millionen Tonnen, Wilhelmshaven in Niedersachsen mit 29,8 Millionen Tonnen und Rostock in Mecklenburg-Vorpommern mit 23,9 Millionen Tonnen.
Wie stehen die deutschen Häfen im europäischen Vergleich da?
Geht so. Die mit Abstand größten Häfen der sogenannten Nordrange – sie bezeichnet die wichtigsten kontinentaleuropäischen Häfen an der Nordsee, über die etwa 80 Prozent des europäischen Im- und Exports abgewickelt werden – sind Rotterdam in den Niederlanden und Antwerpen-Brügge in Belgien. Auch sie mussten beim Seegüterumschlag im Vergleich zu 2022 einen Rückgang um 6,1 beziehungsweise 5,5 Prozent hinnehmen, liegen aber deutlich vor Hamburg als Nummer drei. Gut ablesbar ist das auch am Containerumschlag: Während in Hamburg im vergangenen Jahr 7,7 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Kaikanten gingen – der schlechteste Wert seit 2009 – waren es in Rotterdam 13,4 Millionen TEU und in Antwerpen-Brügge rund 12,5 Millionen TEU.
Wie steht es um die deutsche Handelsflotte?
Eigentlich ganz gut. Nach Angaben des Deutschen Reederverbands liegt Deutschland bei der Containerschifffahrt weltweit auf Platz eins – noch vor China. Deutscher Branchenprimus ist dabei die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Mit 266 Containerschiffen, einem Transportvolumen von jährlich 11,9 Millionen TEU und 16 300 Beschäftigten ist sie die derzeit fünftgrößte Reederei der Welt. Vor ihr liegen MSC (Schweiz), Maersk (Dänemark), CMA CGM (Frankreich) und Cosco (China). Die gesamte Handelsflotte Deutschlands umfasste laut Reederverband im vergangenen Jahr 1800 Schiffe, womit Deutschland weiterhin die siebtgrößte Schifffahrtsnation der Welt ist. Die ersten drei Plätze belegen Griechenland, China und Japan.
Wo ist also das Problem?
Reedereien klagen vor allem über hohe Kosten in deutschen Häfen, über den Automatisierungsgrad der Terminals und das Abfertigungstempo. In Hamburg behindert zudem die in die Jahre gekommene Köhlbrandbrücke die Erreichbarkeit einzelner Terminals mit besonders großen Containerfrachtern. Hinzu kommt, dass einzelne Reedereien ihr Flottenmanagement ändern und ihre Schiffe die Häfen nicht mehr wie an einer Perlenkette anlaufen lassen. Stattdessen steuern sie verstärkt von ihnen selbst definierte Knotenpunkte an – in der Regel Häfen und Terminals, an denen sie selbst beteiligt sind – und verteilen die Waren von dort auf kleineren Schiffen weiter. Deutsche Häfen müssen dabei nicht zwangsläufig zum Zuge kommen.
Hamburger Hafen: Hamburg muss sich fragen, ob sein Hafen wirklich so wichtig ist
Hamburger Hafen
Hamburg muss sich fragen, ob sein Hafen wirklich so wichtig ist
Der Hamburger Hafen will sich mit der Reederei MSC zusammentun. Es ist ein längst überfälliger Schritt – und bringt für sich allein dennoch wenig. Ein Kommentar.
von Konrad Fischer
Was wollen die deutschen Häfen?
Die Häfen für die Zukunft zu rüsten und vor allem auf eine Klimaneutralität vorzubereiten, ist extrem teuer, beispielsweise allein der Ersatz der Hamburger Köhlbrandbrücke wird derzeit auf rund 4,5 bis 5 Milliarden Euro taxiert. Die Hafenwirtschaft und die Küstenländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern fordern deshalb vom Bund seit Langem eine deutliche Aufstockung der Bundesmittel zur Finanzierung der Seehäfen. Allein für die Infrastruktur fallen demnach pro Jahr aufgrund gestiegener Kosten 400 Millionen Euro an. Bislang zahlt der Bund lediglich 38 Millionen Euro pro Jahr für alle Häfen zusammen.
Welche Zukunftsaufgaben kommen auf die Häfen zu?
Die Hafenwirtschaft weist darauf hin, dass die Häfen für den per Gesetz vorgesehenen Ausbau der erneuerbaren Energien dringend erweitert werden müssen. „Für das Erreichen dieser Ausbauziele fehlt es in Europa in den Häfen an Umschlagkapazität für Windenergie”, hieß es zuletzt beim Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) „Das gilt insbesondere für Deutschland, wo seit Jahren nicht in den Ausbau der nötigen Schwerlastflächen investiert wurde.” Das Problem betrifft insbesondere die Windkraft auf See, da die Turbinen hier besonders groß und schwer sind und oft auch in den Häfen vormontiert werden müssen. „Ohne mehr Flächen in den Häfen, kein erfolgreicher Ausbau der Windenergie und keine erfolgreiche Energiewende”, so der ZDS.
Aus Sicht der Windkraftbranche sind bis zu 200 Hektar zusätzliche Schwerlastflächen in den deutschen Seehäfen nötig. „Das entspricht der Fläche eines Parkplatzes mit 260 000 Pkws oder 270 Fußballfeldern”, hat die Stiftung Offshore-Windenergie vorgerechnet. Die Windenergie auf See soll bis 2045 von derzeit 8,4 auf 70 Gigawatt Leistung ausgebaut und damit ein Rückgrat der Energiewende werden. Das bedeutet Tausende neue Windräder. Die Stiftung sieht die Seehäfen als die zentralen Drehkreuze für Ausbau und Betrieb: „Ob als Basishäfen für den Bau und den späteren Rückbau der Windparks, als Servicehäfen für den Betrieb und auch die Wartung, als Lagerplatz oder als Produktionsstandort – sie nehmen vielfältige Funktionen im Bereich der Offshore-Windenergie ein.”
Was ärgert die Küstenländer?
Salopp gesagt kritisieren sie, dass der Bund immer noch nicht die Bedeutung der Seehäfen für das gesamte Land verstanden habe. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte zuletzt: „Die geringe Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte passt bei Weitem nicht zur großen Bedeutung der deutschen Seehäfen.” Angesichts des erheblichen Stellenwerts für die deutsche Volkswirtschaft, für den Industriestandort, für Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und Einbindung in den weltweiten Handel vermisse sie ein größeres Engagement des Bundes. Die Hafenwirtschaft verweist oft auf Rotterdam und Antwerpen, wo der Wille und finanzielle Einsatz zur Modernisierung der Häfen deutlich größer seien und als nationale Aufgabe verstanden würden.
Gehälter „In Unternehmen macht sich eine Vollkaskomentalität breit“
Aktien Fünf gefallene Börsenstars mit der Hoffnung auf ein Comeback
Baufinanzierung Sollte ich auch günstige Kredite schnell tilgen?
Weitere Plus-Artikel lesen Sie hier
Was macht der Bund?
Bislang gibt sich der Bund in der Frage einer stärkeren finanziellen Beteiligung an Betrieb und Unterhalt der Häfen zurückhaltend. Das Bundesverkehrsministerium verwies zuletzt auf die Zuständigkeit der Länder bei der Hafeninfrastruktur. Gleichzeitig betonte es, dass die Bundesregierung im engen Dialog mit den Ländern stehe, „um tragfähige Lösungen für eine angemessene Beteiligung des Bundes an den Kosten der Länder zu erreichen”. Antworten könnte auch die Hafenstrategie der Ampelkoalition geben, die das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Darin sind nach Ministeriumsangaben mehr als 130 Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern definiert. Ursprünglich sollte die Strategie bereits im Herbst vorliegen.
Lesen Sie auch: Warum Tanker-Aktien jetzt spannend sind
Schlag für die weltweiten Lieferketten: Der Brückeneinsturz in Baltimore unterbricht eine wichtige Handelsroute
Der Hafen von Baltimore ist in den USA eine Drehscheibe für Autos und Kohle. Containerschiffe können auf Häfen in New York oder Virginia ausweichen.
Christoph Eisenring
27.03.2024, 12.35 Uhr 3 min Artikel unten
Ein Hingucker: Kurioser Containerriese erstmals in Hamburg
28.03.2024, 09:24 Uhr • Lesezeit: 3 Minuten
Martin Kopp
Von Martin Kopp
Guenther Goettling NOK21.de Facebook mit Bildern
Das weltweit erste große Methanol-Containerschiff, die „Ane Maersk“ der Reederei Maersk, legt am Eurogate-Containerterminal im Hamburger Hafen an. Die „Ane Maersk“ wurde bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea gebaut und fasst mehr als 16.000 Standardcontainer.
Das weltweit erste große Methanol-Containerschiff, die „Ane Maersk“ der Reederei Maersk, legt am Eurogate-Containerterminal im Hamburger Hafen an. Die „Ane Maersk“ wurde bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea gebaut und fasst mehr als 16.000 Standardcontainer. © DPA Images | Axel Heimken
Hamburg. Der Koloss der Reederei Maersk fährt mit Methanol – als erstes Schiff weltweit in dieser Größe. Das Design ist daher ungewöhnlich.
Schifffahrt
Methanol-Containerschiff von Maersk legt erstmals in Hamburg an
Die Container-Schifffahrt ist auf der Suche nach klimaverträglichen Treibstoffen. Ein Hoffnungsträger: grünes Methanol. Die „Ane Maersk“ ist nun zum ersten Mal in Hamburg eingelaufen.
28.03.2024 – 09:19 Uhr
„Ane Maersk“ am Eurogate-Containerterminal im Hamburger Hafen: Das Schiff wird mit sogenanntem grünen Methanol betrieben. Foto: dpa
Hamburg. Es ist hellblau, 350 Meter lang und steht für eine emissionsärmere Schifffahrt: Das methanolbetriebene Containerschiff „Ane Maersk“ ist am frühen Donnerstagmorgen zum ersten Mal in den Hamburger Hafen eingelaufen. Es ist das erste große, methanolfähige Containerschiff der dänischen Reederei Maersk und fasst mehr als 16 000 Standardcontainer (TEU).
In den kommenden beiden Jahren will Maersk noch 17 weitere Containerschiffe dieser Größe in Betrieb nehmen, die mit sogenanntem grünem Methanol betrieben werden.
Grünes Methanol ist nahezu CO2-neutral und gilt als aussichtsreicher Treibstoff, um fossile Treibstoffe wie Schiffsdiesel oder Schweröl zu ersetzen. Die Produktion von grünem Methanol benötigt allerdings viel Strom aus erneuerbaren Quellen, weshalb der Treibstoff noch knapp ist.
Im September 2023 hatte das Unternehmen die kleinere „Laura Maersk“ getauft, nach Angaben der Reederei das weltweit erste methanolfähige Containerschiff.
Die große Schwester „Ane Maersk“ hatte Anfang Februar als erste aus der größeren Schiffsreihe die Fahrt angetreten. Gebaut wurde sie bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea. Künftig soll „Ane“ zwischen Asien und Europa verkehren. Die Route mit Start in Ningbo in China und Durchfahrt durch den Suezkanal verbindet asiatische mit europäischen Häfen, darunter den größten deutschen Seehafen in Hamburg.
» Lesen Sie auch: Vom Dünger zum Energieträger – So soll Ammoniak die Energiewende beschleunigen
Die Schiffe der neuen Serie fallen auf, weil die Brücke ganz vorn platziert ist. Nach Angaben von Maersk soll das eine höhere Ladekapazität und so einen brennstoffeffizienteren Betrieb gewährleisten. Durch die Verwendung von Methanol als Treibstoff soll die „Ane Maersk“ nach Angaben der Reederei täglich bis zu 280 Tonnen CO2 einsparen – im Vergleich zu einem gleich großen Schiff, das mit einem fossilen Brennstoff fährt.
Verwandte Themen
Schlag für die weltweiten Lieferketten: Der Brückeneinsturz in Baltimore unterbricht eine wichtige Handelsroute
Der Hafen von Baltimore ist in den USA eine Drehscheibe für Autos und Kohle. Containerschiffe können auf Häfen in New York oder Virginia ausweichen.
Christoph Eisenring
27.03.2024, 12.35 Uhr 3 min
Das Containerschiff hat den Grossteil der Brücke zerstört. Links im Hintergrund Teile des Hafens von Baltimore.
Das Containerschiff hat den Grossteil der Brücke zerstört. Links im Hintergrund Teile des Hafens von Baltimore.
David Tulis / Imago
Das Stahlgerippe wirkt nach dem Einsturz der Key-Brücke in Baltimore wie ein Riegel, der jeglichen Verkehr vom und zum Hafen blockiert – und das für mehrere Wochen. Der Kollaps fällt in eine Zeit, in der die globalen Lieferketten bereits angespannt sind. Da sind zum einen die Angriffe der Huthi auf Schiffe im Roten Meer, was die Route durch den Suezkanal beeinträchtigt. Zum anderen hatte Niedrigwasser während Monaten die Durchfahrt des Panamakanals erschwert.
Über den Hafen von Baltimore wurden letztes Jahr 52 Millionen Tonnen Güter im Wert von 80 Milliarden Dollar transportiert. Zum Vergleich: Die Rheinhäfen in Basel kommen auf rund 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Baltimore gehört bei den Importen zu den zehn wichtigsten Häfen in den USA.
Grösster Hafen für Autos
Es gibt dabei besonders zwei Güter, die hervorstechen: Kohle und Autos. Baltimore ist der zweitwichtigste Hafen für das Verladen von amerikanischer Kohle, die nach Europa, Indien und China geliefert wird. Ein Viertel des gesamten Exportvolumens an Kohle läuft über die Docks der grössten Stadt im Gliedstaat Maryland, die sich eine Autostunde entfernt von Washington (DC) befindet. Allein nächste Woche hätten zwölf grosse Frachtschiffe mit Kohle den Hafen verlassen sollen. Der grösste Abnehmer ist dabei Indien, wo die Kohle in thermischen Kraftwerken in Elektrizität umgewandelt wird.
Der Einfluss auf den Weltmarktpreis für Kohle dürfte dennoch beschränkt bleiben, weil über Baltimore nur zwei Prozent der weltweit verschifften Kohle transportiert werden.
Ursache für das Desaster vom Montag auf Dienstag war wohl ein Stromausfall beim Containerschiff «Dali», das für den dänischen Reeder Maersk unterwegs war. 40 Containerschiffe sind derzeit im Hafen blockiert, 30 weitere hatten ursprünglich in Baltimore einlaufen wollen.
Trotzdem ist Baltimore für die Containerschifffahrt keine zentrale Destination. Die Ostküste weist mit New York-New Jersey, Norfolk (Virginia) oder Savannah (Georgia) diverse grosse Häfen auf, die einen guten Teil der Fracht von Baltimore übernehmen können. Die Umleitung könnte jedoch zu Verzögerungen an diesen Häfen und zu Engpässen bei den Lagern führen, schreibt die Beratungsfirma Container xChange.
Nicht ganz so einfach, Ersatz zu finden, ist es für Schiffe, die Autos geladen haben, weil es hierfür eine spezielle Infrastruktur braucht. Die Schiffe sind so gebaut, dass man die Fahrzeuge in den Schiffsbauch fährt und beim Zielhafen dann wieder hinausfährt. Über diese RoRo-Schiffe, abgeleitet vom englischen «roll on – roll off», wurden durch den Hafen von Baltimore letztes Jahr 850 000 Autos und Lieferwagen transportiert.
Um die RoRo-Schiffe gibt es eine ganze Infrastruktur, man denke an riesige Abstellplätze sowie Hunderte Transportfahrzeuge, die verfügbar sein müssen. Grosse Nutzer der Kapazitäten in Baltimore sind Mazda, Mercedes und Subaru. Eine Alternative zu Baltimore ist der Hafen von Brunswick im südlichen Gliedstaat Georgia, der derzeit gerade für RoRo-Schiffe ausgebaut wird und Baltimore in diesem Bereich überholen will.
In Genua dauerte es zwei Jahre
Die Lieferketten werden durch die Blockade des Hafens zwar gestört. Der Effekt ist aber deutlich weniger gravierend als während der Corona-Pandemie. Die Unternehmen geben zudem an, sie hätten aus der damaligen Krise gelernt und mehr Reserven eingebaut.
Die Auswirkungen hängen natürlich davon ab, wie lange es dauert, bis die Schiffe den Hafen wieder ansteuern können. Hier ist von bis zu sechs Wochen die Rede.
Die Brücke soll zudem wieder aufgebaut werden. Das hat Präsident Joe Biden am Dienstag versprochen. Wer mit dem Auto von Washington nach New York via Baltimore fährt, den leitet das Navi aber meist nicht über die Brücke, sondern zu zwei Tunnels, die schon vor dem Kollaps die Hauptlast des Verkehrs trugen.
Die Brücke wurde besonders auch von Lastwagen mit Gefahrengut benutzt, die nun einen längeren Umweg in Kauf nehmen müssen. Täglich 34 000 Fahrzeuge müssen nun einen anderen Weg finden.
Schwierig zu schätzen ist die Bauzeit für eine neue, über 2,5 Kilometer lange Brücke. Experten erinnern an den Brückenkollaps in Genua im Jahr 2018. Auch die damalige Morandi-Brücke hatte vier Fahrspuren. Dort dauerte es zwei Jahre, bis das neue Bauwerk dem Verkehr übergeben werden konnte. In Baltimore geht man von einer ähnlichen Zeitspanne aus.
Passend zum Artikel
Laut Angaben der Feuerwehr gegenüber BBC sind bis zu zwanzig Personen ins Wasser gestürzt. (Jim Lo Scalzo / EPA)
Containerschiff rammt Brücke in US-Stadt Baltimore: Einsatzkräfte bergen zwei Leichen
28.03.2024 5 min
Containerschifffahrt: In den 60ern begann eine neue Ära
Stand: 28.03.2024 10:45 Uhr
Am 31. Mai 1968 startet der Hamburger Hafen in ein neues Zeitalter: Mit der „American Lancer“ legt erstmals ein Vollcontainerschiff an. Die eckigen Kisten an Bord revolutionieren Schifffahrt, Hafenarbeit und weltweiten Handel.
Feuerlöschboote begrüßen das 213 Meter lange Schiff auf der Elbe mit meterhohen Wasserfontänen, an Land heißt Hamburgs Wirtschaftssenator Helmuth Kern den Kapitän der „American Lancer“ persönlich willkommen. Um 21 Uhr des 31. Mai 1968 bricht am Burchardkai die Ära der Containerschifffahrt an.
Burchardkai: Erste Spezialanlage im Hamburger Hafen
Bereits im November 1966 ging dort eine erste Spezialanlage für den Containerumschlag in Betrieb, 1967 folgte die erste Containerbrücke. Mit der „American Lancer“ beginnt jetzt eine rasante Entwicklung: Immer mehr und immer größere Vollcontainerschiffe machen in Hamburg fest. Das Terminal am Burchardkai wird fortlaufend erweitert und entwickelt sich rasch zur größten Umschlagsanlage im Hafen.
Ein 40-Fuß-Container der ersten Hapag-Lloyd-Bauserie. 12 Bilder
Eine Stahlkiste erobert die deutschen Häfen
Container: schnell und günstig
Schneller als von vielen erwartet löst die Containerschifffahrt die konventionelle Frachtschifffahrt ab. Denn der Containertransport hat viele Vorteile: Liegen die bisherigen Frachtschiffe oftmals mehrere Tage zum Be- und Entladen im Hafen, ist es bei den Containerschiffen nur noch eine Sache von Stunden – das spart Zeit und Geld. Stückgutfrachter wie das heutige Museumsschiff Cap San Diego verschwinden nach und nach aus dem Schiffsverkehr.
Herausforderung für Reedereien und Häfen
Das neue Transportsystem stellt Schifffahrt und Hafenindustrie vor große Herausforderungen. Tausende traditionelle Arbeitsplätze für Hafenarbeiter gehen verloren.
Malcolm McLean: Erfinder des Containers
Mehr anzeigen
Die Hafeninfrastruktur muss komplett umgestellt, spezielle Verladebrücken, Kräne und hochbeinige Förderfahrzeuge angeschafft werden. Kaianlagen werden ausgebaut und direkte Anschlüsse für Bahn und Lkw gelegt – darunter auch der neue Elbtunnel und die Köhlbrandbrücke. Beide Bauwerke werden 1974 fertiggestellt.
Hapag und Lloyd schließen sich zusammen
Auch die Reedereien müssen sich neu organisieren. Sie müssen in großem Stil investieren und neue Schiffe anschaffen. Zugleich ist der Markt hart umkämpft, da die Containerschiffe immer größer werden, sodass weniger Reedereien benötigt werden. Die Containerschifffahrt zwingt auch die beiden großen deutschen Reedereien Hapag und Lloyd dazu, sich zusammenzuschließen. Im September 1970 fusionieren die Konkurrenten zur Hapag-Lloyd AG.
Spezialcontainer für verschiedene Warengruppen
Größer, schneller, effektiver: Dieser Trend bestimmt die Containerschifffahrt von Beginn an. Berechnet wird die Ladekapazität der Containerschiffe in TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).
Der Standardcontainer TEU
Mehr anzeigen
Ein TEU entspricht dabei einem Standardcontainer von rund 20 Fuß beziehungsweise etwa 6 Metern Länge und 2,5 Metern Breite. Die Standardcontainer werden vor allem für schwere Güter wie Motoren oder Transformatoren genutzt und dürfen ein maximales Gesamtgewicht von 24 Tonnen nicht überschreiten.
Der doppelt so lange 40-Fuß-Container FEU (Fourty-foot Equivalent) darf bis zu 30 Tonnen wiegen und wird für Textilien und voluminöse Güter genutzt. Für den Transport von Lebensmitteln wie Bananen, Zitrusfrüchten, Fleisch oder Milchprodukten werden spezielle Kühlcontainer entwickelt.
Containerschiffe – Boom der Riesenpötte
Im Laufe der Jahre werden die Schiffe immer größer, vor allem aber steigt durch moderne Schiffbautechnik ihre Ladekapazität. Zum Vergleich: Transportiert die „American Lancer“ noch maximal 1.200 TEU, werden ab Ende der 1980er-Jahre Schiffe mit 4.500 TEU gebaut. Sie sind bereits so groß, dass sie nicht mehr durch den Panama-Kanal fahren können. Die momentan größten Containerschiffe der Welt (Stand: 3/2024) stammen aus einer mehrere Schiffe umfassenden Serie. Für die Linienreederei Mediterranean Shipping Company (MSC) ist unter anderem die „MSC Irina“ im Einsatz. Das Schiff ist 61 Meter breit und hat eine Länge von knapp 400 Metern. Es ist also nicht einmal doppelt so groß wie die „American Lancer“, kann aber mehr als das 20-Fache an Ladung aufnehmen. Genau sind es 24.346 Standardcontainer. Zu der Serie zählen auch die baugleichen „MSC Loreto“, „MSC Michel Cappellini“ und „MSC Mariella“.
Die Riesenpötte rechnen sich, denn sie benötigen kaum eine größere Besatzung als kleinere Schiffe und der Treibstoffverbrauch liegt nur wenig höher. Auch im Hamburger Hafen legen die Schiffsgiganten regelmäßig an.
Elbvertiefung: Folge der Containerriesen
Doch der Boom der Containergiganten hat auch Nachteile: Sie sind weniger flexibel, da sie nicht alle Häfen anlaufen können. Auch in Hamburg sorgen die riesigen Schiffe mit ihrem enormen Tiefgang für Probleme. Damit sie den Hafen über die Elbe weiter ansteuern können, werden immer wieder Elbvertiefungen nötig – ein Unding in den Augen von Umweltschützern, die bei jeder Planung versuchen, die Vertiefung mit Klagen zu stoppen. Auch die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen stellt mit ihrer lichten Höhe von 55,3 Metern (bei niedrigst-möglichem Wasserstand) und einer Durchfahrtshöhe von rund 53 Metern ein Hindernis für die ganz großen Containerschiffe dar.
Hoher Anteil an Containern – noch
Rund 70 Prozent des Gesamtumschlags im Hafen der Hansestadt entfallen aktuell auf Container, der Rest auf Massengut wie Kohle, Öl oder Düngemittel. Der Anteil des Umschlags von Containerladung am gesamten Stückgutumschlag, auch als Containerisierungsgrad bezeichnet, liegt im Hamburger Hafen mittlerweile bei fast 99 Prozent.
Pro Jahr werden in Europas drittgrößtem Hafen jährlich lange zwischen acht und neun Millionen Container umgeschlagen, 2023 waren es aber nur 7,7 Millionen. 2022 und 2023 ging der Handel mit China zurück. (Stand 3/2024)
Boom der Containerschifffahrt vor dem Ende?
Lange gingen Experten davon aus, dass der Containerumschlag immer weiter wachsen würde. Tatsächlich stagniert er aber. Studien zufolge ist die große Boomzeit der Containerschifffahrt angeblich bereits vorbei. Demnach stehen wir am Beginn einer neuen Ära: Dank Digitalisierung und 3D-Druck werde künftig voraussichtlich wieder häufiger marktnah, also im Land der Abnehmer, produziert. Wichtiger als Containerschiffe würden deshalb in Zukunft sogenannte Bulker, also Massengutschiffe, die Rohstoffe transportieren.
Auch beim Antrieb geht man inzwischen neue Wege. So wird zum Beispiel die „Ane Maersk“ mit grünem Methanol betrieben. Sie soll deutlich weniger CO2 ausstoßen als herkömmliche Frachter. Das rund 350 Meter lange Schiff kann rund 16.000 Standardcontainer transportieren.
Das Containerschiff „Ane Maersk“ wird in den Hamburger Hafen geschleppt. © Axel Heimken/dpa
Methanol-betriebener Frachter „Ane Maersk“ erstmals in Hamburg
Das Containerschiff kann rund 16.000 Boxen transportieren und soll deutlich weniger CO2 ausstoßen als herkömmliche Frachter.
Das Dreimastvollschiff „Deutschland“ im Dienst der Hapag um 1848 (Gemälde, das sich im Besitz von Hapag-Lloyd befindet – Maler: H. Pollack) © Hapag-Lloyd AG, Hamburg
Seitenblick
Deutschland weiter Nummer 1 bei der Containerschifffahrt
„Wir bereedern aus Deutschland immer noch die weltgrößte Containerschiffsflotte“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, Martin Kröger, gestern in Hamburg. Der deutsche Anteil an der weltweiten Containerflotte liege bei 11,6 Prozent – 10,7 Prozent im Jahr zuvor. Mit knappem Abstand folge China. In Bezug auf die gesamte Handelsflotte liegt Deutschland auf Platz sieben. Insgesamt verfügte die Flotte Ende 2023 über 1800 Schiffe. Das seien zwar knapp 40 Schiffe weniger als 2022. Das sei aber relativ normal, weil die Schiffe immer größer würden, sagte Kröger. Die weltgrößten Schifffahrtsnationen seien Griechenland, China und Japan.
Schifffahrt hält in unruhigen Zeiten klaren Kurs
13.03.2024 10:00 Schifffahrt
Handelsflotte bleibt stabil
Ausbildungszahlen steigen deutlich
Anstrengungen zum Klimaschutz werden intensiviert
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat heute neue Daten zur Situation der deutschen Handelsschifffahrt veröffentlicht. Präsidentin Gaby Bornheim und Hauptgeschäftsführer Martin Kröger konnten trotz eines schwierigen geopolitischen Umfelds für die Schifffahrt über erfreuliche Entwicklungen berichten: Insgesamt hat Deutschland weiterhin die siebtgrößte Handelsflotte der Welt, bei der Containerschifffahrt ist man weltweit sogar führend. Zuletzt haben sich zudem deutlich mehr junge Menschen für eine Ausbildung in der Schifffahrt entschieden.
Geopolitische Konflikte beeinträchtigen den Seehandel
Die Schifffahrt sieht sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die durch Kriege und Konflikte verursacht werden. Das Rote Meer ist derzeit durch den Beschuss von Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe nicht sicher. Hintergrund ist der Konflikt in Nahost. Weite Teile des Schwarzen Meers bleiben durch den Angriff Russlands gegen die Ukraine zudem Kriegs- und Risikogebiet – und damit für die Schifffahrt eine Gefahrenzone. Darüber hinaus nehmen die Spannungen zwischen China und Taiwan und im südchinesischen Meer weiter zu.
„Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen sind beunruhigend. Auch wenn die Schifffahrtsbranche grundsätzlich krisenerprobt ist und flexibel auf neue geopolitische Rahmenbedingungen reagieren kann, sind Stabilität und Sicherheit auf Dauer unverzichtbar. Wenn maritime Lieferketten ständig gestört sind, ist irgendwann unsere Versorgung über See gefährdet“, erklärt VDR-Präsidentin Gaby Bornheim. Deutschland wickelt rund 60 Prozent seines Im- und Exports über den Seeweg ab. Über ihn kommen Energie, Lebensmittel, Kleidung, Technik, Möbel und Medikamente ins Land.
Deutschland bleibt einer der wichtigsten Schifffahrtsstandorte der Welt
„Für Deutschland ist und bleibt es wichtig, eine eigene starke Handelsflotte im Land zu halten. Die vorliegenden Zahlen stimmen uns positiv. Sie unterstreichen, dass die deutsche Handelsflotte stabil bleibt“, sagt VDR-Hauptgeschäftsführer Martin Kröger.
Ende 2023 bestand die deutsche Handelsflotte aus insgesamt 1.800 Schiffen (Vorjahr 1.839 Schiffe) mit einer Bruttoraumzahl (BRZ) von 47 Millionen (Vorjahr 44,8 Mio. BRZ). Damit ist Deutschland weiterhin die siebtgrößte Schifffahrtsnation der Welt. Griechenland, China und Japan belegen in dieser Reihenfolge die ersten drei Plätze. Bei der Containerschifffahrt ist Deutschland weiterhin führend (29 Mio. BRZ), vor China (28,1 Mio. BRZ).
„Die Zahlen zeigen: Deutschland ist nach wie vor eine der wichtigsten Schifffahrtsnationen der Welt und ein starker und wettbewerbsfähiger Schifffahrtsstandort. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, müssen die Rahmenbedingungen für Reedereien in Deutschland attraktiv und stabil gehalten werden“, betont Kröger.
Die Mehrzahl der deutschen Reedereien ist mittelständisch geprägt. 80 Prozent der Unternehmen haben weniger als zehn Schiffe. 881 Schiffe der deutschen Handelsflotte führen die Flagge eines EU-Landes am Heck, darunter 259 die deutsche Flagge, 386 Schiffe die Flagge Portugals, 135 Schiffe die Flagge Zyperns, 41 Schiffe fahren unter der Flagge Maltas und 60 unter der Flagge eines anderen Landes der EU. Damit fährt jedes zweite deutsche Schiff unter der Flagge eines EU-Landes.
Mehr Berufsanfänger starten eine Ausbildung in der Schifffahrt
Auch für die maritime Wirtschaft ist die Nachwuchsgewinnung und der Wettbewerb um junge Talente von existenzieller Bedeutung. Umso erfreulicher ist es, dass die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der Schifffahrt im Ausbildungsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund elf Prozent gestiegen ist. Im letzten Jahr haben 418 junge Leute eine Ausbildung auf See (Vorjahr 377) und 214 an Land (Vorjahr 192) aufgenommen.
„Wir brauchen gut ausgebildete junge Menschen. Sie sind unsere maritime Zukunft. Nur mit ihnen können wir die Schifffahrt am Standort Deutschland zukunftsfest machen und weiter vorantreiben. Es ist großartig, dass immer mehr Jugendliche sich für eine Ausbildung in der Schifffahrt begeistern. Wir werden auch zukünftig daran arbeiten, junge Menschen für maritime Berufe zu gewinnen, denn Schifffahrt ist und bleibt ein attraktiver Arbeitsplatz!“, so VDR-Präsidentin Bornheim.
Schifffahrt auf dem Weg zur Klimaneutralität
Weiterhin gilt es, eine der größten Herausforderungen für die Seeschifffahrt zu meistern: die Transformation zum klimaneutralen Verkehrsträger Schiff bis zum Jahr 2050. Dafür unternimmt die Branche enorme Anstrengungen und Investitionen.
Die EU hat beschlossen, die Schifffahrt ab 2024 mit in das EU-Emissionshandelssystem einzubeziehen. Reedereien müssen damit für den Ausstoß von CO2 innerhalb der EU bezahlen und Rechte für die Emissionen kaufen.
„Wir unterstützen grundsätzlich eine Emissions-Bepreisung, denn sie kann eine wirksame Ergänzung zu mehr Klimaschutz sein“, sagt Martin Kröger. Die Bundesregierung müsse jedoch schnell Klarheit schaffen, wie genau in Deutschland nun die Einbeziehung der Schifffahrt in das Emissionshandelssystem erfolgen soll. Bislang liegt dazu noch kein Gesetzesentwurf vor. „Für uns ist Planungssicherheit das A und O, aber auch international einheitliche Wettbewerbsbedingungen. Wir unterstützen grundsätzlich eine Maßnahme zur Emissions-Bepreisung, die aber international einheitlich geregelt sein sollte. Wir können uns in der weltweit fahrenden Schifffahrt und für einen wirkungsvollen Klimaschutz keinen Flickenteppich regionaler Sonderwege leisten. Und wir wollen auch nicht doppelt für die gleichen Emissionen zahlen“, so der VDR-Hauptgeschäftsführer.
Alle neuen Daten zur deutschen Handelsschifffahrt finden sich unter: https://www.reederverband.de/de/daten-und-fakten-zur-seeschifffahrt-deutschland
Über den Verband Deutscher Reeder
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) vertritt die gemeinsamen wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen der deutschen Reedereien auf der Ebene des Bundes und der Länder sowie gegenüber europäischen und internationalen Instanzen. Der VDR wurde 1907 gegründet und hat sich 1994 mit dem Verband der Deutschen Küstenschiffseigner zusammengeschlossen. Mit rund 150 Mitgliedern vertritt der VDR den größten Teil der deutschen Handelsflotte. Mehr Informationen unter www.reederverband.de
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat heute neue Daten zur Situation der
Panamakanal Kann ein gewagter Plan das Nadelöhr der Schifffahrt retten?
von Jacqueline Goebel
11. Februar 2024
Letzte Kanaletappe: Aus dem Gatúnsee geht es durch die Aqua-Clara-Schleusen Richtung Karibik Quelle: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche
Letzte Kanaletappe: Aus dem Gatúnsee geht es durch die Aqua-Clara-Schleusen Richtung Karibik
Bild: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche
Militärische Überfälle im Roten Meer verunsichern Reeder. Dabei zeichnet sich am Panamakanal, dem Nadelöhr zwischen Atlantik und Pazifik, das viel nachhaltigere Drama ab.
Kilometer 0, die Pazifikküste vor Panama-Stadt. Wenn er wollte, könnte Steve Paton die wartenden Schiffe von seinem Bürogebäude auf der Insel Naos aus zählen. Bis zu 160 Containerschiffe und Tanker stauten sich zuletzt an den Einfahrten im Panamakanal. Jetzt im Januar, sind es noch etwa 60. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Ob sich die Schiffsschlange in den nächsten Wochen wieder vergrößern wird, ob sich Lieferungen dadurch verspäten und in welchen Fabriken deshalb vorübergehend die Bänder stillstehen werden – darüber kann Steve Paton nur spekulieren. Was er hingegen weiß und gut erklären kann: Warum es die Schlange überhaupt gibt – und warum sie in nächster Zeit zu einem wachsenden Problem für den Welthandel wird.
Der Klimaforscher zeigt auf eine zackige Linie auf seinem Monitor, die Entwicklung des Niederschlags am Panamakanal. Die Aufzeichnungen des Smithsonian Tropical Research Institute reichen 98 Jahre zurück. Im Jahr 2023 macht die Linie einen deutlichen Knick: „Der Regenstand liegt 64 Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt“, sagt Paton und zeigt auf den Bildschirm: „2023 war das zweittrockenste Jahr.“ Der Grund ist das Wetterphänomen El Niño, sind veränderte Passatwinde und Wassertemperaturen im Pazifik. Für Panama bedeutet das: wenig Regen in der Regenzeit. „Der Schaden ist angerichtet“, sagt Paton: „Wir starten in die Trockenzeit mit einem riesengroßen Regendefizit.“ Der Panamakanal, eine der wichtigsten Nadelöhre des Welthandels, dunstet aus.
Bis zu acht Prozent des Containerverkehrs fließt üblicherweise durch den Kanal; er ist die wichtigste Verbindung von US-amerikanischen Häfen aus, aber auch Schiffe aus Europa durchqueren die Wasserstraße auf ihrem Weg nach Asien oder an die Westküste der USA. Der Kanal ist schon seit Jahren den anschwellenden Handelsvolumina nicht gewachsen; jetzt stellen die Wasserprobleme sogar den Status quo infrage. Die Kanalbehörde hat die Durchfahrten für die kommenden Monate bereits um ein Drittel zusammengestrichen.
panama
Dem Welthandel drohen damit gleich zwei bedrohliche Engpässe. Teile der fehlenden Kapazitäten am Panamakanal konnten Reeder bisher, etwa für Routen zwischen Ostasien und Europa, durch den Suezkanal umleiten. Doch seit Huthi-Rebellen Raketen auf Handelsschiffe im Roten Meer abfeuern, ist das keine echte Alternative mehr.
Schneller schlau: Huthi-Rebellen
Wer sind die Huthis?
Die Huthi-Rebellen bezeichnen sich offiziell als „Ansar Allah“ („Unterstützer Gottes“). Sie gehören der schiitischen Strömung der Saiditen an, deren Imame bis 1962 im Nordjemen herrschten.
S
Stand: 4. Dezember 2023
Die Frachtraten verteuern sich. Seit Dezember haben sich die Preise für kurzfristige Containertransporte mehr als verdoppelt. Die Situation erinnert an die Havarie des Containerschiffs Ever Given vor drei Jahren. Schon wieder reißen Lieferketten. Schon wieder stottert die Globalisierung.
Und doch zeigt eine Reise entlang des 82 Kilometer langen Panamakanals, dass die Dimension des Problems heute ungleich größer ist: Wird es mittelfristig genug Wasser geben für die Schifffahrt im Panamakanal? Und wenn nicht: Wie ließe sich die Wasserstraße dennoch nutzen? Oder muss sich die Weltwirtschaft dem Diktat des Klimawandels beugen?
Kilometer 14,9 Miraflores-Schleusen: Der Engpass
Menschen drängen sich auf dem Deck des Besucherzentrums der Schleusenanlage, als ein lautes Piepen ertönt. Das Signal zeigt an, dass der Wasserstand hoch genug ist; die letzten Tore der Miraflores-Kammern öffnen sich. 200.000 Kubikmeter Wasser strömen bei jeder Schiffsdurchfahrt gen Ozean – genug, um 76 olympische Schwimmbecken zu füllen. Der Ton verklingt, die Spirit of Melbourne setzt sich in Bewegung. Ein Kanalmitarbeiter mit breiter Statur und schmalem Schnurrbart kommentiert die Durchfahrt: „Viele Menschen machen sich Sorgen, weil wir weniger Schiffe durchlassen“, sagt er. „Sie haben vielleicht gehört, dass Maersk den Kanal nicht mehr nutzt.“ Dabei sehe gerade jeder, dass das nicht stimme: Die Spirit of Melbourne ist ein Maersk-Schiff.
Der wahre Kern der vermeintlichen Fake News: Maersk hat die Container eines Schiffsdienstes zwischen Ozeanien und der US-Ostküste auf die Schiene umgeladen, die gleich neben dem Panamakanal verläuft. Andere Reeder testen die neue „Maya Bahn“, eine Trasse von der Westküste Mexikos in die USA. Doch egal, wie lang die Züge sind, sie können nur einen Bruchteil der Schiffsladungen aufnehmen. Um den Panamakanal zu ersetzen, bräuchte es einen zweiten Wasserweg. Zwar kündigte ein chinesisches Konsortium eine Wasserstraße durch Nicaragua an, die Bauarbeiten aber kamen schnell zum Stillstand.
Die Miraflores-Schleusen verbinden den Kanal mit dem Pazifik bei Panama-Stadt Quelle: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche
Die Miraflores-Schleusen verbinden den Kanal mit dem Pazifik bei Panama-Stadt
Bild: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche
Und so bleiben den Schiffen, die keine festen Slots im Kanal haben, nur drei schlechte Alternativen: Sie können für viel Geld um die wenigen Restplätze bieten – zuletzt ging eine Passage für vier Millionen Dollar weg. Sie können warten, derzeit zwei bis drei Tage. Oder die drei Wochen Umweg um Südamerika herum in Kauf nehmen. Der Sprecher im Besucherzentrum umschifft solche Nachrichten lieber, gönnt sich stattdessen eine Pointe auf Kosten der Kollegen in der Verwaltung des Suezkanals: „No Jack Sparrows in Panama!“, ruft er in sein Mikrofon. Keine Piraten, kein Krieg, der Panamakanal sei sicher. „It’s a good route!“
Kilometer 14 Die Kanalbehörde: Schlechtes Neues
Ricaurte Vásquez Morales ist seit 2019 der Chef der Verwaltung des Panamakanals, zugleich Minister für Kanalangelegenheiten. Es ist das erste Mal, dass er in diesem Jahr mit der Presse spricht. Doch gute Neuigkeiten hat er nicht. Die Dürre trifft den Kanal mit voller Wucht. Schon jetzt verzeichnet die Kanalbehörde 36 Prozent weniger Schiffe, sagt Vásquez. Bis Ende April will die Kanalbehörde die Zahl der Transite auf 24 am Tag begrenzen. Dann hofft er auf Regen. Ohne Regen könnte „die Zahl der Transite von 24 auf 22 oder 20 fallen“, warnt er. Der Panamakanal ist eine wichtige Einkommensquelle des Landes, im vergangenen Finanzjahr steuerte der Kanal 2,5 Milliarden US-Dollar zum Staatshaushalt bei. Weniger Schiffe bedeuten weniger Einnahmen. Der Gewinn könnte deshalb „um 500 bis 700 Millionen US-Dollar geringer ausfallen“, sagt Vásquez. „Es ist wichtig, dass das Land die Botschaft sendet, dass wir uns der Sache annehmen und eine Lösung für dieses Wasserproblem finden.“
Inhalt
Kann ein gewagter Plan das Nadelöhr der Schifffahrt retten?
Das Wasserproblem betrifft nicht nur die Schiffe
Maersk steuert 2024 in schwere See
09. Februar 2024
Quelle: REUTERS
Bild: REUTERS
Die Aussichten für die Containerschifffahrt sind in diesem Jahr schlecht, sagt die dänische Reederei Maersk voraus. Anleger reagieren sofort.
Die dänische Großreederei Maersk trübt mit einem Gewinneinbruch zum Jahresende und einer düsteren Prognose für 2024 die Aussichten für die Containerschifffahrt. Im vierten Quartal sackte der Betriebsgewinn (Ebitda) auf 839 Millionen Dollar ab, wie die weltweit zweitgrößte Container-Reederei am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor, als die Branche noch von der Corona-Sonderkonjunktur profitierte, war es mit rund 6,6 Milliarden fast das Achtfache gewesen. Auch für 2024 rechnet Maersk wegen inzwischen entstandener Überkapazitäten mit deutlich niedrigeren Gewinnen.
Die derzeit wegen der Suezkanal-Krise steigenden Frachtraten seien nicht nachhaltig, machte Maersk-Chef Vincent Clerc klar. „Sobald wir wieder durch den Suezkanal fahren, werden die Preise sofort fallen“, sagte Clerc. Vorerst gelte seinem Konzern eine Passage des Suezkanals aber als zu gefährlich. Im Januar sei ein Versuch gescheitert, die Fahrten über die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa wieder aufzunehmen. Maersk sei von der US-Marine signalisiert worden, dass sie nicht für eine sichere Fahrt durch das Seegebiet in Nahost garantieren könne.
Nach Angriffen von Huthi-Rebellen aus dem Jemen auf Frachter im Roten Meer haben Großreedereien seit Mitte Dezember ihre Schiffe um die Südspitze Afrikas umgeleitet. Inzwischen plant die EU zwar einen Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen, an dem sich Deutschland mit der am Donnerstag ausgelaufenen Bundeswehr-Fregatte „Hessen“ beteiligen will. Vorerst führen die Umleitungen von Frachtern jedoch zu Verzögerungen und steigenden Kosten, bringen den Reedereien aber auch höhere Kundengebühren.
Maersk-Chef: Lage überhaupt nicht mit Corona zu vergleichen
Maersk-Chef Clerc sagte allerdings, die Verwerfungen durch die angespannte Sicherheitslage im Roten Meer würden aber nicht im Entferntesten dem ähneln, was in der Container-Schifffahrt während der Pandemie passiert sei. Dieses Mal komme es lediglich zu längeren Transitzeiten. Während Corona hätten dagegen Lockdown-Maßnahmen, Engpässe und eine größere Kundennachfrage die Schifffahrt völlig auf den Kopf gestellt. Dominierend für das laufende Geschäft seien vielmehr Probleme wegen der Überkapazitäten, die 2024 voll zum Tragen kämen. Sie würden noch 2025, möglicherweise auch noch 2026 zu spüren sein.
Wegen der Suezkanal-Problematik sei die Prognose für 2024 mit großen Unsicherheiten behaftet, erklärte Maersk weiter. Je nach dem, ob die Krise nur noch ein Quartal oder das ganze Jahr andauere, sei mit einem Ebitda zwischen einer Milliarde und sechs Milliarden Dollar zu rechnen. Die Geschäfte von Maersk mit seinen Hunderten Schiffen gelten als Barometer für den Welthandel.
Gewinn brach auch bei künftigem Partner Hapag-Lloyd ein
Obwohl die von Maersk genannten Überkapazitäten schon vorher bekannt waren, hatten Investoren die Branche zuletzt mit Wohlwollen gesehen. Sie setzten darauf, dass durch die Suezkanal-Krise wieder steigende Frachtraten die Gewinne der Reedereien erneut nach oben treiben. Die klare Aussage von Maersk-Chef Clerc machte diese Hoffnung vorerst zunichte.
Hapag Lloyd und Maersk: Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg
HAPAG LLOYD UND MAERSK
Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg
von Artur Lebedew
Die Maersk-Aktien gaben deshalb an der Börse 16 Prozent nach. Die Titel des kleineren Rivalen Hapag-Lloyd zog es zehn Prozent mit in die Tiefe. Deutschlands größte Reederei hatte bereits Ende Januar einen Gewinneinbruch wegen niedrigerer Frachtraten gemeldet. Konzernchef Rolf Habben Jansen geht davon aus, dass die Hapag-Lloyd-Flotte das Rote Meer wegen Sicherheitsrisiken möglicherweise noch monatelang umfahren muss.
Selbst wenn die Maersk-Schiffe ein Jahr zu derartigen Maßnahmen gezwungen würden, gebe es weiterhin Überkapazitäten und Druck auf die Preise, betonte Maersk-Chef Clerc. „Wir werden sehen, dass es auf der Welt zu viele Schiffe gibt für die Zahl der zu transportierenden Container.“
VON ERBSCHAFT BIS SCHENKUNG
Geldübertragung in der Familie: Melden Banken dies dem Finanzamt?
DER GROSSE IMMOBILIENATLAS 2024
50 Städte im Check: Hier lohnt sich jetzt der Kauf
BOXER-BESTELLUNG
Vom Waffenbruder Australien enttäuscht
Weitere Plus-Artikel lesen Sie hier
Maersk steht vor einer Partnerschaft mit Hapag-Lloyd, der Nummer Fünf der internationalen Containerschifffahrt. Der dänische und der deutsche Konzern hatten unlängst angekündigt, ab Februar 2025 in dem neuen Flottenpool-Bündnis „Gemini“ zusammenarbeiten zu wollen. Bis Januar 2025 ist Maersk bei diesen in der Branche üblichen und von den Wettbewerbsbehörden geduldeten Kooperationen noch mit dem Branchenprimus MSC aus der Schweiz verbandelt, Hapag-Lloyd mit drei asiatischen Reedereien.
Lesen Sie auch: Warum Tanker-Aktien jetzt spannend sind
rtr
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?
Auch interessant:
Empfohlen von
ANZEIGE
Grüner Fisher
7 Wege, um mit 250.000 € aufzuhören zu arbeiten.
Wer vor 1985 geboren ist, kann 2024 kostenlosen Zahnschutz erhaltenANZEIGE
Pro Verbraucher
Wer vor 1985 geboren ist, kann 2024 kostenlosen Zahnschutz erhalten
Grüne Energie für SparfüchseANZEIGE
enercity AG
Grüne Energie für Sparfüchse
Londoner Prozess gegen Greta Thunberg hat begonnen
Klimaaktivistin
Londoner Prozess gegen Greta Thunberg hat begonnen
Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt läuft erstmals aus
Icon of the Seas
Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt läuft erstmals aus
Umfrage: Wer würde es aktuell in den Bundestag schaffen?
Parteien
Umfrage: Wer würde es aktuell in den Bundestag schaffen?
Das kostet die Kilowattstunde in Deutschland 2024
Strompreis aktuell
Das kostet die Kilowattstunde in Deutschland 2024
ANZEIGE
Grüner Fisher
99 Ruhestandstipps für Anleger ab 250.000 €
Senioren empört: Anspruch auf Sterbegeld ist vielen unbekanntANZEIGE
Pro Verbraucher
Senioren empört: Anspruch auf Sterbegeld ist vielen unbekannt
Deutscher Experte warnt: Niemals Hörgeräte testen ohne diesen TippANZEIGE
audibene Hörgeräte
Deutscher Experte warnt: Niemals Hörgeräte testen ohne diesen Tipp
Volvo gibt Polestar kein Geld mehr – Harte Zeiten für Elektroauto-Start-ups
Autoindustrie
Volvo gibt Polestar kein Geld mehr – Harte Zeiten für Elektroauto-Start-ups
Minister: Polen bereitet sich auf Krieg mit Russland vor
Verteidigung
Minister: Polen bereitet sich auf Krieg mit Russland vor
Billiganbieter Temu ist ein Problem für die deutsche Wirtschaft
Onlineshop aus China
Billiganbieter Temu ist ein Problem für die deutsche Wirtschaft
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage
Russische Invasion
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage
Wasserstoff-Elektrolyseur – wie er funktioniert und wie viel Wasserstoff er erzeugt
Mit Strom Wasser zerlegen
Wasserstoff-Elektrolyseur – wie er funktioniert und wie viel Wasserstoff er erzeugt
BYD hat noch einige Asse im Ärmel
BYD hat noch einige Asse im Ärmel
Pädophilie-Skandal: Orban distanziert sich von Präsidentin
Ungarn
Pädophilie-Skandal: Orban distanziert sich von Präsidentin
„Uns droht ein Sturm am Glasfasermarkt“
Internetversorgung
„Uns droht ein Sturm am Glasfasermarkt“
Mehr WiWo: Newsletter
Serviceangebote unserer Partner
UnternehmenFinanzenErfolgGründerPolitikTechnologieWiWo+
Themen Kolumnen Bilder Videos Dossiers Börsenkurse Services Multimedia-Reportagen Spiele
ImpressumAGBDatenschutzerklärungDatenschutzeinstellungenNutzungsrechte erwerben?
Nutzungsbasierte OnlinewerbungKontakt
Abo kündigen Verlags-Services für Werbung: iqdigital.de (Mediadaten) Verlags-Services für Content: Business Content Online-Archiv Realisierung und Hosting der Finanzmarktinformationen: Norkon Computing Systems, Live Center Datenbelieferung für alle Handelsplätze: Morningstar (Lang&Schwarz) Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. WirtschaftsWoche ist Mitglied im VDZ.
© 2024 Handelsblatt GmbH – ein Unternehmen der Handelsblatt Media Group GmbH & Co. KG
Nach oben
Kosten für Seefracht steigen nach Huthi-Angriffen
Warenverkehr durch Suezkanal hat sich fast halbiert
Stand: 26.01.2024 13:33 Uhr
Wegen der Attacken der Huthi-Miliz fahren weniger Schiffe durch das Rote Meer. Die Vereinten Nationen warnen vor den Folgen für den Welthandel. Mit dem Suezkanal sind derzeit drei globale Handelsrouten gestört. Der Warenverkehr durch den Suezkanal hat sich nach UN-Angaben seit Beginn der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz im Roten Meer vor zwei Monaten nahezu halbiert. Die Frachtmenge sei um mehr als 40 Prozent eingebrochen, teilte die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) mit. Zugleich seien 39 Prozent weniger Schiffe durch den von Ägypten betriebenen Kanal registriert worden. „Wir sind sehr besorgt“, sagte der Leiter des Bereichs Handelslogistik bei der UNCTAD, Jan Hoffmann der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir sehen Verspätungen, höhere Kosten, höhere Treibhausgasemissionen.“ Die Organisation, die die Entwicklungsländer im Welthandel unterstützt, warnt deshalb vor Risiken wie einer höheren Inflation, Ernährungsunsicherheit und der Zunahme der Treibhausgasemissionen durch das Nutzen von alternativen, aber längeren Routen. Über den Suezkanal werden zwölf bis 15 Prozent des Welthandels und 25 bis 30 Prozent des Containerverkehrs abgewickelt. Es ist die kürzeste Seeverbindung zwischen Europa und Asien.
Container des Schifffahrtskonzerns Maersk stehen gestapelt im Tema-Hafen in Ghana (Archivbild).
Player: audioMitglieder des UN-Sicherheitsrats besorgt über Huthi-Attacken auf Frachtschiffe
04.01.2024
Beschuss im Roten Meer
Kosten für Seefracht steigen nach Huthi-Angriffen
Durch die Angriffe der Huthi im Jemen auf Containerschiffe im Roten Meer sind die Seefrachtraten angestiegen. mehr
Schwarzes Meer, Panamakanal und Suezkanal gestört Insgesamt seien nunmehr drei wichtige globale Handelsrouten gestört: Der seit fast zwei Jahren andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine und andere geopolitische Spannungen hätten die Handelsrouten für Öl und Getreide neu gestaltet, so sei neben dem Suezkanal auch das Schwarze Meer betroffen. Erschwerend komme für Schifffahrtsunternehmen hinzu, dass der Wasserstand im Panamakanal aufgrund einer schweren Dürre auf den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten gesunken sei. Dies habe erhebliche Auswirkungen auf die Zahl und Größe der Schiffe, die den Kanal noch durchfahren könnten. Die Gesamtzahl der Durchfahrten durch den Panamakanal im Dezember sei 36 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr zuvor und 62 Prozent niedriger als zwei Jahre zuvor, sagte Hoffmann. Schiffe transportierten etwa 80 Prozent der Güter im Welthandel, bei Entwicklungsländern sei der prozentuale Anteil noch höher.
Karte Jemen mit Golf von Aden, Rotes Meer, Suezkanal
Player: audioZum EU-Außenministertreffen: Die Bedrohung durch die Huthi im Roten Meer
24.01.2024
Golf von Aden
Erneut Explosion vor jemenitischer Küste
Wegen des Vorfalls änderten zwei Frachtschiffe ihre Route. mehr
Noch keine Lieferengpässe in Deutschland Die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Containerschiffe im Roten Meer haben dem Ifo-Institut zufolge die Lieferketten der deutschen Wirtschaft bislang noch nicht reißen lassen. „Sie haben bislang nicht zu Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten geführt“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, der Nachrichtenagentur Reuters. Viele Schiffe nehmen den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung in Kauf, was zu Verzögerungen führt und Furcht vor reißenden Lieferketten wie zu Corona-Zeiten aufkommen ließ.
Huthi
Guenther Go
Krisengebeutelt: Die globale Containerschifffahrt meidet vor allem im Europa-Asien-Verkehr die Rotes-Meer-Passage, Foto: Hapag-Lloyd
Schifffahrt International
Rotes Meer: Konflikt als Kostentreiber
12. Januar 2024
Die hohe Bedrohungslage für die internationale Handelsschifffahrt, die eigentlich das Rote Meer im Zusammenhang mit einer Suezkanal-Passage passieren müsste, führt inzwischen zu erheblichen Konsequenzen im Besonderen in der Containerschifffahrt.
Neuesten Berechnungen zufolge nutzen inzwischen 90 Prozent der im Europa-Fernost-Trade zum Einsatz kommenden Containerschiffe aus Sicherheitsgründen den deutlich längeren Seeweg über das Kap der Guten Hoffnung anstatt durch den Suezkanal und damit auch durch das Rote Meer. Die damit auch einhergehende Verlängerung der Reisezeit führt inzwischen auch zu ersten Störungen von interkontinental angelegten Logistikketten. So teilte der US-Elektrofahrzeug-Hersteller Tesla jetzt mit, dass das brandneue Werk in Grünheide bei Berlin aufgrund von fehlenden Bauteilen die Fahrzeugproduktion in der Fabrik für rund zwei Wochen weitgehend stoppen muss. Derzeit ist geplant, die Fertigung ab dem 12. Februar wieder aufzunehmen.
Damit der Seeweg über das Rote Meer/Suezkanal wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung zurückfinden kann, führten die USA und Großbritannien mit ihren See- und Luftstreitkräften in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche gezielte Schläge gegen Militäreinrichtungen der vom Jemen aus operierenden Huthi-Rebellen aus. Diese sind seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der Hamas (7. Oktober 2023) damit beschäftigt, vor allem Handelsschiffe bei der Rotes-Meer-Passage mit Drohnen, Flugkörpern und auch Speedbooten zu attackieren. Bislang wurden 27 solcher Vorfälle erfasst. Es kam sogar zu Angriffen auf Kriegsschiffe der USA.
In dem konzentrierten Luftschlag wurden nach US-Darstellung insgesamt 60 Ziele, verteilt auf 16 verschiedene Standorte, bekämpft. Bei den „Zielen“ handelte es sich dem Vernehmen nach um Radar-Stationen, Munitionslager und Startrampen für Raketen/Flugkörper und Drohnen. Die Huthi-Terroristen werden materiell und finanziell maßgeblich vom Iran unterstützt. Die Militäraktion wollen die USA und Großbritannien als klares Signal an die Rebellen-Führung verstanden wissen, ihre Attacken gegen die freie Handelsschifffahrt sofort einzustellen.
Die Bundesregierung steht nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock („Grüne“) hinter dem Militärschlag der USA und weiterer Nationen. „Die Reaktion hat unsere politische Unterstützung“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Treffen mit dem Außenminister von Malaysia, Mohamad Hasan, in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Baerbock absolvierte eine mehrtägige Asien-Reise. Baerbock sagte weiter, dass die Europäische Union (EU) derzeit mit Hochdruck prüfe, „wie wir die Stabilisierung im Roten Meer auch selbst stärken und zu dieser Stabilisierung beitragen können“. Dies müsse im europäischen Rahmen gemeinsam beschlossen werden.
Nach Darstellung von Deutschlands größter Container-Reederei Hapag-Lloyd verursachen die fortwährenden Angriffe der Huthi-Rebellen auf die Schifffahrt im Roten Meer für das Hamburger Unternehmen monatliche Mehrkosten im hohen zweistelligen Millionenbereich. „Es beeinflusst die gesamte Branche und auch uns selbst auf signifikante Weise“, so ein Konzernsprecher am Freitag vergangener Woche. Die internationalen Militärschläge unter Führung der USA und Großbritanniens gegen Stellungen der Huthi-Rebellen bewertete der Sprecher nicht: „Aber wir begrüßen Maßnahmen, die die Durchfahrt durch das Rote Meer wieder sicher machen.“ EHA
Schifffahrt International
Vorbote der Inflation
Ohne Suezkanal leeren sich die Lager – wie sehr treibt das die Preise an?
In der Pandemie war der enorme Anstieg der Kosten in der Containerschifffahrt Vorbote der Inflation. Nun schnellen Frachtraten wegen des Suezkanals wieder empor
Alexander Hahn
16. Jänner 2024, 06:00
, Licht und Schatten bei deutschen Reedereien
Stand: 14.01.2024 08:36 Uhr
Beim Stichwort deutsche Reedereien denken die meisten als erstes an den Marktriesen Hapag-Lloyd. Tatsächlich ist die Branche vielfältig, denn viele Reedereien sind klein oder mittelständisch.
Ingo Nathusius
Von Ingo Nathusius, HR
Es ist nicht die Größe, auf die es ankommt: Das gilt offenbar unter anderem in der Schifffahrt. „Beim Betreiben von Schiffen sind Größenvorteile, die sogenannten Skaleneffekte, nicht so entscheidend“, sagt Nikolaus Schües, Präsident des Branchenverbandes BIMCO, „Reedereien sparen nicht unbedingt viel, wenn sie eine große Flotte haben. Als Reeder können Sie auch gut ein paar wenige Schiffe profitabel bewirtschaften“. In der Öffentlichkeit tauchen Riesen wie Hapag-Lloyd aus Hamburg auf, die im Rekordjahr 2022 fast 35 Milliarden Euro umsetzten. Der größte Teil deutscher Reedereien sind dagegen inhabergeführte Mittelständler. Der Verband Deutscher Reeder listet gut 170 Mitglieder auf. Darunter sind die Branchenriesen für Linienfahrt, Fährverkehr und Kreuzfahrten. Die meisten Mitglieder sind aber kleine und mittlere Unternehmen, hinter denen Familien oder einzelne Unternehmer stecken.
Der Containerschiff-Neubau MV «OOCL Hong Kong»
Der Containerschiff-Neubau MV «OOCL Hong Kong»
Friedrich Bäßmann
… nur daß für die meisten ihrer Schiffe bei uns weder Steuern noch Sozialabgaben gezahlt werden !
1 Wo.
Antworten
Guenther Goettling hat eine Erinnerung geteilt.
· Mit Öffentlich geteilt
Mit der Angriffsserie der Huthi-Rebellen im Jemen auf Transportschiffe im Roten Meer ist der Warenverkehr im Suezkanal beinahe zum Erliegen gekommen – was den Wind in der Containerschifffahrt binnen Wochen um 180 Grad drehen ließ. Noch Ende November erwartete der Chef der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, gedämpfte Nachfrage, mehr Schiffskapazitäten und sinkende Preise, also tiefe Frachtkosten. Gekommen ist es anders, denn seitdem haben sich die Frachtraten bereits verdoppelt, Tendenz stark steigend.
Der Standard
Es mehren sich die Befürchtungen, dass dieser Anstieg nun Vorbote einer Inflationswelle sein könnte – ähnlich, wie die Frachtraten bereits im Vorfeld des ersten Teuerungsschubs in lichte Höhen geklettert waren. Wie realistisch sind diese Sorgen? Denn bei Konsumartikeln fallen in der Regel nur zwischen zwei und fünf Prozent des Verkaufspreises an Transportkosten an.
Die Preise treiben aber weniger höhere Transportkosten als die Effekte der nötigen Umfahrung des Suezkanals über das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Für ein Containerschiff von Schanghai nach Rotterdam verlängert sich die Reise um acht Tage. Es fallen dadurch zusätzliche Treibstoffkosten in Höhe von einer halben Million Dollar an und Transportkapazitäten sind länger gebunden – eine Zerreißprobe für viele Lieferketten wie jene von Tesla. Der E-Auto-Pionier musste zuletzt wegen fehlender Bauteile die Produktion im Werk in Brandenburg herunterfahren.
Warten auf Vorprodukte
Die deutsche Industrie- und Handelskammer warnt bereits vor Engpässen in den Lieferketten. Vorprodukte für die Industrie würden derzeit nicht rechtzeitig ankommen. Längere Lieferzeiten sowie höhere Frachtraten und Versicherungskosten würden sich auszuwirken. „Erste Lager laufen leer, Produktionsbeeinträchtigungen werden sichtbar“, sagt Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Kammer.
Ein Containerschiff im Roten Meer.
Ein Bild aus besseren Zeiten, als Containerschiffe 2017 noch weitgehend unbehelligt den Suezkanal ansteuern konnten.
REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH
Dadurch wird das Angebot an Waren geringer und stößt auf unveränderte Nachfrage – Nährboden in einer Marktwirtschaft für steigende Preise. Verkäufer versuchen, geringere Absatzmengen durch höhere Verkaufspreise zu kompensieren, um negativen Folgen auf Umsatz und Gewinn entgegenzuwirken.
Steigende Kapazitäten
Auch wenn wegen akuter Dürre und tiefer Wasserpegel die Nutzung des Panamakanals ebenfalls stark eingeschränkt ist – eine derartig starke Beeinträchtigung der Containerschifffahrt wie während der Corona-Pandemie ist unwahrscheinlich, schließlich waren damals wichtige Häfen in China wochenlang gesperrt. Dass der Suezkanal auch 2021 zeitweise wegen der Havarie des Containerschiffs Ever Given ebenfalls nicht passierbar war, kam damals nur hinzu.
Innovationen und Entwicklungen für die maritime Zukunft und Sicherheit
Digitaler Zwilling
Mithilfe von digitalen Zwillingen werden neuartige holistische Analysen der maritimen Energiesysteme ermöglicht. Dabei wird u.a. das Betriebsverhalten eines Schiffes sensorisch erfasst und kontinuierlich mit validierten Simulationen abgeglichen, um Anomalien zu identifizieren und die Effizienz zu optimieren. Quelle: DLR (CC-BY 3.0)
Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
Download
Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende, zu Gast beim parlamentarischen Gespräch des Arbeitskreises Küste der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.
DLR forscht im maritimen Bereich u. a. zu Dekarbonisierung und Automatisierung der Schifffahrt, maritimer Sicherheit und Verkehrsmanagement.
Schwerpunkt: Maritime Forschung
Die maritime Forschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie seine Mitwirkung an der Gestaltung des maritimen Lebens- und Wirtschaftsraumes war Fokus des Vortrages von Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandvorsitzende des DLR, am 18. Januar 2024 im Arbeitskreis Küste der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag.
Prof. Kaysser-Pyzalla betonte die Mission des DLR, Transformation, Nachhaltigkeit und Sicherheit im maritimen Bereich und der Binnenschifffahrt zu stärken – von der Entwicklung neuartiger Antriebe für Schiffe bis zur hochautomatisierten Schifffahrt und dem maritimen Verkehrsmanagement. Dabei setzt das DLR seine Kompetenzen aus allen Forschungsbereichen ein, Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr und Energie sowie die Sicherheitsforschung kommen hier zusammen.
Neben den beiden DLR-Instituten für den Schutz maritimer Infrastrukturen in Bremerhaven und für maritime Energiesysteme in Geesthacht beschäftigen sich 22 weitere DLR-Institute und Einrichtungen koordiniert mit maritimen Themen und Forschungsfragen. Die Forschungsergebnisse werden in maritimen Testfeldern und Reallaboren erprobt, wie zum Beispiel im Testfeld eMIR (e-Maritime Integrated Reference Platform), in dem neue und innovative Methoden und Werkzeuge zur Entwicklung, Verifikation und Validierung hochautomatisierter digitaler maritimer Systeme getestet werden. Die Zusammenarbeit mit Industrie, Behörden und anderen Wissenschaftseinrichtungen ist dem DLR ein wichtiges Anliegen, um den Transfer von der Forschung in die Anwendung zu stärken.
Maritime Energieforschung und maritime Sicherheit
Ein Schlüsselthema ist die maritime Energieforschung: Der maritime Sektor bietet großes Potenzial, wenn es um die Minderung von Treibhausgas-Emissionen geht. Das DLR unterstützt die Transformation dieses Sektors und arbeitet an nachhaltigen Lösungen für maritime Energiesysteme und Antriebe. Von der Komponentenentwicklung bis zur Erprobung an Land und auf See werden neue Antriebstechnologien ebenso entwickelt und erprobt wie alternative Treibstoffe und die nötige Infrastruktur. Virtuelle Schiffsmodelle helfen dabei.
Auch das Thema der maritimen Sicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Vorstandsvorsitzende des DLR zeigte die vielfachen Wege auf, mit denen Deutschlands größte ingenieurwissenschaftliche Forschungseinrichtung seit mehr als zehn Jahren einen wichtigen Beitrag zum Schutz maritimer Infrastrukturen, der Häfen und der Schifffahrtswege leistet – sowohl national als auch international. Dies umfasst beispielsweise Sensortechnologien vom Meeresboden bis in den Weltraum für die Überwachung des maritimen Raums, Methoden zur Gefahrstofferkennung (Ölteppiche) auf der Wasseroberfläche, die Detektion illegaler Aktivitäten, das Monitoring von Schiffsbewegungen sowie neue Verschlüsselungstechniken für die maritime Kommunikation. Mit seinem Forschungsverbund für Maritime Sicherheit leistet das DLR in enger Kooperation mit der Industrie einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Ziele der Bundesregierung für die Sicherheit und den Schutz des Schiffsverkehrs und der globalen Handelsketten.
Ein drittes wichtiges Thema ist die Forschung zum maritimen Verkehrsmanagement, das essentiell ist sowohl für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Häfen als auch für den Klimaschutz. Hierunter fällt das satellitengestützte Monitoring von Handelsrouten, Emissionen und Verschmutzungen aus der Schifffahrt, aber auch das hochautomatisierte Navigieren. So entwickelt das DLR beispielsweise Assistenzsysteme zum sicheren und hochautomatisierten Fahren in Häfen und auf Binnenwasserstraßen, wie z.B. eine vollautomatisierte digitale Einparkhilfe für Schiffe in Häfen.
Verwandte Nachrichten
Das DLR auf der Nationalen Maritimen Konferenz – Forschung für eine nachhaltige und sichere Schifffahrt
Maritime Mobilität: Prof. Axel Hahn im Interview – Autonomes Fahren auf dem Wasser
Lagebild zum Schutz eines Hafenareals in Nordenham erstellt – DLR testet Technologien zum Schutz maritimer Infrastrukturen
Zehn Jahre maritime Sicherheitsforschung im DLRInnovationstreiber für mehr Sicherheit auf See
Kontakt
Stand: 04.01.2024 03:57 Uhr
Durch die wiederholten Angriffe der Huthi im Jemen auf Containerschiffe im Roten Meer sind die Seefrachtraten sprunghaft angestiegen. Inzwischen verurteilte auch der UN-Sicherheitsrat die Attacken.
Nach den Raketenangriffen und Entführungsversuchen von Containerschiffen im Roten Meer steigen die Kosten für Seefracht sprunghaft an. Die Raten zwischen Asien und Nordeuropa haben sich nach Angaben der internationalen Frachtbuchungsplattform Freightos in dieser Woche auf über 4.000 Dollar pro Container mehr als verdoppelt. Zwischen Asien und dem Mittelmeerraum stiegen sie auf 5.175 Dollar.
Einige große Reedereien haben für Mitte des Monats Raten von mehr als 6.000 Dollar für Mittelmeersendungen angekündigt. Zuschläge von 500 Dollar bis zu 2.700 Dollar pro Container könnten die Gesamtpreise weiter in die Höhe treiben, erklärte Freightos.
Karte: Jemen, Suezkanal, das Rote Meer und der Indische Ozean
Ein Drittel der weltweiten Containerfracht über Route verschifft
Der ägyptische Suezkanal verbindet das Rote Meer mit dem Mittelmeer und ist der schnellste Weg, um Treibstoff, Lebensmittel und Konsumgüter aus Asien und dem Nahen Osten nach Europa zu transportieren. Etwa ein Drittel der weltweiten Containerfracht, darunter Spielzeug, Tennisschuhe, Möbel und Tiefkühlkost, wird über diese Route verschifft.
Im Jemen haben sich die vom Iran unterstützten Huthi mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen solidarisch erklärt und wiederholt Schiffe vor der von ihnen kontrollierten Küste attackiert. Maersk, Hapag-Lloyd und andere Reedereien haben angekündigt, deshalb das Rote Meer zu meiden.
Schiffe fahren durch den Suezkanal
Player: audioAngriffe im Roten Meer – mit welchen Folgen?
20.12.2023
Huthi-Miliz Welche Folgen die Angriffe im Roten Meer haben
Die wegen der Huthi-Miliz geänderten Schiffsrouten haben Folgen für Reedereien und Verbraucher. mehr
Bislang mehr als 180 Schiffe umgeleitet
Bis Mittwoch wurden daher bereits mehr als 180 Schiffe um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung umgeleitet, um den Angriffen auszuweichen. Dadurch verlängerten sich die Fahrzeiten um sieben bis 20 Tage, teilte das Technologieunternehmen project44 für Lieferkettenmanagement mit.
Nach Angaben der Vereinten Nationen leiten inzwischen 18 Reedereien ihre Schiffe um und lassen sie stattdessen Afrika umrunden. Mit der Umleitung über Südafrika sollten die Angriffe auf Schiffe reduziert werden, sagte der Chef der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Arsenio Dominguez.
Huthi-Rebell steht Wache in Sanaa, Jemen. (Aufnahme vom 10. November 2023)
Player: audioAngriffe auf Schiffe im Roten Meer – was wollen die Huthi?
19.12.2023
Angriffe im Roten Meer Was die Huthi wollen
Seit einigen Wochen greift die Huthi-Miliz Schiffe im Roten Meer an. Wer ist die Miliz aus dem Jemen? mehr
Internationale Militärkoalition zum Schutz der Handelsschifffahrt
Obwohl die Raten in die Höhe geschnellt sind, liegen sie immer noch weit unter den pandemiebedingten Rekordwerten von 14.000 Dollar pro Container für Lieferungen von Asien nach Nordeuropa und in den Mittelmeerraum.
Der Jemen liegt an der Meerenge Bab al-Mandeb zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden. Um die Handelsschifffahrt zu schützen, gaben die USA Mitte Dezember die Bildung einer internationalen Militärkoalition bekannt. Dieser gehören nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums inzwischen mehr als 20 Staaten an. Deutschland zählt bislang nicht dazu, erwägt nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums jedoch seinen Beitritt.
Ein Huthi-Mitglied geht durch den Strand mit dem Frachtschiff „Galaxy Leader“ im Hintergrund.
Ein Huthi-Mitglied geht durch den Strand mit dem Frachtschiff „Galaxy Leader“ im Hintergrund.
22.12.2023
Huthi-Angriffe im Roten Meer Mehr als 20 Länder wollen Militärbündnis beitreten
Auf die Angriffe der Huthi-Miliz im Roten Meer wollen die USA eine Militärallianz zum Schutz der Schiffe schmieden. mehr
UN fordert Ende der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Schiffe
Unterdessen rief auch der UN-Sicherheitsrat die Huthi im Jemen auf, ihre Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden einzustellen. Diese seien illegal und bedrohten die regionale Stabilität, die Freiheit der Schifffahrt und die weltweite Nahrungsmittelversorgung, sagte Chris Lu, Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen (UN). Gleichzeitig forderte der Rat die Freilassung des von Japan betriebenen und mit einer israelischen Firma verbundenen Frachtschiffes „Galaxy Leader“ und seiner Besatzung, das die Gruppe am 19. November gekapert hatte.
Die Huthi, die einen Großteil des Jemen kontrollieren, haben seit dem 19. November mehr als 20 Schiffe mit Drohnen und Raketen beschossen.
Player: audioMitglieder des UN-Sicherheitsrats besorgt über Huthi-Attacken auf Frachtschiffe
Hintergrundbild für den Audioplayer | ARD-aktuell
Mitglieder des UN-Sicherheitsrats besorgt über Huthi-Attacken auf Frachtschiffe
00:0001:24
Antje Passenheim, ARD New York, tagesschau, 04.01.2024 05:13 Uhr
Rotes Meer
Huthi-Rebellen
Angriffe
Nahost
eurer Umweg mit Folgen
Containerreedereien kündigen wegen des Transportumwegs um das Rote Meer höhere Preise an. Bei Anlegern kommen die Nachrichten gut an. Ein neuer Boom ist indes nicht zu erwarten.
Hamburg, 22. Dezember 2023, 19:22 Uhr
Carsten Steevens
Containerschiffe meiden das Rote Meer
Containerschiffe meiden das Rote Meer
picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH
Nach Angriffen jemenitischer Huthi-Rebellen auf Containerschiffe im Roten Meer verzichten Linienreedereien wie MSC, Maersk, CMA CGM und Hapag-Lloyd vorerst auf die Passage durch den Suezkanal und leiten ihre Frachter über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas um. Statt den kürzesten Seeweg im Fernost-Europa-Verkehr zu nutzen, nehmen die auf Sicherheit für ihre Schiffe und Besatzungen bedachten Unternehmen einen Umweg von mehr als 6.000 Kilometern in Kauf. Die Vorfälle an der Meerenge Bab al-Mandab, die im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen, ziehen spürbare Konsequenzen nach sich.
Suezkanal für Schifffahrtslinien gesperrt: Schiffe umgeleitet
Die Situation erinnert an den „Forever“-Unfall im Suezkanal und die anhaltenden Störungen der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie. Auch wenn der Suezkanal nun erneut umgangen werden muss, sehen Experten derzeit keine weiteren Probleme.
Ann Bradley
2023 Dezember 18 . 10:53 PM 2 Minuten Lesedauer
auf Facebook teilen
Share on Pinterest
auf LinkedIn teilen
Share on WhatsApp
per E-Mail teilen
Containerschiff „Al Jasrah“ entlädt Fracht am Burchardkai-Terminal. Foto.aussiedlerbote.de
Containerschiff „Al Jasrah“ entlädt Fracht am Burchardkai-Terminal. Foto.aussiedlerbote.de
Containerschifffahrt – Suezkanal für Schifffahrtslinien gesperrt: Schiffe umgeleitet
Der Suezkanal, eine wichtige Verkehrsader für den Welthandel, hat die Routen zu wichtigen Schifffahrtslinien vorübergehend gesperrt, nachdem die Huthi-Rebellen im Jemen Schiffe im Roten Meer angegriffen hatten. Stattdessen werden sie bis auf weiteres auf der Asien-Europa-Route über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas weiterfahren. „Die Tatsache, dass Reedereien mehr als 6.000 Kilometer um Afrika herumfahren, beweist, dass die Situation im Roten Meer äußerst gefährlich ist“, sagte Vincent Stamer, Welthandelsexperte am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), der Bundesbank. Nachrichtenagentur am Montag.
Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd etwa will bis auf weiteres auf den Transit durch den Suezkanal verzichten. Ein Hapag-Lloyd-Sprecher sagte, die Entscheidung sei am Montag nach Gesprächen mit dem Krisenstab getroffen worden, „mehrere Schiffe durch das Kap der Guten Hoffnung umzuleiten“. „Diese Situation wird so lange anhalten, bis es für Schiffe und ihre Besatzungen wieder sicher ist, den Suezkanal und das Rote Meer zu durchqueren.“ Auch Branchenführer MSC bekräftigte am Montag in einer Mitteilung an Kunden, dass MSC-Schiffe das Rote Meer bis dahin nicht passieren werden ist das sicher. Der Suezkanal verläuft nach Osten und Westen. „Einige Flüge wurden über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet.“
Alternativrouten verursachen Verzögerungen
Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzesten Seeweg zwischen Asien und Europa. Etwa zehn Prozent des Welthandels werden über das Rote Meer abgewickelt.
Diese Umwege können die Lieferung erheblich verzögern. Schätzungen reichen von einigen Tagen bis zu zwei Wochen. Starmer, der am IfW weltweite Schiffsbewegungen in Echtzeit erfasst und auswertet, geht von Verzögerungen von etwa zehn Tagen aus. Starmer erwartet jedoch keine größeren Störungen der globalen Lieferketten, wie sie während der Coronavirus-Pandemie aufgetreten sind.
Langfristige Materialengpässe sind nicht zu erwarten
„Damals gab es aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach langlebigen Gütern in Fernost und des weltweiten Lockdowns erhebliche Lieferengpässe“, sagte Starmer. „Das hat sich weitgehend normalisiert. Es ist also nicht mit Störungen durch den Umweg über Afrika zu rechnen.“ Monatelange Materialknappheit.“ Auch Hapag-Lloyd verwies auf die Pandemie gepaart mit Lieferkettenunterbrechungen und dem Frachtschiffunfall Ever Give im Suezkanal. „Es ist schwer zu vergleichen mit dem, was gerade passiert.“
Starmer sagte, dass die Raten auf dem Containerschiffnetz wahrscheinlich wieder leicht steigen würden. Allerdings sind die Preise für die Seecontainerschifffahrt seit ihrem Höchststand während der Epidemie deutlich gesunken. „Außerdem machen die Versandkosten von Asien nach Europa selbst bei den günstigsten Waren nur 2 % aus“, sagen IfW-Experten.
Seit Ausbruch des Gaza-Krieges haben die vom Iran unterstützten Houthi-Streitkräfte Israel wiederholt mit Drohnen und Raketen angegriffen und auch Schiffe im Roten Meer angegriffen, um sie an der Durchfahrt durch Israel zu hindern. Bei dem Angriff am Freitag wurden die Containerschiffe Al Jasrah und MSC Palatium III von Hapag-Lloyd beschädigt.
Trotz extremer Preisschwankungen und gestörter Lieferketten ist die Containerschifffahrt aus der Logistik nicht mehr wegzudenken. Obwohl der LKW deutschlandweit das meistgenutzte Beförderungsmittel im Rahmen logistischer Prozesse ist, sind pro Tag mehr als 6.000 Containerschiffe auf den Weltmeeren unterwegs. In Zeiten der a href=https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/buxtehude/c-service/so-funktionieren-digitalisierung-und-energiewende-in-hamburg_a207493>Digitalisierung und Energiewende steht jedoch auch die Containerschifffahrt vor Herausforderungen.
Ein Zukunftsausblick.
Prognose zur Frachtschifffahrt: Was sich künftig ändern wird
Um globale Lieferketten am Laufen zu halten, braucht man Containerschiffe. Vor allem zwischen Asien und Europa ist die Verschiffung von Waren heute Standard, wobei etwa 45 Prozent aller deutschen Importe auf den chinesischen Raum entfallen. Allein im Hamburger Hafen legen so Tag für Tag rund zwölf Containerschiffe an. Dabei werden pro Schiff im Durchschnitt 2.000 Container verladen, die abhängig von ihrer Größe zehn bis 30 Paletten enthalten.
Dadurch hat allein Hamburg täglich mit 240.000 bis 720.000 Container-Paletten zu tun. Angesichts dieser Zahlen wird klar, wie unverzichtbar die Containerschifffahrt für funktionierende Lieferketten ist. Weltweit werden sogar rund 90 Prozent aller Waren und Güter per Containerschiff transportiert. Dadurch hat sich der Containertransport per Schiff seit der Erfindung durch Malcolm McLean im Jahr 1956 zu einem Symbol der globalen Wirtschaft entwickelt.
Der Markt für Containerschifffahrt wird voraussichtlich bis 2030 ein florierendes Wachstum verzeichnen
rankfurt (www.aktiencheck.de) – Der in London berechnete Baltic Dry Index zeigt die durchschnittlichen Frachtkosten auf Schiffen für Schüttgüter auf den weltweiten Standardrouten, so Dr. Eberhardt Unger von „fairesearch“.
Er zeige hohe Volatilität, doch angesichts der Flaute in der Weltwirtschaft und im Welthandel überrasche die stabile Tendenz in den letzten Quartalen.
Der Welthandel zeig insbesondere eine erhebliche Verlangsamung in den letzten sechs Monaten. Im 2. und 3. Quartal 2023 sei so gut wie überhaupt kein Wachstum mehr aufgetreten. (Quelle: G 20).
Im Welthandel mit Schiffsfrachten sei die empfindliche maritime Infrastruktur zu beachten. Die Schifffahrt müsse sich nach den geographischen Besonderheiten der Weltmeere orientieren. Einige Engpässe unterlägen den geopolitischen Turbulenzen, wie zum Beispiel der Suezkanal, die Straßen von Hormuz, von Malakka oder Taiwan oder auch der Bosporus. Zuletzt habe der Überfall von Piraten auf einen Frachter im Roten Meer für Aufsehen gesorgt.
Die Klimaerwärmung und Dürreperioden hätten unter anderem den Panamakanal teilweise lahmgelegt. Diesen Kanal würden rund 1000 Schiffe pro Monat mit 40 Millionen t Fracht passieren. Das seien rund 5% des maritimen Welthandels. In den Sommermonaten sei der Wasserstand auf das niedrigste Niveau in den 143 Jahren seines Bestehens gesunken. Im Gatun Lake, der den Kanal mit Wasser versorge, würden in diesem Jahr nach Angaben des IWF bisher rund 15 Millionen t fehlen. Eine Reihe von Frachtern habe schon eine Wartezeit von sechs Tagen ertragen müssen.
Wie das Chart des IWF zeige, seien von den Verzögerungen besonders betroffen die Häfen in Panama, Nicaragua, Ecuador, Peru, El Salvador und Jamaika mit 10 bis 25% ihres maritimen Handels. Die Effekte würden bis Asien, Europa und Nordamerika gehen.
Folgerung: Der internationale Seehandel werde durch den Klimawandel auch in den nächsten Jahren betroffen sein. Lieferengpässe und höhere Frachtkosten seien die Folgen. (Ausgabe vom 26.11.2023) (27.11.2023/ac/a/m)
„Versand für Container
Global Market Vision ist eine kompetente Marktforschungs-Primärstudie mit globalen Versand für Container Marktanalysen, Wachstumschancen und Treibern. Die Forschung umfasst Wettbewerbsanalysen, Branchentrends, Produktspezifikationen, Segmentierungsanalysen und sogar Unternehmensforschung. Das Hauptziel der Studie besteht darin, wesentliche Informationen über die Wettbewerber des Unternehmens, das Marktpotenzial, die Wachstumsrate und die Analyse wichtiger Daten zu liefern.
Der Forschungsansatz analysiert umfassend die Entwicklung des globalen Marktes und liefert Schlussfolgerungen über die zukünftigen Wachstumsaussichten der Branche. Die weltweite Marktforschung untersucht Produktanalysen, technische Fortschritte und bedeutende Akteure. Die Studie untersucht kurz die Branche, einschließlich Marktanteil, CAGR, Marktnachfrage und Trends in verschiedenen Marktkomponenten. Die Studie beinhaltet eine genaue Kenntnis der verschiedenen Marktchancen.
Holen Sie sich eine vollständige PDF-Beispielkopie des Berichts: (einschließlich vollständigem Inhaltsverzeichnis, Liste der Tabellen und Abbildungen, Diagramm) @ https://globalmarketvision.com/sample_request/247477
Der Bericht konzentriert sich auch auf einige wichtige Wachstumsaussichten, darunter die Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen, Forschung und Entwicklung, Joint Ventures, Kooperationen, Vereinbarungen, Partnerschaften und das Wachstum wichtiger Akteure im Versand für Container auf regionaler und globaler Ebene.
Versand für Container Markt deckt folgende Hauptakteure ab:
Ceva Logistics, Mediterranean Shipping Company S.A., CMA-CGM SA, A.P. Moller-Maersk Group, China COSCO Holdings Company Limited, Deutsche Bahn AG., Nippon Express Co., Ltd, Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Hapag-Lloyd AG, Deutsche Post AG (DHL International GmbH)
Der aktuelle Bericht über Versand für Containermarket bietet eine vollständige Analyse dieses Geschäftsbereichs mit Schwerpunkt auf dem Rückgrat der Branche: aktuelle Trends, aktueller Wert, Branchengröße, Marktanteil, Produktions- und Umsatzprognosen für den Prognosezeitraum.
Marktsegmentierung:
Nach Typ
Trockenfrachtcontainer, Kühlcontainer, Sonstiges
Auf Antrag
Industrie und Fertigung, IT und ITES, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Telekommunikation, Öl- und Gasindustrie, Automobilindustrie, Sonstiges
Geografisch erfolgt die detaillierte Analyse von Verbrauch, Umsatz, Marktanteil und Wachstumsrate der folgenden Regionen:
Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)
Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Taiwan, Südkorea, Australien, Indonesien, Singapur, Malaysia, Rest Asien-Pazifik)
Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Russland, übriges Europa)
Mittel- und Südamerika (Brasilien, Argentinien, übriges Südamerika)
Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, übriger Naher Osten und Afrika)
„Generell herrscht derzeit Unsicherheit“, sagt Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen
Quelle: Thies Raetzke Images/Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen sieht die Containerschifffahrt vor schwierigen Jahren. Umso erstaunlicher, wie gelassen er den Einstieg des Konkurrenten MSC in den Hamburger Hafen nimmt. Verhindern will er den Deal nicht. Wohl zum Unmut von Großaktionär Klaus-Michael Kühne.
Green Shipping: Maersk und CMA CGM bündeln Kräfte
19. September 2023
Die Nummer zwei und drei in der internationalen Containerschifffahrt bündeln ihre Kräfte, um die Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie zu beschleunigen. Wie Maersk und CMA CGM am Dienstag ankündigten, wollen die beiden Reedereien den Einsatz alternativer, umweltfreundlicherer Kraftstoffe forcieren.
„Als Vorreiter der Energiewende in der Schifffahrt sind beide Unternehmen davon überzeugt, dass gemeinsames Handeln dazu beitragen wird, den grünen Wandel in der Schifffahrt zu beschleunigen und voneinander zu lernen, um weiter und schneller voranzukommen“, heißt es in der Mitteilung. Während mit der „Laura Maersk“ erst am vergangenen Donnerstag das weltweit erste methanolfähige Containerschiff getauft wurde (thb.info 14. September) und der dänische Reedereikonzern wie berichtet zahlreiche weitere Methanol-Boxcarrier geordert hat, setzt CMA CGM vor allem auf Einheiten mit LNG-Antrieb. Diese könnten künftig auch mit Bio-/E-Methan betrieben werden – „dem neuen grünen Äquivalent des derzeitigen LNG“, wie es in der Mitteilung heißt. Im Orderbuch der Franzosen fänden sich darüber hinaus auch Schiffe, die auf den Betrieb mit Bio-/E-Methanol ausgelegt sind. Sowohl Maersk als CMA CGM erwarten, dass der künftige Kraftstoffmix in der Schifffahrt weitere „Future Fuels“ umfassen wird.
Konkret beinhalten solle die Kooperation der Reedereien daher nicht nur die Erarbeitung hoher Standards für nachhaltige Kraftstoffe und Unterstützung bei der Festlegung des Rahmens für die Massenproduktion von grünem Methan und Methanol, sondern auch die gemeinsame Forschung und Entwicklung für alternative Kraftstoffe wie Ammoniak. Hinzu komme, Bunkerung und Lieferung von Bio-/E-Methanol in den wichtigsten Häfen der Welt sicherzustellen.
„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die Dekarbonisierung unserer Branche. Durch die Kombination des Know-hows und der Erfahrung zweier führender Schifffahrtsunternehmen werden wir die Entwicklung neuer Lösungen und Technologien beschleunigen und unsere Branche in die Lage versetzen, ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen“, sagte Rodolphe Saadé, Chairman und CEO der CMA CGM-Gruppe.
„A.P. Moller-Maersk möchte den umweltfreundlichen Wandel in der Schifffahrt und Logistik beschleunigen, und dazu brauchen wir die starke Beteiligung von Partnern aus der gesamten Branche. Wir freuen uns, in CMA CGM einen Verbündeten zu haben, und es ist ein Beweis dafür, dass ein greifbarer und optimistischer Weg in eine nachhaltige Zukunft entsteht, wenn wir uns durch entschlossene Anstrengungen und Partnerschaften zusammenschließen“, betonte Vincent Clerc, CEO bei A.P. Moller-Maersk. bek
Umwelt
Artikel
von Benjamin Klare
Kontakt
Teilen
Drucken
Containerschifffahrt Weltweit boomt der Markt | Hamburg Süd, Hapag-Lloyd, CMA CGM
AMA kürzlich heraus veröffentlichte eine Forschungsstudie mit dem Titel „Global Container Shipping Market 2023“, die umfassende Einblicke in die Geschäftsstrategien sowohl etablierter als auch aufstrebender Akteure der Branche bietet. Dieser Bericht bietet eine gründliche Analyse der aktuellen Marktlandschaft, der technologischen Fortschritte, Treiber, Chancen, Marktaussichten und des Status. Darüber hinaus bietet es einen Überblick über verschiedene Segmente und Anwendungen, die das Potenzial haben, den Markt in Zukunft zu beeinflussen. Die im Bericht dargestellten Informationen basieren auf historischen Meilensteinen und aktuellen Trends. Zu den wichtigsten in dieser Studie diskutierten Unternehmen gehören Maersk (Dänemark), CMA CGM (Frankreich), COSCO Container Lines (China), Evergreen Line (Taiwan), Mediterranean Shipping (Schweiz), APL (USA), China Shipping (China) und Hamburg Sud (Deutschland), Hanjin Shipping (Südkorea), Hapag-Lloyd (Deutschland) .
Greifen Sie auf den PDF-Beispielbericht zusammen mit allen zugehörigen Grafiken und Diagrammen zu unter: https://www.advancemarketanalytics.com/sample-report/ 69564 – global-container-shipping-market-1
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der globalen Marktforschung für Containerschifffahrt von AMA Research. Erfahren Sie, wie wichtige Trends und neue Treiber dieses Branchenwachstum prägen. Die Marktstudie ist nach Schlüsselregionen segmentiert, die die Vermarktung beschleunigen.
Umfang des Berichts zum Containertransport
Container werden im Wesentlichen zum Transport von Gegenständen von einem Ort zum anderen verwendet. In der Containerschifffahrt haben die Container verschiedene Standardgrößen: 20 Fuß (6,09 m), 40 Fuß (12,18 m), 45 Fuß (13,7 m), 48 Fuß (14,6 m) und 53 Fuß (16,15 m). dienen dem Laden, Transportieren und Entladen von Gegenständen oder Gütern. Dadurch können Container per Schiff, Bahn und LKW transportiert werden. Behälter bestehen im Allgemeinen aus Stahl und Aluminium. Art und Größe jedes Containers entsprechen den Vorschriften und Spezifikationen der Internationalen Organisation für Normung (ISO). Derzeit hat die steigende Zahl von Produktionseinheiten und Fabriken das Wachstum des globalen Containerschifffahrtsmarktes vorangetrieben.
Durchsuchen Sie Marktinformationen, Tabellen und Zahlen mit detaillierten Inhaltsverzeichnissen zum Containerschifffahrtsmarkt nach Anwendung (), nach Produkttyp ( Trockenlagercontainer, Flachregalcontainer, oben offener Container, seitlich offener Lagercontainer, gekühlte ISO-Container, ISO-Tanks, Halbhohe Container, andere, ), Geschäftsumfang und Ausblick – Schätzung bis 2029.
Schließlich werden alle Teile des globalen Marktes für Containerschifffahrt quantitativ und subjektiv bewertet, um den globalen und regionalen Markt gleichermaßen zu betrachten. Diese Marktstudie präsentiert grundlegende Daten und wahre Zahlen über den Markt und bietet eine tiefgreifende Analyse dieses Marktes auf der Grundlage von Markttrends, Markttreibern, Einschränkungen und seinen Zukunftsaussichten. Der Bericht liefert die globale Finanzherausforderung mithilfe der Fünf-Kräfte-Analyse und der SWOT-Analyse von Porter. Kaufen Sie
jetzt eine vollständige Bewertung des Marktes für Containerschifffahrt unter: https://www.advancemarketanalytics.com/buy-now?format=1&report= 69564 Nachfolgend werden
die globalen Marktsegmente für die Containerschifffahrt und die Aufschlüsselung der Marktdaten erläutert:
Markt nach Typ (Wert und Volumen von 2023 bis 2029):
Trockenlagercontainer, Flachregalcontainer, Open-Top-Container, Open-Side-Lagercontainer, gekühlte ISO-Container, ISO Tanks, halbhohe Container, andere
Geografisch ist dieser Bericht in einige Schlüsselregionen segmentiert, mit Herstellung, Erschöpfung, Umsatz (Mio. USD) sowie Marktanteil und Wachstumsrate der Containerschifffahrt in diesen Regionen von 2018 bis 2029 (Prognose). deckt China, USA, Europa, Japan, Korea, Indien, Südostasien und Südamerika sowie deren Anteil (%) und CAGR für den prognostizierten Zeitraum 2023 bis 2029 ab. Informative Erkenntnisse aus der Marktstudie: Der Containerschifffahrtsbericht enthält
eine umfassende Analyse prominenter Unternehmen und ihre Marktposition unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona-Virus. Der Bericht nutzt verschiedene Analysetools wie die SWOT-Analyse, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter und die Annahme-Rendite-Schuldenanalyse, um den Fortschritt der wichtigsten Marktteilnehmer zu bewerten. Eine gründliche Untersuchung und Auswertung der Daten gewährleistet ein umfassendes Verständnis der Marktlandschaft und ermöglicht Einblicke in die Leistung dieser Hauptakteure.
Haben Sie eine Frage? Stellen Sie vor dem Kauf eine Anfrage unter: https://www.advancemarketanalytics.com/enquiry-before-buy/ 69564 – global-container-shipping-market-1
Anpassung des Berichts: Der Bericht kann entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden, um Daten von bis zu drei Unternehmen oder Ländern hinzuzufügen.
Einige der wichtigen Fragen für Stakeholder und Geschäftsleute zum Ausbau ihrer Position auf dem globalen Containerschifffahrtsmarkt : F
1. Welche Region bietet die lohnendsten offenen Türen für den Markt vor 2023?
F 2. Was sind die geschäftlichen Bedrohungen und Auswirkungen des neuesten Szenarios auf das Marktwachstum und die Marktschätzung?
F 3. Was sind wahrscheinlich die ermutigendsten und am weitesten entwickelten Szenarien für die Containerschifffahrt , aufgeschlüsselt nach Anwendungen, Typen und Regionen? F 4. Welche Segmente erregen im
Containerschifffahrtsmarkt im Jahr 2023 und darüber hinaus die größte Aufmerksamkeit ?
F 5. Wer sind die wichtigsten Akteure, mit denen der Containerschifffahrtsmarkt konfrontiert ist und die sich weiterentwickeln ? Kaufen Sie
jetzt eine vollständige Bewertung des Marktes für Containerschifffahrt unter: https://www.advancemarketanalytics.com/reports/ 69564 – global-container-shipping-market-1
Wichtige Punkte des Inhaltsverzeichnisses:
Kapitel 1 Globaler Geschäftsüberblick über den
Containerschifffahrtsmarkt Kapitel 2 Hauptaufschlüsselung nach TypKapitel 3 Hauptaufschlüsselung nach Anwendung (Umsatz und Volumen)
Kapitel 4 Aufschlüsselung des Herstellungsmarktes
Kapitel 5 Marktstudie zu Verkäufen und SchätzungenKapitel 6 Vergleich der Produktions- und Verkaufsmärkte der wichtigsten Hersteller Abbauen
………..
Kapitel 8 Marktbewertung und Aggressivität von Herstellern, Deals und AbschlüssenKapitel 9 Aufschlüsselung der wichtigsten Unternehmen nach Gesamtmarktgröße und Umsatz nach TypKapitel 10 Geschäfts-/Industriekette (Wert- und Lieferkettenanalyse)Kapitel 11 Schlussfolgerungen und Anhang
Vielen Dank für das Lesen dieses Artikels. Sie können auch einzelne kapitelweise Abschnitte oder regionale Berichtsversionen wie APAC, Nordamerika, LATAM, Europa oder Südostasien erhalten.
Über den Autor:
AMA Research Consulting ist in der einzigartigen Position, mit Forschungs- und Beratungsdienstleistungen Unternehmen mit Wachstumsstrategien zu stärken und zu inspirieren, indem es Dienstleistungen mit außergewöhnlicher Tiefe und Breite an Vordenkern, Forschung, Tools, Veranstaltungen und Erfahrung anbietet, die bei der Entscheidungsfindung helfen.
Der Markt für Containerschifffahrt wird bis 2030 einen Umsatzanstieg verzeichnen
Sam Evans 11 September 2023
„Versand für Container
Global Market Vision hat einen Intelligence-Bericht mit dem Titel Versand für Container Market 2023 veröffentlicht, der die vollständige Mischung sorgfältiger Primär- und Sekundärforschung darstellt. Anschließend setzt die Forschungsstudie einen mehrschichtigen Authentifizierungsprozess fort, um alle erforderlichen quantitativen und qualitativen Erkenntnisse zu bereinigen, von denen Unternehmen profitieren könnten, indem sie direkt langfristige Entscheidungen treffen. Diese Forschungsmethodik wurde angewendet, um den globalen Versand für Container-Markt zu untersuchen, und diese Ergebnisse wurden logischerweise in diesem Bericht erwähnt.
Der Bericht klärt die Struktur der Wertschätzungskette, den modernen Standpunkt, die provinzielle Prüfung, Anwendungen, Marktgröße, Angebot und Vermutung. Im Explorationsbericht werden die sich schnell ändernde Branchensituation sowie der Beginn und die zukünftige Einschätzung der Auswirkungen dargelegt. Der Bericht bietet eine allgemeine Untersuchung des globalen Versand für Container-Marktes basierend auf Typen, Anwendungen, lokalen Untersuchungen und dem Messzeitraum von 2023 bis 2030. Die Berichte berücksichtigen auch Spekulationspotenziale und mögliche Risiken für den Markt je nach Untersuchung. Es wurde eine Analyse der Verbraucherbedürfnisse nach wichtigen Regionen, Typen und Anwendungen auf dem internationalen Markt unter Berücksichtigung der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Lage der Branche durchgeführt.
Laden Sie ein Beispiel herunter, um die vollständige Struktur des Berichts zu verstehen: https://globalmarketvision.com/sample_request/247477
Im globalen Versand für Container-Marktforschungsbericht erwähnte Hauptakteure:
Ceva Logistics, Mediterranean Shipping Company S.A., CMA-CGM SA, A.P. Moller-Maersk Group, China COSCO Holdings Company Limited, Deutsche Bahn AG., Nippon Express Co., Ltd, Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Hapag-Lloyd AG, Deutsche Post AG (DHL International GmbH)
Der Bericht identifiziert detaillierte Informationen zu führenden Wachstumstreibern, Einschränkungen, Herausforderungen, Trends und Möglichkeiten, um eine vollständige Analyse des globalen Versand für Container-Marktes anzubieten. Der Bericht führt auch eine Analyse der Wachstumstrends und -aussichten durch. Darüber hinaus enthält dieser Marktbericht eine ausführliche Bewertung der Marktwachstumsaussichten und -beschränkungen.
Der Bericht deckt alle Marktanteile und Ansätze der wichtigsten Wettbewerber bzw. der wichtigsten Marktteilnehmer ab. Solche Einblicke in die Wettbewerbslandschaft spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Entscheidung über die erforderlichen Verbesserungen des bereits auf dem Markt befindlichen Produkts oder des zukünftigen Produkts
lpha Augmented Services lässt die Luft aus dem Container
Die Logistikbranche transportiert wegen schlechter Beladung und zu großer Verpackungen viel Luft. Die Software des Schweizer Start-ups verspricht, Kosten und CO2 zu sparen.
Jakob Blume
09.09.2023 – 11:00 Uhr Kommentieren
Viele Container ließen sich einsparen – wenn Logistiker den Platz effizienter nutzen würden. Quelle: Luxy Images / vario images
Containerschiff bei der Beladung
Viele Container ließen sich einsparen – wenn Logistiker den Platz effizienter nutzen würden.
(Foto: Luxy Images / vario images)
Zürich Die Situation kennt jeder, der schon einmal Technik oder Möbel im Internet bestellt hat: Die Bestellung trifft in überdimensionierten Paketen ein. Neben der Ware selbst enthält die Box vor allem: Luft. Ähnlich wie den Kunden von Amazon oder Home24 geht es jedoch auch Großkonzernen.
Wenn sie Teile von einem Lieferanten erhalten, der selbst Produkte verschickt, sind auch diese oftmals zu großzügig verpackt. Zudem könnten Luftfracht-Paletten und Seecontainer besser genutzt werden. Das Schweizer Start-up Alpha Augmented Services ist angetreten, das zu ändern.
Massimo Rossetti, Co-Gründer und CEO von Alpha sagt: „Warensendungen sind heute alles andere als effizient genug.“ Ein per Schiff transportierter Standardcontainer sei im Schnitt nur zu 67 Prozent gefüllt. Der Rest sei Luft. Das bedeute: „Jeder dritte Container auf See ist unnötig“, sagt Rossetti.
Daher hat Alpha einen Algorithmus entwickelt, der für Warensendungen die optimale Beladung von Containern und Paletten berechnet. Zudem können Kunden auch die eigene Verpackung ihrer Waren auf Effizienz trimmen.
Was der Umbruch in der Container-Schifffahrt für Bremerhaven bedeutet
Bild: DPA | Sina Schuldt
Wegen veränderter Logistikströme stellen Reedereien wie MSC ihr Container-Geschäft um. Für Bremen und Bremerhaven gehen damit teure Investitionen, aber auch Chancen einher.
Seite teilen
Mit der MSC Cappellini ist vor Kurzem eines der weltweit größten Containerschiffe in Bremerhaven getauft worden. Dass die Reederei aus der Schweiz den Festakt mit mehr als 800 Ehrengästen an der Stromkaje veranstaltet hat, sollte auch ein Zeichen sein, betonte Nils Kahn, Geschäftsführer von MSC Deutschland: „Der deutsche Markt mit Bremen und Bremerhaven ist für MSC besonders relevant.“
Wir beschäftigen 370 Mitarbeiter und werden in Bremerhaven ein Büro eröffnen – für uns hat das eine strategische Relevanz.
Nils Kahn, Geschäftsführer von MSC Deutschland
Corona und Inflationen wirbeln Logistikströme durcheinander
Das Containergeschäft befindet sich in einem heftigen Umbruch. Corona-Pandemie und Inflationen haben die weltweiten Logistikströme vollkommen durcheinandergewirbelt. Auf vielen Strecken gibt es nach wie vor Verzögerungen, ganze Warenströme haben sich neue Wege gesucht – und beim Containergeschäft für Rückgänge in Häfen von rund 20 Prozent gesorgt. Die Reedereien stellen sich inzwischen neu auf – wie auch MSC, die aktuell weltgrößte Containerreederei.
Der in China gebaute Megafrachter „MSC Michel Cappellini“ liegt im Hafen von Bremerhaven.
Zeremonie geglückt: Weltgrößtes Containerschiff in Bremerhaven getauft
mit Video
Zwar läuft noch eine Allianz mit der dänischen Großreederei Maersk bis 2025, doch es gibt bereits erste Auflösungserscheinungen in der Zusammenarbeit. Mehr noch: MSC arbeitet offenbar schon daran, die eigenen Fahrpläne umzukrempeln. So will das Unternehmen in Bremerhaven einen neuen Fernost-Dienst etablieren – und zwar nach China.
Im September soll es damit bereits losgehen. Man reagiere auf die Nachfrage der Kunden, so MSC. Bis Shenzhen in China legen die Frachter nur zwei Stopps in Saudi-Arabien und Singapur ein.
Teure Investitionen in Bremerhaven notwendig
Um auch künftig die großen Schiffe in Bremerhaven abfertigen zu können, müssen jedoch mehrere Hundert Millionen Euro investiert werden. Das hat der Bremer Senat angekündigt. Gleichzeitig setzt man auf Unterstützung vom Bund – doch da passiert bislang zu wenig, sagt der neue Staatsrat für Häfen in Bremen, Kai Stührenberg (Linke): „Die zurzeit 40 Millionen für die deutschen Seehäfen werden nicht reichen.“
Der Beitrag des Bundes wird größer sein müssen.
Kai Stührenberg (Linke), Staatsrat für Häfen in Bremen
Hinzu kommt zunehmender Druck auf die Reeder, Schiffe mit nachhaltigen Antrieben zu entwickeln und auf die Strecken zu bringen – weg vom Schweröl. Eine spannende Gemengelage, in der Bremen auch Chancen sieht. „Wir sind in einem massiven Wettbewerb“, sagt Stührenberg. „Deswegen müssen wir leistungsfähig sein und uns modernisieren.“
Wenn wir in die Kaje investieren und hier einen weiteren zentralen MSC-Hub aufbauen können, haben wir etwas, was für die Zukunft von Bremen und Bremerhaven von großem Wert ist.
Kai Stührenberg (Linke), Staatsrat für Häfen in Bremen
Es braucht ein besseres Miteinander zwischen den Häfen
Hinter den Kulissen wird auch immer noch über eine mögliche Kooperation der Häfen von Bremerhaven, Bremen und Hamburg diskutiert. Die offiziellen Gespräche dazu sind aber wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt worden. Die Handelskammern von Bremen und Niedersachsen hatten zuletzt dafür plädiert, die Politik solle sich nicht in Unternehmensentscheidungen einmischen. Allerdings brauche es ein besseres Miteinander zwischen den Häfen.
Drei Lkw stehen vor geschlossenen Schranken. Im Hintergrund sind Container zu sehen.
Neues System soll Staus im Bremerhavener Containerhafen vermeiden
mit Audio
Auch MSC-Deutschland-Chef Kahn hält eine bessere Zusammenarbeit der Häfen für nötig. „Ich bin überzeugt davon, dass die Häfen in Deutschland mehr aneinanderrücken sollten und dass auch auf Bundesebene mehr Unterstützung für die Häfen geleistet wird.“
Weltweit größtes Containerschiff in Bremerhaven getauft
Weltweit größtes Containerschiff in Bremerhaven getauft
Bild: Radio Bremen
Mehr zum Thema:
Das Containerschiff Michel Capelllini liegt in einem chinesischen Hafen.
Größtes Containerschiff der Welt wird heute in Bremerhaven getauft
mit Audio
Blick auf die Schiffswerften im Überseehafen von Bremerhaven.
Schifffahrt im Wandel: Wie steht es um die Bremischen Häfen?
mit Audio
Autor
Dirk Bliedtner
Dirk Bliedtner
SchiffsfondsDer deutschen Containerschifffahrt steht das Wasser bis zum Hals
Teilen
Containerschiff
dpa/M. Gerten Viele Reedereien kämpfen wegen der gesunkenen Frachtraten mit Problemen
FOCUS-online-Experte Peter Riedel
Donnerstag, 10.08.2023, 12:07
Seit der Finanzkrise schreibt die deutsche Containerschifffahrt rote Zahlen. Das bringt Unternehmer und Landesbanken zunehmend in Bedrängnis. Jetzt hat mit Magellan Maritime Services aus Hamburg ein weiterer Global Player Insolvenz angemeldet.
In den vergangenen Jahrzehnten schipperte die deutsche Schifffahrtsbranche in vergleichsweise ruhigen Gewässern. Seit dem Zweiten Weltkrieg stiegen die Umsätze kontinuierlich– beflügelt durch die wachsende Weltbevölkerung, die Industrialisierung von wichtigen Handelspartnern wie China und die fortschreitende Globalisierung. Der Welthandel florierte. Immer mehr Reedereien wurden gegründet, die immer größere Containerschiffe bauten.
Diese goldenen Zeiten sind mittlerweile vorbei; der Branche weht seit 2008 eine steife Brise ins Gesicht. Denn die globale Finanzkrise löste in vielen Zielmärkten eine tiefe Rezession aus. Die Fracht- und Charterraten sind stark gesunken – viele Schiffe bleiben seither im Hafen liegen. Die Containerschiffe, die meist aufgrund von mangelndem Eigenkapital durch Kredite finanziert wurden, können Zins und Tilgung nicht mehr erwirtschaften. Vielen Unternehmen, besonders in Deutschland, steht das Wasser mittlerweile sprichwörtlich bis zum Hals.
Über den Experten
Kann man ein Schiff bauen, so groß, dass es nicht mal durch den Ärmelkanal passt? Man kann. Die »Seawise Giant« war 458 Meter lang, voll beladen hatte sie einen Tiefgang von 25 Metern. Zu viel für den Ärmelkanal, und erst recht für den Suez- oder Panamakanal. Aber das hatte einen ungeahnten Vorteil: Als das Schiff nach einem Angriff mit Fallschirmbomben im Iran-Irak-Krieg 1988 zerstört wurde, blieb der größte Teil über Wasser. So konnte der Tanker wieder flott gemacht werden und hieß fortan »Happy Giant«. Der Bau dieses Schiffes ist 44 Jahre her, der Rekord hält bis heute. Das ist erstaunlich, denn die Containerschifffahrt entwickelt sich nur in eine Richtung: groß, größer, noch größer.
Anzeige
Gleichzeitig steigt die Zahl der verlorenen Container auf See. Seit 2008 gingen im Durchschnitt etwa 1600 Container pro Jahr über Bord . Das Radar erkennt viele davon nicht, nachts sind sie unsichtbar, manche treiben knapp unter der Wasseroberfläche. Das gefährdet Schiffe, Boote und das Meer. Bislang hatte das in der Praxis kaum Konsequenzen für die Verursacher. Zwar kann jeder Container und damit der Transporteur über eine Nummer identifiziert werden. Und nach der Nairobi-Konvention zur Wrackbeseitigung trägt der Verursacher die Verantwortung für alles, was über Bord geht. Aber Container in 5000 Meter Tiefe werden nicht identifiziert. Und bei einer Kollision mit einem treibenden Container hat die Crew des betroffenen Schiffes oft ganz andere Sorgen, als die Nummer des Containers zu erfassen, den sie gerade gerammt hat.
ANZEIGE
So hoch ist die Pension im Vergleich zur Rente
Ein Angebot von
Nun wagt sich die International Maritime Organization (Imo), die Schifffahrtsabteilung der Uno, mit einer neuen Regel hervor: Demnach müssen Verluste künftig unverzüglich Schiffen und Booten in der Nähe gemeldet werden, damit die sich auf die Gefahr einstellen können. Bislang gilt das nur, wenn Gefahrstoffe im Spiel sind. Nahe gelegene Küstenstaaten sollen künftig ebenfalls schnell erfahren, dass wieder etwas, vielleicht gefährlich, vielleicht wertvoll, an ihren Stränden angetrieben wird oder in ihren Gewässern auf Grund geht.
Einen Entwurf hat der Imo-Sicherheitsausschuss im Juni verabschiedet, der Beschluss im nächsten Jahr wird wohl nur Formsache sein. Ab 2026 könnten Staaten bei Verstößen gegen die Meldepflicht Geldbußen verhängen. Das Verlieren von Containern per se dürfte jedoch meist folgenlos für die Verursacher bleiben, solange nicht jemand Schadensersatz verlangt. Immerhin werde eine Pflicht »diskutiert«, so die Imo, die verlorenen Container zu orten und möglichst zu bergen. Der dänische Branchenriese Maersk hält das für zu aufwendig. Das Geld sei besser in Maßnahmen angelegt, die die Verlustzahlen reduzierten. Hapag-Lloyd aus Hamburg hingegen sagt, man unterstütze das Projekt.
Anzeige
Riesenschiffe machen Riesenprobleme
Angesichts der Verlustzahlen und des steigenden Risikos durch immer größere Schiffe erscheint der Entwurf der Imo wie ein Trippelschritt. Er ändert nichts an der Ursache, sondern kann nur die Folgen mildern. Trotzdem geht das Rattenrennen vieler Reeder in die nächste Runde. Die größten Schiffe tragen inzwischen mehr als 24.000 Zwanzig-Fuß-Standardcontainer (TEU). Diese »ultragroßen« Schiffe sollen die Economies of Scale weiter ausreizen, also die Transportkosten pro Container bei hoher Stückzahl weiter verringern. Wenn die Schiffe voll ausgelastet sind, wirkt diese Effizienz auch beim Treibstoffverbrauch. Man kann die Riesen insoweit als umweltschonend betrachten. Allerdings ist dieser Vorteil schon ab einer Größe von etwa 12.000 TEU nicht mehr sehr bedeutend.
Die graduellen und keineswegs garantierten ökonomischen Vorteile gibt es nicht umsonst. Die Riesenschiffe machen Riesenprobleme. Drei Beispiele:
Erhöhte Brandgefahr: Der Schiffsversicherer Allianz rechnet damit, dass 2032 die Menge der transportierten Akkus achtmal so groß sein wird wie heute. Akkus können besonders heftig brennen. Feuer wie das auf dem Autotransporter »Fremantle Highway« sind schon an Land schwierig zu löschen. An Bord eines großen Schiffes wird es besonders kompliziert. Brände sind laut Allianz schon heute »einer der Hauptgründe für Versicherungsschäden auf Containerschiffen«. Selbst kleine Brände könnten die Ankunft des Schiffes so verspäten, dass erhebliche Ansprüche wegen gestörter Lieferketten entstehen. Mehr noch: Sie könnten zum Totalverlust des Schiffes führen, wenn die Crew mit der Brandbekämpfung überfordert sei und das Schiff aufgeben müsse.
Überlastete Infrastruktur: Ein 24.000-TEU-Schiff ist in drei Jahren gebaut, Häfen ächzen aber unter den nötigen Anpassungen für Brücken, Hafenbecken und Flusstiefen. Die dauern länger und kosten die Steuerzahler Milliarden. In manchen Häfen, so Allianz-Mann Justus Heinrich, hätten die Schiffe gar kein Wasser unterm Kiel, sodass sie »durch den Grund gleiten«. Ein solches Manöver, sagt Heinrich, »muss mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden – ein Auflaufen stellt ein erhebliches Risiko dar, wie eine Reihe von Zwischenfällen gezeigt hat«. Hinzu kommt der Aufwand für die enormen Containermengen. Schon ein 20.000-TEU-Schiff erzeugt bei einem typischen Hafenstopp laut Experten einen Umschlag von 8000 TEU, die möglichst rasch mit etwa 20 Eisenbahnzügen und 2800 Lkw hin- und hergefahren werden müssen.
Blockaden: Je größer ein Schiff, desto heikler das Manövrieren in Häfen und Kanälen. Wohin das führen kann, hat die »Ever Given« schon zweimal gezeigt: 2019 kam das 20.000-TEU-Schiff bei starkem Wind auf der Elbe vom Kurs ab und demolierte eine Hafenfähre. Zwei Jahre später bohrte sich der Bug der »Ever Given« im Suezkanal 15 Meter tief in eine Böschung . Der Sachschaden blieb überschaubar, aber ein Nadelöhr des Welthandels war blockiert. Mehr als 400 Schiffe stauten sich, viele weitere mussten den Umweg um Afrika nehmen. Wegen der Größe der »Ever Given« konnten Bagger und Schlepper sie erst nach sechs Tagen bei der nächsten Springtide bewegen.
Anzeige
Containerschifffahrtsmarkt – Branchentrends und Prognose bis 2030 | China Shipping Container Lines, HAPAG-LLOYD, HANJIN
Gigantische Menge an neuer Frachtkapazität im Bau Container-Giganten vor massiven Überkapazitäten – 890 neue Schiffe
Die Container-Reedereien produzieren offenbar gigantische Überkapazitäten. Steht die Branche vor einem riesigen Problem? Eine Analyse.
Veröffentlicht am 31. Juli 2023 18:13
von Claudio Kummerfeld Twitter Account von Claudio Kummerfeld
Facebook Twitter Xing LinkedIn Instagram E-Mail Kommentare
Ein Container-Schiff von MSC in Großbritannien
Die Reeder sind in einem gigantischen Kaufrausch. Wenn das mal kein schlechtes Omen ist? Bei den Container-Reedereien gerade in Deutschland sah man es nach der Finanzkrise 2008 massiv. Jahr für Jahr wurden immer mehr neue Schiffe fertiggestellt, die vor Ausbruch der Krise in den Glanzzeiten bestellt wurden. Aber der Bedarf war gar nicht mehr da – Stichwort Überkapazität! Die Preise für den Transport der Fracht fielen, und zahlreiche Reedereien und Banken gerieten massiv in Schieflage. Die HSH Nordbank aus Hamburg, der damals weltgrößte Schiffsfinanzierer, musste mit mehr als 10 Milliarden Euro Steuergeld aus Hamburg und Schleswig-Holstein gestützt werden. Noch lange Zeit werden die Steuerzahler der Nordländer an diesen Bürgschaften abzuzahlen haben.
Reedereien in einem Auf- und Abwärtszyklus
Aber nach der Krise 2008 kam nach einer gewissen Zeit der konjunkturelle Aufschwung. Die Flotten der Reedereien schrumpften aber noch einige Zeit. Aber irgendwann merkte man, dass zu wenig Schiffe da waren. Und der ganze Prozess kehrte sich um. Während der Coronakrise brach der Seehandel ganz zusammen. Aber dann nach Corona, als die Bestellungen in Asien nachgeholt wurden, explodierten die Frachtraten, und die Reedereien machten gigantische Gewinne wie noch nie zuvor. Denn die Nachfrage nach Transportkapazitäten per Schiff explodierten, aber es gab nicht genug Containerschiffe. Also bestellten die großen Reedereien massenhaft neue Schiffe bei den großen Werften in Südkorea und China.
Und nun wiederholt sich das Spiel, das Pendel schlägt wieder in die andere Richtung aus? Stehen wir vor einer neuen Krise der Reedereien, die in den letzten beiden Jahren gigantische Gewinne machten? Ihre zahlreichen Bestellungen neuer Schiffe, die nun nach und nach fertiggestellt werden, erhöhen die Frachtkapazität immer mehr, und es kann mal wieder zu immensen Überkapazitäten auf den Weltmeeren kommen, was einbrechende Frachtraten bedeuten könnte.
Schifffahrtsunternehmen sind auf einem Kaufrausch
Die größten Schifffahrtsunternehmen der Welt stecken ihre Corona-Gewinne in Aufträge für neue Schiffe in einem noch nie da gewesenen Ausmaß, was eine Branche, die für haarsträubende Zyklen von Boom und Pleite bekannt ist, im jüngsten Abschwung noch anfälliger macht, so drückt es Bloomberg aktuell aus. Weiter schreibt man: Containerschifffahrtsunternehmen wie MSC Mediterranean Shipping, A.P. Moller-Maersk, CMA CGM und Hapag-Lloyd – allesamt teilweise im Besitz europäischer Milliardäre – geben die während der Gesundheitskrise erzielten Rekordgewinne aus, um sich mit neuen Modellen zu schmücken, die hauptsächlich von koreanischen und chinesischen Werften geliefert werden. Dies hat die weltweite Auftragspipeline auf ein historisches Niveau gebracht – nach einer Schätzung fast 90 Milliarden Dollar.
Doch das Blatt hat sich in dem notorisch zyklischen Sektor gewendet, da die Frachtraten mit einem Niveau unterhalb der Gewinnschwelle liebäugeln und die Angst vor Überkapazitäten wieder aufkommt. „Es wurden zu viele große Containerschiffe bestellt“, sagte Erik I. Lassen, Vorstandsvorsitzender von Danish Ship Finance A/S, einem Unternehmen, das Schiffsfinanzierungen anbietet. Er wies darauf hin, dass die Auslieferungen jetzt zu einem Zeitpunkt beginnen, an dem die Lieferketten reibungsloser laufen und die Nachfrage nach Frachttransporten wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat.
„Es wird Schiffseigner – Tonnageanbieter – geben, die sich überfordert haben“, sagte er in einem Interview. „Obwohl die letzten Jahre für die Schifffahrt profitabel waren, reichen die kumulierten Erträge bei weitem nicht aus, um die Investitionen in neue Technologien und Schiffe im kommenden Jahrzehnt zu finanzieren.“
Trübere Aussichten
Die Aussichten haben sich für die Tycoons eingetrübt, deren Unternehmen einen Chor negativer Prognosen für die kommenden Monate angestimmt haben. Am Freitag warnte die französische CMA CGM, die von dem Milliardär Rodolphe Saade und seiner Familie kontrolliert wird, vor einer Verschlechterung der Marktbedingungen und erklärte, dass neue Schiffskapazitäten „wahrscheinlich die Frachtraten belasten werden“.
Anfang dieses Monats senkte die Zim Integrated Shipping Services Ltd. ihre Finanzprognose für 2023 aufgrund eines unerwartet niedrigen Mengenwachstums und schwacher Raten. Der dänische Schifffahrtsriese Maersk hat prognostiziert, dass das weltweite Containertransportvolumen in diesem Jahr um bis zu 2,5 % schrumpfen könnte, und hat außerdem vor einem aufkommenden Risiko auf der Angebotsseite in der zweiten Jahreshälfte gewarnt. Die deutsche Hapag-Lloyd sagte, dass das Angebot in diesem und im nächsten Jahr wahrscheinlich die Nachfrage übersteigen wird.
Matson Inc. – ein kleinerer Konkurrent und ein Indikator für den Warenfluss von China nach Nordamerika – sagte am 20. Juli, dass es in den kommenden Monaten eine „gedämpfte Hochsaison“ erwartet, da „die Einzelhändler angesichts der geringeren Verbrauchernachfrage weiterhin ihre Lagerbestände sorgfältig verwalten“. Das in Honolulu ansässige Unternehmen Matson kündigte im November letzten Jahres Pläne zum Kauf von drei neuen Schiffen für rund 1 Milliarde Dollar an. Insgesamt geht der Internationale Währungsfonds davon aus, dass das Handelsvolumen in diesem Jahr nur um 2 % zunehmen wird, was eine deutliche Verlangsamung gegenüber den geschätzten 5,2 % im Jahr 2022 bedeutet.
IWF-Prognose für das globale Handelsvolumen
890 neue Schiffe
Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ein Auftragsbestand für neue Containerschiffe ab, den Drewry Maritime Research zum 1. Juli mit 890 Schiffen beziffert, was 28 % der derzeitigen weltweiten Kapazität, gemessen in 20-Fuß-Äquivalenten, entspricht. Laut Drewrys jüngstem Container Forecaster dürften allein in diesem Jahr 1,75 Millionen TEU ausgeliefert werden, was etwa 6,6 % der Gesamtflotte entspricht, ohne Berücksichtigung von Abwrackungen. Es wird erwartet, dass die Nettokapazität im nächsten Jahr um den Rekordwert von 1,82 Millionen TEU und im Jahr 2025 um 1,4 Millionen TEU auf 30,5 Millionen TEU ansteigen wird, was einem Zuwachs von fast 55 % im Vergleich zu den letzten zehn Jahren entspricht.
„Wir haben es hier mit dem größten Auftragsbestand in der Geschichte der Containerschifffahrt zu tun“, sagt Branchenveteran John McCown, Gründer von Blue Alpha Capital. „Sie haben ihre Bilanzen bereinigt und reinvestieren jetzt. Er schätzt, dass die Pipeline an neuen Schiffen die Reeder etwa 89,5 Milliarden Dollar kosten wird, wenn man die Kosten für den Bau von Schiffen einer durchschnittlichen Größenordnung zugrunde legt.
Eine Reihe europäischer Milliardäre kontrolliert einige der größten Containerlinien der Welt, darunter der Saade-Clan. Der in der Schweiz ansässige Gianluigi Aponte, Gründer von MSC, Klaus-Michael Kühne, der einen Anteil von 30 % an Hapag-Lloyd hält, und die Familie des Maersk-Vorsitzenden Robert Maersk Uggla, Urenkel des Firmengründers.
Laut Bloomberg Billionaires Index ist Kühne mit einem Nettovermögen von 46 Milliarden Dollar die reichste Person in Deutschland, während Saade und seine Familie 23 Milliarden Dollar und Aponte 21 Milliarden Dollar besitzen.
Ein Motiv für die Bestellung neuer Schiffe und die Aufrüstung der Motoren bestehender Schiffe ist die Eindämmung des Klimawandels. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) möchte, dass die Branche bis zum Jahr 2050 netto keine Treibhausgasemissionen mehr ausstößt, mit Zwischenzielen in den Jahren 2030 und 2040. Die Verfügbarkeit von emissionsfreien Kraftstoffen ist derzeit praktisch gleich null.
Maersk hat im vergangenen Monat sechs mit Methanol betriebene Containerschiffe bestellt, womit sich die Gesamtzahl auf 25 erhöht. Ende letzten Jahres verfügte Hapag-Lloyd über einen Auftragsbestand von 15 Neubauten mit Auslieferungen im Zeitraum 2023-2025.
CMA CGM hat mit 1,24 Mio. TEU den zweitgrößten Auftragsbestand der Welt, so dass das französische Unternehmen laut dem Branchenanalysten Alphaliner in der Lage sein wird, Maersk im Jahr 2026 zu überholen.
„In den letzten Jahren war die in Marseille ansässige Reederei bei der Vergabe von Neubauaufträgen äußerst aggressiv“, so Alphaliner diesen Monat in einem Bericht, in dem der Auftragsbestand auf 122 Schiffe und 1,24 Millionen TEU beziffert wird. Die Flottenerweiterung von MSC, der Nummer 1 im Ranking, ist laut Alphaliner teilweise auf den Kauf von Schiffen aus zweiter Hand zurückzuführen.
Ramon Fernandez, Chief Financial Officer von CMA CGM, sagte, das Unternehmen habe etwa 100 Schiffe in Auftrag gegeben, von denen die meisten mit LNG oder Methanol angetrieben werden sollen. Er lehnte es ab, genauere Angaben zu machen, räumte aber die Möglichkeit von Überkapazitäten ein.
„Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich unter Druck geraten, weil die Kapazität stärker wachsen wird als der Handel“, sagte er und fügte hinzu, dass die Abwrackung und Außerdienststellung älterer, umweltschädlicherer Schiffe die Auswirkungen dämpfen könnte, ebenso wie die Einführung langsamerer Motordrehzahlen, um die Emissionen zu verringern.
Die Pläne für den Bau von Schiffen erinnern an die Vorgeschichte des Rückgangs in diesem Sektor. CMA CGM stand 2009 am Rande der Zahlungsunfähigkeit, als die weltweite Finanzkrise den Handel in die Knie zwang. Doch dieses Mal sind die Kassen voller. Dies spiegelt sich in der bislang gedämpften Kreditnachfrage wider.
Die Kreditvergabe der Banken, traditionell eine der wichtigsten Finanzierungsquellen für die Branche, ist im vergangenen Jahr nicht im Einklang mit dem Auftragsbestand gestiegen und könnte 2023 stagnieren, so Petrofin Research in seinem Jahresbericht über die globale Schiffsfinanzierung. Darüber hinaus hat sich ein zweigeteilter Kreditmarkt herausgebildet, auf dem die Kreditgeber für Schiffe mit geringeren Emissionen bessere Konditionen anbieten.
„Schiffseigner werden mehr und mehr wie Banken und nutzen die Risikomentalität, die man bei Banken sieht“, so Lassen. „Sie werden viel anspruchsvoller als das allgemeine Bild, das man vielleicht von den alten Tagen des ‚billig kaufen und teuer verkaufen‘ hat.“
FMW: Ist es an der Zeit, dass Anleger sich aus Schifffahrtsaktien zurückziehen, weil der Zyklus der Mega-Gewinne endet, und nun drohende Überkapazitäten auf der Branche lasten? Augen auf, kann man da nur sagen!
FMW/Bloomberg
Kommentare lesen un
„Containerschifffahrt
Global Market Vision hat effektive statistische Daten mit dem Titel „Global Containerschifffahrt Market“ veröffentlicht, in denen Benutzer vom vollständigen Marktforschungsbericht mit allen erforderlichen nützlichen Informationen zu diesem Markt profitieren können. Der Bericht definiert die jüngsten Innovationen auf dem Markt. Der Bericht hebt die Segmentanalyse hervor, in der wichtige Typen, Anwendungen und regionale Segmente diskutiert werden. Alle führenden Akteure auf der ganzen Welt werden mit unterschiedlichen Begriffen wie Produkttypen, Branchenumrissen und Verkäufen profiliert. Der Bericht wurde unter Berücksichtigung eines systematischen Ansatzes zur Identifizierung, Bewertung und Bewältigung der Kerndynamiken im Markt konzipiert. Der Bericht liefert eine detaillierte Analyse der globalen Containerschifffahrt-Branche unter Berücksichtigung von Typ, Anwendung, Marktwert, Produktionskapazität, Unternehmen, Region usw.
Die Anbieterlandschaft und die Wettbewerbsszenarien des globalen Containerschifffahrt-Marktes werden umfassend analysiert, um Marktteilnehmern dabei zu helfen, Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten zu erzielen. Den Lesern wird eine detaillierte Analyse wichtiger Wettbewerbstrends des globalen Containerschifffahrt-Marktes zur Verfügung gestellt. Mit der Analyse können sich Marktteilnehmer frühzeitig auf künftige Herausforderungen vorbereiten. Sie werden auch in der Lage sein, Möglichkeiten zu erkennen, um eine starke Position auf dem globalen Containerschifffahrt-Markt zu erreichen. Darüber hinaus wird die Analyse ihnen helfen, ihre Strategien, Stärken und Ressourcen effektiv zu kanalisieren, um auf dem globalen Containerschifffahrt-Markt maximale Vorteile zu erzielen.
Fordern Sie ein Muster mit vollständigem Inhaltsverzeichnis sowie Abbildungen und Grafiken an @ https://globalmarketvision.com/sample_request/46223
Der Bericht konzentriert sich auch auf einige wichtige Wachstumsaussichten, darunter die Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen, Forschung und Entwicklung, Joint Ventures, Kooperationen, Vereinbarungen, Partnerschaften und das Wachstum wichtiger Akteure im Containerschifffahrt auf regionaler und globaler Ebene.
Containerschifffahrt Markt deckt folgende Hauptakteure ab:
China Shipping Container Lines, HAPAG-LLOYD, HANJIN, China Ocean Shipping, MAERSK, Mediterranean Shipping.
Der aktuelle Bericht über Containerschifffahrtmarket bietet eine vollständige Analyse dieses Geschäftsbereichs mit Schwerpunkt auf dem Rückgrat der Branche: aktuelle Trends, aktueller Wert, Branchengröße, Marktanteil, Produktions- und Umsatzprognosen für den Prognosezeitraum.
Marktsegmentierung:
Basierend auf dem Typ wird der Markt segmentiert
20 Fuß (6,09 m), 40 Fuß (12,18 m), 45 Fuß (13,7 m), 48 Fuß (14,6 m), 53 Fuß (16,15 m)
Basierend auf der Anwendung wird der Markt unterteilt
Industrie, Landwirtschaft, Automobil, Sonstiges
Geografisch erfolgt die detaillierte Analyse von Verbrauch, Umsatz, Marktanteil und Wachstumsrate der folgenden Regionen:
Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)
Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Taiwan, Südkorea, Australien, Indonesien, Singapur, Malaysia, Rest Asien-Pazifik)
Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Russland, übriges Europa)
Mittel- und Südamerika (Brasilien, Argentinien, übriges Südamerika)
Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, übriger Naher Osten und Afrika)
Der Bericht vermittelt ein Verständnis der Marktzusammensetzung und erläutert die Rolle etablierter Akteure und der regionalen Mitwirkenden. Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 kommt es bei der weltweiten Nachfrage zu Unregelmäßigkeiten. Basierend auf den Beobachtungen unserer Analysten wird im Jahr 2023 mit einem Wiederaufleben gerechnet. Für die Marktteilnehmer ist es wichtig, in unsicheren Zeiten kalkulierte Schritte zu unternehmen und sich auf die Kundenbindung zu konzentrieren, indem sie langfristige Partnerschaften eingehen. Um ihren Anteil zu halten, setzen die Marktteilnehmer auf die Kundenbindung. Es wird erwartet, dass die Laufzeit der nächsten fünf Jahre dem Markt auf globaler Ebene ein gesundes Wachstum bescheren wird.
Häufig gestellte Fragen (FAQ):
Wie groß ist der Markt Containerschifffahrt?
Was sind einige der Haupttreiber für diesen Markt?
Wer sind die Hauptakteure auf dem Containerschifffahrt-Markt?
Welche Auswirkungen hat COVID-19 auf den Containerschifffahrt-Markt?
Welche Region hat das höchste Wachstumspotenzial im Containerschifffahrt-Markt?
Hervorhebung der wichtigsten Punkte im Containerschifffahrt-Marktbericht:
Wichtige Statistiken zum globalen Containerschifffahrt Marktstatus und den wichtigsten Herstellern.
Grundszenario des Zielmarktes mit seinen verschiedenen Anwendungen und Technologien, Definition.
Der Bericht bietet das Unternehmensprofil, die Kapazität, den Produktionswert, die Produktspezifikationen und die Marktanteile für jeden wichtigen Anbieter.
Detaillierte Marktsegmentierung nach Typ, Unternehmen, Anwendung und Region für die Wettbewerbsanalyse.
Genaue Berichtsschätzung mit Marktentwicklungstrends der globalen Containerschifffahrt-Industrie.
Umfassende Analyse der vorgelagerten Rohstoffe, der nachgelagerten Nachfrage und der jüngsten Wachstumsaussichten des Containerschifffahrt-Marktes.
Gründliche geografische Landschaft mit vorherrschenden Regionen.
Gründe für den Kauf:
Beschaffen Sie strategisch wichtige Wettbewerbsinformationen, Analysen und Erkenntnisse, um effektive F&E-Strategien zu formulieren.
Erkennen Sie aufstrebende Akteure mit potenziell starkem Produktportfolio und entwickeln Sie wirksame Gegenstrategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Ordnen Sie potenzielle Neukunden oder Partner der Zielgruppe zu.
Entwickeln Sie taktische Initiativen, indem Sie die Schwerpunktbereiche führender Unternehmen verstehen.
Planen Sie Fusionen und Übernahmen sinnvoll, indem Sie Top-Hersteller identifizieren.
Formulieren Sie Korrekturmaßnahmen für Pipeline-Projekte, indem Sie die Containerschifffahrt Pipeline-Tiefe verstehen.
Entwickeln und entwerfen Sie Ein- und Auslizenzierungsstrategien, indem Sie potenzielle Partner mit den attraktivsten Projekten identifizieren, um das Geschäftspotenzial und den Umfang zu steigern und zu erweitern.
Der Bericht wird mit den neuesten Daten aktualisiert und Ihnen
|https://www.blick.ch/ausland/mega-frachter-gekentert-knapp-400-tonnen-treibstoff-drohen-auszulaufen-id18781264.html?utm_medium=social&utm_campaign=share-button&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1tFbagihopMJS6LdE10_p5ypU_msNUHZPsjUNvfBGEVMB6Ay0fVr3okL8
Ausland
|
Containergeschäft kommt wieder in Schwung
Der Containerschifffahrtsmarkt wird bis 2030 ein herausragendes Wachstum verzeichnen
Sam Evans 16 Juli 2023
„Containerschifffahrt
Der Global Containerschifffahrt -Marktbericht wurde unter Berücksichtigung aller zwingenden Teile der Marktforschung geplant, die die Marktszene im Wesentlichen ins Zentrum des Interesses rücken. Die CAGR-Wert-Varianzrate für den Markt innerhalb der geschätzten Zeit kann ebenfalls mit dem Containerschifffahrt-Marktbericht abgerufen werden. Der Umfang dieses Containerschifffahrt Marktforschungsberichts kann als Markttrends, Kundenerfahrungen, Marktmessung und -schätzung, Wettbewerbsanalyse, Bewertungsmuster, Entwicklungsmuster, Innovationsfortschritt und Bewertung der Vertriebskanäle dargestellt werden. Volle Hingabe, Verantwortung, Flexibilität und integrierte Methoden werden bei der Strukturierung dieses Containerschifffahrt Marktforschungsberichts in hohem Maße berücksichtigt.
Laden Sie eine Musterkopie des Berichts herunter, um die Struktur des vollständigen Berichts zu verstehen (einschließlich des vollständigen Inhaltsverzeichnisses, der Tabelle und der Abbildungen) @ https://globalmarketvision.com/sample_request/46223
Der Global Containerschifffahrt Market-Bericht enthält auch eine eingeschränkte entscheidende Zusammenfassung des Marktes. Darüber hinaus werden im Bericht auch mehrere Faktoren untersucht, die den Fortschritt und die Verbesserung sowohl positiv als auch negativ beeinflusst haben. Im Gegenteil, die verschiedenen Faktoren, die im prognostizierten Zeitraum als Chancen für die Entwicklung und das Wachstum des globalen Containerschifffahrt-Marktes dienen werden, werden ebenfalls erwähnt.
Einige der Hauptakteure auf dem globalen Containerschifffahrt-Markt sind Unternehmensabdeckung (Unternehmensprofil, Umsatz, Preis, Bruttomarge, Hauptprodukte usw.):
China Shipping Container Lines, HAPAG-LLOYD, HANJIN, China Ocean Shipping, MAERSK, Mediterranean Shipping.
Der Bericht befasst sich eingehend mit allen Marktrisiken und -chancen. Es enthält alle wichtigen Informationen zu den neuesten Technologien und Trends, die von den Anbietern in diesem Markt übernommen oder verfolgt werden. Der Bericht befasst sich eingehend mit allen Marktrisiken und -chancen. Die im Bericht behandelte Analyse hilft Herstellern in der globalen Containerschifffahrt-Branche, die vom Weltmarkt gebotenen Risiken zu eliminieren. Der Marktforschungsbericht bietet den Lesern auch eine vollständige Dokumentation der vergangenen Marktbewertung, der aktuellen Dynamik und Zukunftsprognosen zu Marktvolumen und -größe.
Globale Containerschifffahrt Marktsegmentierung:
Industrie, Landwirtschaft, Automobil, Sonstiges
Im Bericht behandeltes geografisches Segment:
Der Containerschifffahrt-Bericht gibt Auskunft über das Marktgebiet, das weiter in Unterregionen und Länder/Regionen unterteilt ist. Neben den Marktanteilen in den einzelnen Ländern und Unterregionen enthält dieses Kapitel dieses Berichts auch Informationen zu Gewinnchancen. In diesem Kapitel des Berichts werden der Marktanteil und die Wachstumsrate jeder Region, jedes Landes und jeder Unterregion im geschätzten Zeitraum erwähnt.
Naher Osten und Afrika (GCC-Länder und Ägypten)
Nordamerika (USA, Mexiko und Kanada)
Südamerika (Brasilien usw.)
Europa (Türkei, Deutschland, Russland, Großbritannien, Italien, Frankreich usw.)
Asien-Pazifik (Vietnam, China, Malaysia, Japan, Philippinen, Korea, Thailand, Indien, Indonesien und Australien)
COVID-19-Auswirkungsanalyse:
In diesem Bericht werden die Auswirkungen von Prä- und Post-COVID auf das Marktwachstum und die Marktentwicklung zum besseren Verständnis des Containerschifffahrt-Marktes basierend auf der Finanz- und Industrieanalyse gut dargestellt. Die COVID-19-Pandemie hat eine Reihe von Märkten betroffen und Global Containerschifffahrt Market ist keine Ausnahme. Die dominierenden Akteure des globalen Containerschifffahrt-Marktes sind jedoch entschlossen, neue Strategien zu verfolgen und nach neuen Finanzierungsressourcen zu suchen, um die zunehmenden Hindernisse des Marktwachstums zu überwinden.
Die wichtigsten Fragen, die im Bericht beantwortet wurden:
Was sind die Hauptfaktoren, die diesen Markt auf die nächste Stufe treiben?
Was ist die Marktnachfrage und was ist Wachstum?
Was sind die neuesten Chancen für den Containerschifffahrt-Markt in der Zukunft?
Was sind die wichtigsten Spielervorteile?
Was ist der Schlüssel zum Containerschifffahrt-Markt?
Studienziele des Containerschifffahrt Marktberichts:
Bereitstellung einer detaillierten Analyse der Marktstruktur zusammen mit der Containerschifffahrt-Marktprognose verschiedener Segmente und Untersegmente des Containerschifffahrt-Marktes
Einblicke in Faktoren geben, die das Marktwachstum beeinflussen und beeinflussen
Bereitstellung historischer, aktueller und prognostizierter Umsätze von Marktsegmenten basierend auf Material, Typ, Design und Endbenutzer
Bereitstellung historischer, aktueller und prognostizierter Umsätze von Marktsegmenten und Untersegmenten in Bezug auf regionale Märkte und Schlüsselländer
Bereitstellung einer strategischen Profilierung der Hauptakteure auf dem Markt, umfassende Analyse ihrer Marktanteile und Kernkompetenzen und Erstellung einer Wettbewerbslandschaft für den Markt
Bereitstellung von wirtschaftlichen Faktoren, Technologien und Containerschifffahrt Markttrends, die den globalen Containerschifffahrt Markt beeinflussen
Erhalten Sie den Forschungsbericht innerhalb von 48 Stunden @ https://globalmarketvision.com/checkout/?currency=USD&type=single_user_license&report_id=46223
Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, teilen Sie uns dies bitte mit und wir bieten Ihnen den Bericht zu einem maßgeschneiderten Preis an.
Über die globale Marktvision
Global Market Vision besteht aus einem ambitionierten Team junger, erfahrener Leute, die sich auf die Details konzentrieren und die Informationen nach den Bedürfnissen der Kunden bereitstellen. Informationen sind in der Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung, und wir sind darauf spezialisiert, sie zu verbreiten. Unsere Experten verfügen nicht nur über fundiertes Fachwissen, sondern können auch einen umfassenden Bericht erstellen, der Sie bei der Entwicklung Ihres eigenen Geschäfts unterstützt.
Mit unseren Reports treffen Sie wichtige taktische Geschäftsentscheidungen mit der Gewissheit, dass sie auf genauen und fundierten Informationen beruhen. Unsere Experten können alle Bedenken oder Zweifel an unserer Genauigkeit ausräumen und Ihnen helfen, zwischen zuverlässigen und weniger zuverlässigen Berichten zu unterscheiden, wodurch das Risiko von Entscheidungen verringert wird. Wir können Ihren Entscheidungsprozess präzisieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele erhöhen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Sarah Ivans | Geschäftsentwicklung
Telefon: +1 617 297 8902
E-Mail: sales@globalmarketvision.com
Global Market Vision
Website: www.globalmarketvision.com
“
Ampelfraktionen beschließen Strategie für maritime Wirtschaft
Veröffentlicht 4. Juli 2023
Berlin: Die Regierungskoalition will die maritime Wirtschaft in Deutschland von Abhängigkeiten gegenüber Asien lösen. SPD, Grüne und FDP haben am Dienstagabend in ihren Fraktionssitzungen einen Antrag mit 66 Maßnahmen zur Stärkung von Werften, Häfen und Wasserstraßen beschlossen, über den das “Handelsblatt” (Mittwochausgabe) berichtet.
Die Ampel schlägt unter anderem den Aufbau einer “klimaneutralen Bundesflotte” an Schiffen vor. Der Staat als Nachfrager könnte einen Anschub bei der Umstellung von Schiffen auf Kraftstoffe wie Methanol, Ammoniak oder Wasserstoffsorgen leisten. Darüber hinaus will man die Energiewende antreiben. Für Offshore-Windenergie sind bislang Flächen in Nord- und Ostsee für bis zu 36,5 Gigawatt an neuer Leistung ausgewiesen.
Die Ampel fordert weitere Flächen: Weitere zehn Gigawatt sollen ausgewiesen werden, heißt es im Antrag. Das soll der Werftenindustrie helfen, die die “Konverterplattformen” für die Windparks auf dem Meer produzieren. “Wir wollen möglichst viel heimische Wertschöpfung bei uns im Land zu halten”, sagte Dieter Janecek (Grüne), maritimer Koordinator der Bundesregierung, dem “Handelsblatt”. Zudem will die Ampel die deutschen Häfen vor weiteren Verlusten an Marktanteilen schützen.
Die Fraktionen schlagen in ihrer Strategie vor, an den deutschen Häfen dauerhaft die notwendige Infrastruktur für den Import und die Lagerung von alternativen Energieträgern und Kraftstoffen zu schaffen. Sie kündigen zudem finanzielle Förderungen an. Außerdem will die Ampel die Infrastruktur stärker schützen. Sie schlägt vor, eine “Deutsche Küstenwache” zu schaffen.
Darin würden die Einheiten von Bund und Küstenländern zusammengeführt.
Ampel will Abwärtstrend der maritimen Wirtschaft stoppen
SPD, Grüne und FDP haben eine Wasserwirtschafts-Strategie mit 66 Maßnahmen beschlossen. Die maritime Wirtschaft soll wieder souverän werden – dank einer neuen Rolle des Staates.
Daniel Delhaes
Julian Olk
05.07.2023 – 16:30 Uhr Kommentieren
Die Aufträge in den deutschen Werften gehen zurück. Quelle: imago stock&people
Kreuzfahrtschiff Queen Mary 2 im Trockendock von Blohm und Voss in Hamburg
Die Aufträge in den deutschen Werften gehen zurück.
(Foto: imago stock&people)
Berlin Mit einem 66 Punkte umfassenden Maßnahmenpaket will die Ampelkoalition der Sorge entgegentreten, dass die zunehmende Dominanz asiatischer Staaten beim Schiffsbau, in der Wasserstraßen-Infrastruktur und bei Energietransporten über das Meer die deutsche Wirtschaft in neue Abhängigkeiten bringt. Deshalb will sie die heimische maritime Wirtschaft stärken und in die Lage versetzen, bei der Energiewende eine entscheidende Rolle zu spielen.
Geht es nach SPD, Grünen und FDP, dann soll der Staat zentraler Akteur bei der Ertüchtigung der maritimen Wirtschaft werden. So steht es in einem Antrag, den die Fraktionen am Dienstagabend beschlossen haben. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. „Der Antrag ist ein ambitionierter Auftrag an die Bundesregierung“, sagte Felix Banaszak von den Grünen.
Die Ampel schlägt unter anderem vor, eine „klimaneutrale Bundesflotte“ aufzubauen. Die Bestellungen sollen helfen, die Transformation im Schiffbau voranzutreiben. International will sich die Ampelkoalition dafür einsetzen, dass die Schifffahrt bis 2050 klimaneutral wird. Vermutlich wird dies mit Wasserstoff geschehen. Bisher sind alternative Antriebe sehr teuer, weshalb der Umstieg kaum erfolgt.
Werften: Energiewende birgt Billionen-Potenzial
Die maritime Wirtschaft in Deutschland hat sich gewandelt. Inzwischen dominieren Zukunftsängste. Viele Werften fielen in den vergangenen Jahren mehr durch existenzbedrohende Finanzprobleme als durch neue Großaufträge auf. Nach Angaben des Verbands Schiffbau und Meerestechnik (VSM) ging im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte aller Aufträge für zivile Schiffe nach China. Weitere fast 40 Prozent der Aufträge erhielten Werften in Südkorea. Damit steigt die Abhängigkeit der europäischen Schifffahrt.
Themen des Artikels
Schifffahrt
FDP
Wirtschaftspolitik
Russland
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
Den Abwärtstrend will die Regierungskoalition stoppen. „Wir wollen möglichst viel heimische Wertschöpfung bei uns im Land halten“, sagte Dieter Janecek (Grüne), maritimer Koordinator der Bundesregierung, dem Handelsblatt. Schließlich gibt es in den kommenden Jahren viel Geld im Bereich Energie zu verdienen: So rechnet die Bundesregierung damit, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als 400 Gigawatt Offshore-Windleistung in Nord- und Ostsee in Europa installiert werden. „Damit verbunden ist ein gigantisches Investitionsvolumen von bis zu einer Billion Euro“, sagte Janecek.
Auch die deutschen Häfen liegen im internationalen Vergleich zurück. Quelle: IMAGO/Nikito
Containerschiff kommt im Hamburger Hafen an
Auch die deutschen Häfen liegen im internationalen Vergleich zurück.
(Foto: IMAGO/Nikito)
So gilt es, etwa riesige „Konverterplattformen“ auf dem Meer zu fertigen. „Wir wollen möglichst viel heimische Wertschöpfung bei uns im Land halten“, sagte Janecek. In Deutschland liegt das gesetzlich festgelegte Ausbauziel für die Offshore-Windenergie bei 40 Gigawatt bis 2035. Bereits ausgewiesen sind Flächen in Nord- und Ostsee für bis zu 36,5 Gigawatt an neuer Leistung. Die Ampel will nun noch mehr Tempo machen und weitere Flächen für zehn Gigawatt Leistung ausweisen.
Häfen: Gegen den Abwärtstrend
Neben der Schiffsindustrie nimmt die Koalition auch die Häfen in den Blick. Zuletzt hatten die Parteien heftig gestritten, ob – angesichts der neuen geopolitischen Lage – die chinesische Staatsreederei Cosco sich an einem Terminal im Hamburger Hafen beteiligen sollte.
>> Lesen Sie hier: Bundesregierung erlaubt chinesischer Reederei Cosco Beteiligung an Hamburger Terminal
Viele Häfen gelten als kritische Infrastruktur. Ebenso hat sich gezeigt, dass sie wichtig sind, um das Land mit Energie zu versorgen. So wurden Schiffe für Flüssiggas-Transporte (LNG) gechartert, um russische Gaslieferungen zu ersetzen. Ebenso entstanden rasch erste Terminals.
Die Fraktionen schlagen vor, an den deutschen Häfen dauerhaft die notwendige Infrastruktur zu schaffen, um Gas, Wasserstoff und andere Energieträger zu importieren und zu lagern. „Unsere Häfen können die Drehscheiben eines erneuerbaren Energiesystems werden“, sagte Banaszak.
>> Lesen Sie hier: CDU und CSU wollen die Schiffsproduktion in Europa schützen
Den Bau will die Koalition finanziell fördern. „Unser Antrag ist der Startschuss, um die politischen Rahmenbedingungen an die neue Lage in der Welt anzupassen“, erklärte Hagen Reinhold, maritimer Sprecher der FDP.
Die Häfen benötigen neuen Schwung. Die deutschen Seehäfen – allen voran Hamburg – verlieren zunehmend Marktanteile an die Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen. Auch die polnischen Häfen und jene im Mittelmeer machen den heimischen Seehäfen zu schaffen.
2022 sank hierzulande der Güterumschlag mit insgesamt 279,1 Millionen Tonnen um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die Häfen schlugen 6,3 Prozent weniger Container um. Gemessen am Vorkrisenniveau des Jahres 2019 war die Tonnage um 4,9 Prozent rückläufig. Insbesondere die fehlenden russischen Schiffstransporte über die Ostsee treffen die deutschen Häfen.
Sicherheit: Einrichtung einer gesamtdeutschen Küstenwache
Neben Faktoren rund um die Wirtschaftssicherheit geht es im Antrag der Ampel auch um die Frage, wie sie die Sicherheit in der maritimen Infrastruktur gewährleisten kann. Seit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines besteht die Sorge, dass es weitere Anschläge auf andere Pipelines geben könnte, was die hiesige Energieversorgung gefährden würde.
>> Lesen Sie hier: Drei Reeder-Kartelle verdienen Milliarden an Lieferengpässen – und die EU schaut zu
Deshalb schlägt die Ampel vor, eine „Deutsche Küstenwache“ zu schaffen. Darin würden die Einheiten von Bund und Küstenländern zusammengeführt. Zudem müsse der Schutz maritimer kritischer Infrastrukturen behördenübergreifend organisiert werden, etwa im Maritimen Sicherheitszentrum (MSZ) in Cuxhaven.
An diesem Freitag will der Bundestag über den Antrag der Koalition beraten und ebenso über einen Antrag von CDU und CSU. Unter den 95 Punkten der Opposition findet sich etwa die Forderung, europäische Förderprogramme zum Bau neuer Schiffe an „verbindliche Wertschöpfungsklauseln oder Klauseln zur Produktion in der EU“ zu koppeln und mit Bürgschaften Großaufträge abzusichern.
Mehr: Lindner spart am Schienennetz der Bahn – Vorstand spricht von „Desaster“
Erstpublikation: 04.07.2023, 18:40 Uhr
Zu Beginn des zweiten Quartals scheinen sich die Geschäftslage und die Stimmung in der Linienschifffahrt zu verbessern. Die Kapazitätsauslastung ist Analysten zufolge auf breiter Front gestiegen, mit den Frachtraten geht es auf mehreren Routen aus Asien heraus aufwärts.
Containerschifffahrt Marktausblick | Maersk, MSC, CMA-CGM, Hapag-Lloyd
VonGeorge
Mai 25, 2023 Analyse Containerschifffahrt, Containerschifffahrt CMA-CGM, Containerschifffahrt Hapag-Lloyd, Containerschifffahrt Maersk, Containerschifffahrt MSC, Containerschifffahrt Other, Containerschifffahrt Shipping Corporation of India, Containerschifffahrt Shreyas Shipping and Logistics, Industrie Containerschifffahrt, Markt Containerschifffahrt, Marktbericht Containerschifffahrt, Marktforschung Containerschifffahrt
ContainerschifffahrtBei der Containerschifffahrt handelt es sich um ein Frachtschiff, das seine gesamte Ladung in intermodalen Containern in LKW-Größe befördert, eine Technik, die als Containerisierung bezeichnet wird. Containerschiffe sind ein gängiges Mittel des kommerziellen intermodalen Gütertransports und befördern heute den Großteil der seegehenden Nicht-Massengüter.
Der Forschungsbericht Containerschifffahrt, der von der A2Z -Marktforschung auf dem Markt eingeführt wurde, indem ein Überblick bietet, der Definitionen, Anwendungen, Produkteinführungen, Entwicklungen, Herausforderungen und Regionen enthält. Es wird prognostiziert, dass der Markt eine starke Entwicklung durch den angetriebenen Verbrauch in verschiedenen Märkten zeigt. Eine Analyse der aktuellen und anderen grundlegenden Merkmale finden Sie im Markt Containerschifffahrtbericht.
Holen Sie sich einen Musterbericht:http://a2zmarketresearch.com/sample-request/1077195
Der Bericht bietet auch eine umfassende Analyse der Grundlagen des Containerschifffahrt-Marktes, einschließlich SWOT-Analyse, PESTEL und Meinungen, die von angesehenen Marktführern geschätzt werden. Inhaltsverzeichnisse und Diagramme mit Analysen der Schlüsselregionen sind im Containerschifffahrt-Bericht aufgeführt, um Mehrwerte hervorzuheben. Auch wichtige Akteure werden in dem Bericht mit klarem Fokus auf Fakten und Zahlen erwähnt.
Wichtige führende Akteure auf dem Markt
Maersk
MSC
CMA-CGM
Hapag-Lloyd
Shreyas Shipping and Logistics
Shipping Corporation of India
Other
Der Containerschifffahrt-Bericht präsentiert ein Dashboard mit der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Leistung von Top-Organisationen mit angemessener Genauigkeit. Die Forschungsstudie verwendet eine Reihe von Ansätzen und Analysen, um vollständige und genaue Informationen über den Containerschifffahrt-Markt bereitzustellen.
In der Veröffentlichung wurde eine Bewertung der Marktattraktivität des Containerschifffahrt -Warkts über den Wettbewerb zur Verfügung gestellt. Der Forschungsbericht erwähnt auch die Innovationen, neuen Entwicklungen, Marketingstrategien, Branding -Techniken und Produkte der wichtigsten Teilnehmer der Global IT & Telekommunikation -Branche. Um eine klare Vision des Marktes zu präsentieren, wurde die Wettbewerbslandschaft unter Verwendung der Wertschöpfungskettenanalyse gründlich analysiert. Die Chancen und Bedrohungen, die in Zukunft für die wichtigsten Marktteilnehmer vorhanden sind, wurden in der Veröffentlichung ebenfalls hervorgehoben.
Eine eingehende Untersuchung des Containerschifffahrt-Marktes wird durchgeführt, wobei das Expansionskriterium durch verschiedene Faktoren begünstigt wird, die in den Bericht aufgenommen wurden. Dieser Bericht nutzt jedoch die verschiedenen Segmente, die die Geschicke des Containerschifffahrt-Marktes verändern könnten und die hier enthalten sind.
Fragen Sie nach Anpassung:http://a2zmarketresearch.com/ask-for-customization/1077195
Segmentierung
Nach Typ
Über 30 Fuß, Unter 30 Fuß,
Nach Produktanwendung
Lebensmitteltransport, Transport industrieller Produkte, Transport von Konsumgütern, Sonstiges
Wichtigste Highlights dieses Berichts Containerschifffahrt :
Eingehende Untersuchung des Wettbewerbsgrades auf der ganzen Welt
Schätzung von Containerschifffahrt Marktwerten und Volumen
Containerschifffahrt Marktanalyse durch Branchenanalyse-Tools wie SWOT und Porter’s Five Forces Analysis
Ausführliche Erläuterung zum globalen Containerschifffahrt Marktwert, Volumen und Durchdringung
Containerschifffahrt Marktwachstumsprognosen
Containerschifffahrt Analytische Studie zu Treibern, Einschränkungen, Chancen, Hindernissen, Lücken, Herausforderungen und Stärken
Abschluss
Mit Analysetools wie der SWOT-Analyse und der fünf Kraftanalyse von Porter werden die Wirksamkeit der Käufer und Lieferanten von Containerschifffahrt ausgedehnt, um gewinnorientierte Entscheidungen zu treffen und ihr Geschäft zu stärken. Letztendlich hilft dieser Containerschifffahrt -Bericht, Ihnen Zeit und Geld zu sparen, indem Sie unvoreingenommene Informationen unter einem Dach liefern.
Kaufen Sie den vollständigen Bericht: http://a2zmarketresearch.com/checkout/1077195/single_user_license
Die Schifffahrt ist wieder auf Abwärtskurs
Stand: 03.05.2023 | Lesedauer: 5 Minuten
Seit dem Krieg in der Ukraine mehren sich die Attacken auf den See- und Hafensektor. Manövrierunfähige Frachter auf hoher See sind das Schreckensszenario.
(AFP) – Die Schifffahrtsbranche wird zunehmend von Cyberangriffen heimgesucht und der Krieg in der Ukraine hat die Angriffe von politisch motivierten staatlichen Akteuren verstärkt, so ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht.
„Fast 90 nennenswerte und öffentliche Cybersicherheitsvorfälle wurden 2022 im globalen See- und Hafensektor aufgedeckt. Ein Anstieg um 21 Prozent im Vergleich zu 2021 und um 235 Prozent im Vergleich zu 2020“, so die Sicherheitsfirma OWN, die zusammen mit dem Verband France Cyber Maritime das „Panorama der maritimen Cyberbedrohung 2022“ mitverfasst hat.
„Größer werden kann der Hafen nicht, aber er kann sich qualitativ entwickeln“
„Das ist die Spitze des Eisbergs, denn die meisten Vorfälle werden nicht gemeldet oder nicht entdeckt“, erklärte Xavier Rebour, Direktor von France Cyber Maritime, auf einer Pressekonferenz, wobei die sehr zahlreichen Versuche, Phishing-Kampagnen usw. nicht mitgerechnet sind. Häfen, Reedereien, Schiffe, Offshore-Anlagen, Logistiker … Es gibt eine sehr große Anzahl von Zielen und „eine extreme Verflechtung aller Akteure“, betont Rebour, der daran erinnert, dass „die Stärke einer Kette von ihrem schwächsten Glied abhängt“.
Versuch, die Lieferketten zu unterbrechen
„Viele Angriffe zielen auf die Lieferkette ab“, erklärt Barbara Louis-Sidney, die Leiterin des OWN CERT (Alarm- und Reaktionszentrums). Der symbolträchtigste Angriff auf den maritimen Sektor war der Angriff auf Maersk im Juni 2017, der diesen wichtigen Akteur im Containertransport lahmlegte.
Neben den traditionellen schurkischen Motiven der Angreifer – Ransomware ist nach wie vor vorherrschend – war das Jahr 2022 auch durch den Einfluss des Krieges in der Ukraine geprägt. „Die Typologie der Taten hat sich verändert, einige Akteure, wie Killnet (eine Hackergruppe, von der angenommen wird, dass sie für Russland handelt, Anm. d. Red.), haben sich für Infrastrukturen interessiert, die für Staaten symbolisch sind, wie es die maritime Infrastruktur ist“, erklärt Barbara Louis-Sidney.
Der Trend wird sich wahrscheinlich noch verstärken, wenn der Krieg anhält und die internationalen Spannungen aller Art zunehmen. „Das Jahr 2023 wird mehr denn je eng mit dem geopolitischen Kontext und dem russisch-ukrainischen Konflikt verknüpft bleiben und könnte daher angesichts der zunehmenden Digitalisierung des Sektors eine Verstärkung der Cyberbedrohungen mit sich bringen“, so Olivier Revenu, CEO von OWN. Durch die zunehmende Automatisierung besteht die Gefahr, dass Schiffe auf hoher See außer Kontrolle geraten. „Es hat schon Schiffe gegeben, die durch Cyberangriffe am Kai festsaßen, aber noch nicht auf See. Wir arbeiten an solchen Szenarien“, erklärte Rebour, „das ist keine Science-Fiction, aber wir sind noch nicht so weit.
Olaf Preuß Wirtschaftsreporter
Von Olaf Preuß
Wirtschaftsreporter
Containerschiffe im Hamburger Hafen – die goldene Zwischenzeit für die Branche ist bereits wieder vorbei
Containerschiffe im Hamburger Hafen – die goldene Zwischenzeit für die Branche ist bereits wieder vorbei
Quelle: Johannes Arlt
Nach extremen Gewinnen während der Pandemie bauen sich im seeseitigen Welthandel wieder große Überkapazitäten auf. In dieser Lage muss die Branche den teuren Umstieg hin zu klimaneutralen Antrieben organisieren.
Anzeige
Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen hat es bereits im vergangenen Jahr mehrfach gesagt, und kaum jemand mochte es so recht glauben. Die für die internationale Schifffahrt goldene Zwischenzeit ist bereits wieder vorüber. Transportpreise für die Container – die sogenannten Frachtraten – stürzen ebenso ab wie die Mietpreise für Schiffe, die Charterraten. Denn nach dem Ende der Pandemie trifft ein nur noch geringes Wachstum des Welthandels auf wieder stark wachsende Schiffskapazitäten, vor allem im Containerverkehr. Relativ gut sieht es hingegen weiterhin für die Tankschifffahrt aus – viele Staaten müssen nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine russisches Erdöl, das zuvor in Pipelines transportiert worden war, nun per Tanker aus anderen Ländern importieren.
Die Seehäfen Hamburg und Bremerhaven hätten im ersten Quartal dieses Jahres jeweils rund 20 Prozent weniger Containerumschlag verzeichnet als im Vorjahreszeitraum, Rotterdam etwa zehn Prozent weniger, sagte am Mittwoch beim „7. Hamburger Schifffahrtsdialog“ in der Handelskammer Hamburg Burkhard Lemper, Leiter des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) in Bremen: „Damit sind wir wieder auf einem Umschlag-Niveau von vor zehn Jahren.“
DVZ – Deutsche Verkehrs-Zeitung See Containerschifffahrt: Zim erwartet massiven Markteinbruch
So gross wie ein Wolkenkratzer
Die Schweiz hat das grösste Container-Schiff der Welt
Die Familie Aponte gehört zu den reichsten Schweizern. Deren Reederei MSC hat kürzlich das grösste Containerschiff der Welt in Betrieb genommen.
Publiziert: 14.04.2023 um 09:59 Uhr
|
Aktualisiert: 14.04.2023 um 13:21 Uhr
1/5
Die MSC Irina ist das grösste Containerschiff der Welt und über 400 Meter lang.
Mitarbeieter_Dez_22_51.JPG
Jean-Claude RaemyRedaktor Wirtschaft
Die Schweiz liegt nicht am Meer. Aber das grösste Containerschiff der Welt gehört der Schweizer Reederei MSC mit Sitz in Genf.
Die MSC Irina wurde im März im chinesischen Hafen Guangzhou an die Reederei übergeben. Die Masse sind eindrücklich: Vom Heck bis zum Bug misst das Schiff stolze 400 Meter, und es ist über 60 Meter breit. Von den Dimensionen her entspricht das in etwa dem Empire State Building in New York City, das lange Zeit das grösste Gebäude der Welt war. Es ist damit allerdings «nur» das grösste Containerschiff der Welt, nicht jedoch das grösste Schiff: Das wäre die Prelude FLNG, ein Ölumschlagschiff mit 488 Metern Länge.
Anzeige
More Information
XXL-Containerschiff sticht erstmals in See
400 m lang, 61 m breit: XXL-Containerschiff sticht erstmals in See(01:37)
Die MSC Irina bietet Platz für genau 24’346 Schiffscontainer. Das sind 158 Standard-20-Fuss-Container mehr als beim nächstgrössten Schiff, das derzeit in Betrieb ist, der OOCL Spain, die im Februar in Betrieb genommen wurde. Das zeigt: In der Containerschifffahrt jagen sich die Rekorde. Zum Vergleich: 1958 fasste das damals grösste Containerschiff «SS Ideal X» gerade mal 58 Container. Über 1000 Container wurden erstmals 1964 auf einem Schiff befördert, über 10’000 erstmals 2006. Die Schallmauer der 20’000 Container pro Schiff wurde erst 2017 geknackt.
Die Chancen, die MSC Irina mal in der Nähe bestaunen zu können, stehen gut. Das Schiff wird im Verkehr zwischen Italien und China eingesetzt. Es fährt aber nicht unter Schweizer Flagge, sondern unter liberianischer Flagge.
Die Reederei MSC gehört der Familie Aponte, die es mit einem Vermögen von 19,6 Milliarden Franken auf Rang 6 in der «Bilanz»-Liste der 300 reichsten Schweizer 2002 geschafft hat. In der «Forbes»-Liste 2023 wird deren Vermögen gar auf 62,4 Milliarden Franken beziffert. Das Vermögenswachstum hängt mit dem Wachstum der Containerschifffahrt während den Corona-Jahren zusammen.
Insgesamt besitzt MSC 730 Container-Schiffe. Ebenfalls zum Konzern gehört die Kreuzfahrt-Reederei MSC Cruises, die aktuell über 21 Schiffe verfügt.
Werbung
Reederei zahlt Mitarbeitern Bonus von 50 Gehältern
Stand: 11:49 Uhr | Lesedauer: 2 Minuten
Birger Nicolai
Von Birger Nicolai
Korrespondent
Schiffe liegen am Containerhafen von Shanghai. Die Reeder waren dieses Jahr mit der Verteilung der Boni großzügig
Schiffe liegen am Containerhafen von Shanghai. Mehrere der globale operierenden Reeder waren dieses Jahr mit der Verteilung der Boni großzügig
Quelle: VCG via Getty Images
Die Containerreedereien haben im vergangenen Jahr Rekordgewinne eingefahren und lassen neben den Eigentümern auch die Mitarbeiter davon profitieren. Die Boni betragen meist mehrere Monatsgehälter – eine Reederei sticht besonders heraus.
Anzeige
Der Schiffsname „Ever Given“ machte die Containerreederei Evergreen in aller Welt bekannt. Das gewaltige Containerschiff lag im März 2021 quer im Suezkanal und blockierte die wichtigste Wasserstraße zwischen Europa und Fernost.
Die Folgen waren auch in Deutschland zu spüren, als Waren im Einzelhandel fehlten. Dennoch hat die Reederei mit Sitz in Taipeh in Taiwan – wie alle großen Linienreedereien weltweit in der Corona-Pandemie – Rekordgewinne erzielt.
Davon profitieren auch die Beschäftigten. Nach Informationen des Schifffahrtsdienstes C-Captain zahlt Evergreen Marine bis zu 50 Monatsgehälter als Bonus für das Geschäftsjahr 2022. Der Dienst beruft sich dabei auf „Economic Daily News“ in Taipeh sowie auf Unternehmensangaben.
Lesen Sie mehr zu Reedereien
Containerschiff im Hamburger Hafen: Durchschnittliche Verspätung der Sendungen von China nach Europa sank von elf auf vier Tage
Ende des Hafenchaos
Ausgerechnet die Inflation verkürzt das Warten auf Ware
Schiff an Schiff: So sieht es derzeit vor Helgoland aus
Schifffahrt
Das große Warten. Warum 39 Frachter vor Helgoland liegen
Auf diesem von der portugiesischen Marine zur Verfügung gestellten Bild ist ein brennender Frachter auf dem Atlantik südlich der Azoren zu sehen. Ein Sprecher von VW in Wolfsburg bestätigte, dass Autos der VW-Gruppe an Bord waren. Nach dem Brand auf einem Frachter mit rund 4000 deutschen Autos mitten auf dem Atlantik fordern Experten eine Verbesserung der Löschanlagen auf den riesigen Transportschiffen. (zu dpa „Nach Brand auf Autofrachter fordern Experten bessere Löschanlagen“) +++ dpa-Bildfunk +++
Zu groß für Brandschutz?
Immer mehr brennende Containerschiffe – Die teure Ignoranz der Reeder
Immer häufiger gehen Container auf hoher See über Bord, so die Beobachtung von Versicherern
Schifffahrt
Warum immer öfter Container auf hoher See über Bord gehe
Containerschifffahrt: Zim erwartet massiven Markteinbruch
Die israelische Linienreederei rechnet für das laufende Jahr mit einem Rückgang ihres operativen Gewinns in einer Spannbreite von 92 bis 98,4 Prozent. (Foto: Daniel Wright/iStock)
Artikel DVZ Redaktion
Ihr Feedback
Teilen
Drucken
14. März 2023
Zim Integrated Shipping Services (Zim) erwartet für das laufende Jahr einen massiven Einbruch des Containerschifffahrtsmarkts. Anlässlich der Präsentation ihrer Geschäftszahlen für das vergangene Jahr teilte die israelische Containerreederei mit, sie erwarte für 2023 einen Einbruch beim operativen Gewinn (EBIT) in einer Spannbreite von 92 bis 98,4 Prozent.
Der negative Ausblick übertrifft die vorangegangene pessimistische Einschätzung der zu erwartenden Marktbedingungen von Hapag-Lloyd nochmals und lässt für die kommenden Monate die Wahrscheinlichkeit einer länger anhaltenden Krise steigen.
Die deutsche Linienreederei prognostizierte Anfang März für sich einen Rückgang des operativen Gewinns (EBIT) in einer Spannbreite von rund 77 bis 89 Prozent, betonte jedoch gleichzeitig, dass das erwartete EBIT in einer Höhe von 2,1 bis 4,3 Milliarden US-Dollar immer noch das drittbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte wäre.
Gewinn auf dem Niveau des Vorjahres
Zim erlöste im vergangenen Jahr rund 12,6 Milliarden Dollar und kam auf einen operativen Gewinn von 6,1 Milliarden Dollar. Das Unternehmen folgte dabei in etwa demselben Muster, das bereits bei den Wettbewerbern zu beobachten war und von einem Einbruch der Erlöse in den letzten drei Monaten des Jahres geprägt war.
So verzeichnete Zim im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Minus sowohl beim Umsatz (um 37 Prozent), EBIT (um 72 Prozent) als auch beim Gewinn (um 75,6 Prozent).
Über das Gesamtjahr hinweg verbuchte Zim allerdings dank der ersten drei Quartale unter dem Strich ein starkes Resultat, das bei einem Gewinn von rund 4,62 Milliarden Dollar in etwa dem Niveau des Jahres 2021 in Höhe von 4,64 Milliarden Dollar entspricht. (ol)
See
Weitere Inhalte
In der Containerschifffahrt herrscht die Ruhe vor dem Sturm
Die Linienreedereien werden demnächst wieder sehr hohe Gewinne für das dritte Quartal verkünden. Doch die Konstellation aus zunehmender Überkapazität, immer schwächerer Nachfrage und taumelnden Frachtraten könnte zu einer schweren Krise führen.
Warum der Containerschifffahrt ein Kapazitätsüberhang droht
Noch nie gab es so viele Schifffsbestellungen wie derzeit. Der Markt wird eine solche Menge an Transportraum nicht ohne Weiteres aufnehmen können.
Containeraufkommen schrumpft überraschend stark
Der starke Rückgang folgt auf eine über den Verlauf des vierten Quartals zu beobachtende Erholung der globalen Ladungsentwicklung. Der jüngste Rückgang der weltweit transportierten Container wird maßgeblich getrieben von einer schwachen Entwicklung des europäischen Exportverkehrs.
informationen
Folge der Multikrise Containerumschlag im Hamburger Hafen schrumpft
Erneuter Rückschlag für den Hamburger Hafen: Der Containerumschlag ging 2022 um 5,1 Prozent zurück, der Seegüterumschlag sogar noch stärker. Vor allem im zweiten Halbjahr machten sich die verschiedenen Krisen an den Kaimauern deutlich bemerkbar. Auch die großen europäischen Wettbewerber hatten zu kämpfen.
20.02.2023, 14.16 Uhr
Artikel zum Hören•4 Min
Kein seltenes Bild: Leere Containerbrücken am Hamburger Hafen
Kein seltenes Bild: Leere Containerbrücken am Hamburger Hafen Foto: Christian Charisius / dpa
Die Liste der Probleme ist lang: Der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme wegen der Corona-Lockdowns in China, die hohe Inflation, Probleme bei der Elbvertiefung sowie Arbeitskämpfe haben dem Hamburger Hafen zu schaffen gemacht. Im vergangenen Jahr wurden an den Kaimauern der Hansestadt daher lediglich 8,3 Millionen Standardcontainer (TEU) bewegt, gut 5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der Verein Hafen Hamburg Marketing am Montag mitteilte. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte der Umschlag noch bei 9,3 Millionen TEU gelegen, im Jahr 2007 hatte der Hamburger Hafen sogar schon mal 9,9 Millionen TEU erreicht.
Anzeige
Während der Umschlag in der ersten Jahreshälfte 2022 noch positiv war, ging es im zweiten Halbjahr bergab. Da kamen zu den ohnehin gestörten Lieferketten noch die Streiks der Hafenarbeiter und die schwächere Konjunktur hinzu. Besonders stark fiel der Containerumschlag im Schlussquartal mit Minus 12,3 Prozent. Grund seien die gestiegenen Energiekosten und hohe Lagerbestände der Industrie gewesen, erläuterte der Marketingverein.
ANZEIGE
powered by
Die SPIEGEL Gruppe ist nicht für den Inhalt verantwortlich.
Russland rutscht von Platz 4 auf Rang 27
Unter den Ländern, aus denen die Container stammten, die in Hamburg umgeschlagen wurden, ordnete sich die Rangfolge neu: Russland, vor dem Krieg in der Ukraine noch auf Rang vier, rutschte wegen der Sanktionen auf Platz 27 ab. Dagegen legte der Umschlag mit Polen um fast ein Viertel auf 294.000 TEU zu. Damit tauschte Polen den Platz mit Russland. Ähnlich entwickelte sich der Umschlag mit Finnland, das auf Rang sechs kam. Spitzenreiter blieb mit Abstand China mit fast 2,5 Millionen Standardcontainern (minus 3,8 Prozent). Auf Platz zwei folgten die USA mit 605.000 TEU (minus 2,1 Prozent).
Anzeige
Insgesamt sank der Seegüterumschlag in Deutschlands größtem Hafen um 6,8 Prozent auf knapp 120 Millionen Tonnen. Eine Prognose für 2023 traut sich der Hafen Hamburg Marketing nicht zu. „Wir hoffen, dass sich die globale Wirtschaft wieder fängt. Das wird auch den Umschlag des Hamburger Hafens unterstützen und steigern“, erklärte Vorstandschef Axel Mattern.
Rückgänge auch in Rotterdam und Antwerpen
Bereits am Freitag hatte der größte Hamburger Terminalbetreiber HHLA beim Containerumschlag 2022 konzernweit einen Rückgang um 7,9 Prozent und für den Hamburger Hafen um 4,1 Prozent gemeldet. Nach vorläufigen Zahlen betrug der Gewinn vor Zinsen und Steuern trotzdem 220 Millionen Euro – das waren zwar acht Millionen Euro weniger als 2021, aber deutlich mehr als die prognostizierten 175 Millionen bis 210 Millionen Euro. Der Umsatz der von Angela Titzrath (56) geführten Hafenlogistiker stieg um 7,7 Prozent auf rund 1,58 Milliarden Euro
von Michael Hollmann
Ihr Feedback
Teilen
Drucken
09. Januar 2023
https://www.handelsblatt.com/dpa/analyse-flash-barclays-senkt-ziel-fuer-a-p-moller-maersk-underweight/28978928.html
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für A P Moller-Maersk – ‚Underweight‘
LONDON (dpa-AFX Broker) -Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 12450 auf 11000 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf „Underweight“ belassen. Die globale Containerschifffahrt schippere angesichts der 2023/24 zu erwartenden, deutlichen Überkapazitäten auf einen Abschwung zu, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Pandemie-Boom mit überschießenden Preisen sollte sich diese Entwicklung umkehren – die Erwartungen für 2023/24 drohten verfehlt zu werden, und im kommenden Jahr seien die Bilanzrisiken wohl zurück./gl/la
13.02.2023 – 11:49 Uhr Kommentieren
Container Flash – nur ein laues Lüftchen am Chartermarkt
Hansa International Maritime Journal
Der Chartermarkt in der Containerschifffahrt zieht an, ohne allerdings die zu dieser Jahreszeit sonst übliche Dynamik zu entfalten.
dpa
LONDON Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 00:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 05:10 / GMT
Beim ersten Blick auf die Kennzahlen zum Seehandel muss sich wohl jeder verwundert die Augen reiben. Um rund 2 Prozent sind die Ladungsvolumina nach Angaben des Schiffsmaklers Clarksons Platou sowohl in der Container- als auch in der Bulkschifffahrt im vergangenen Jahr geschrumpft. Trotzdem erklommen die Fracht- und Charterraten in der ersten Jahreshälfte ungeahnte Rekorde (Container, Breakbulk/Projekte) oder zumindest Mehrjahreshöchststände. Von Quartal zu Quartal fuhren die Linienreedereien Spitzengewinne ein, von denen selbst Autokonzerne nur träumen konnten. Dabei hatte die Containerschifffahrt über viele Jahre nicht einmal genug verdient, um die Kapitalkosten zu decken, und de facto Geld von Investoren verbrannt.
Rutschpartie der Raten
An den Ladungsmengen kann es nicht gelegen haben. Unter „normalen“ Umständen wäre das Ratengefüge schon vor einem Jahr zusammengebrochen. Doch die Auswirkungen der Pandemie – kurzzeitig noch überlagert durch Effekte des russischen Angriffs auf die Ukraine und einen damit zusammenhängenden Stopp von Containern in Transhipment-Häfen – stellten die Märkte auf den Kopf. Noch größer als der Rückgang an Ladung war der Verlust an Flottenproduktivität. Ergebnis: prall gefüllte Schiffe bei Abfahrten ex Fernost – trotz alledem.
Das ging bis etwa zur Jahresmitte so. Dann lösten sich dank des Abflauens der Pandemie ausgehend von der US-Westküste allmählich die Schiffsstaus vor den Häfen auf, während gleichzeitig die Buchungen aufgrund der Inflation rasant abnahmen. Plötzlich kamen die ersten Schiffe aus Asien heraus Richtung Nordeuropa kaum noch auf 70 bis 80 Prozent Auslastung. Die Frachtraten legten eine Rutschpartie hin, wie sie keiner hatte kommen sehen – zuerst nur die Spot-, dann auch die Kontraktraten, die auf vielen Routen jetzt neu ausgeschrieben werden. Konnten die Carrier Anfang 2022 noch rund 15.000 US-Dollar/FEU für Verladungen von China nach Nordwesteuropa aufrufen, sind es jetzt gerade noch 1.500 bis 1.800 Dollar. Vor allem eins ist im Zuge von Corona, Krieg und Inflation durch die Decke gegangen, wie sich herausstellt: die Volatilität. Selbst nach der großen Finanzmarktkrise von 2008 fielen die Raten nicht auf ein Zehntel, schon gar nicht in so kurzer Zeit – abgesehen von Randerscheinungen wie im Asien-Südamerika-Verkehr vor einigen Jahren.
„Verrückt“, „nie dagewesen“, „Zustände wie zu Zeiten der Hanjin-Insolvenz“ sind Attribute und Vergleiche, die in Branchenkreisen kursieren. Doch gibt es einen wesentlichen Unterschied zur letzten richtig schweren Krise in der Linienschifffahrt 2016: Die Reedereien sitzen auf den dicksten Kapitalpolstern aller Zeiten. Quasi im Nu haben sich Unternehmen wie CMA CGM, die 2020 noch als Wackelkandidaten galten, entschuldet. „Alle großen Carrier verfügen über ausreichend Cash, ihre Bilanzen sind voll repariert, so dass jeder von ihnen sogar einen verlängerten Abschwung überleben kann. Ich erwarte keine großen Insolvenzen“, meint der Analyst Tan Hua Joo von der Marktforschungsfirma Linerlytica.
Potenzieller Verdrängungswettbewerb
Kurioserweise scheint es gerade ihre ausgezeichnete Kapitalisierung zu sein, welche die Linienreeder jetzt aufs Neue in einen potenziellen Verdrängungswettbewerb treibt. Man kann es sich leisten, die Grenzen auszuloten: Wer streicht als Erster die Segel und überlässt das Geschäft den Konkurrenten? Bislang haben nur kleine Fische Reißaus genommen – Newcomer wie Allseas, CU Lines oder Ellerman, die nur winzige Marktanteile im Fernost-Geschäft hatten. „Wir lagen falsch damit, dass die Linien nicht mehr die gleichen Fehler begehen würden“, stellt auch die Beratungsfirma Drewry fest und verweist auf die angesichts der Ladungseinbrüche bislang völlig unzureichenden Kapazitätseinschnitte. Mit Ausnahme des Trades von Fernost zur US-Westküste, aus dem inzwischen zahlreiche Schiffssysteme abgezogen und zumeist Richtung US-Ostküste verlagert wurden, beschränkt sich das Kapazitätsmanagement der Carrier im Wesentlichen auf „Blanking“, also die Streichung einzelner Abfahrten.
Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage nach Laderaum klafft nun aber bedrohlich auseinander. Ganze Dienste müssten eigentlich aus dem Fahrplan genommen werden, geben auch Manager aus Agenturen und Reedereien hinter vorgehaltener Hand zu. Rund 7 bis 9 Prozent Flottenwachstum steht der Containerschifffahrt allein in diesem Jahr ins Haus, warnen Marktexperten – wie viel genau, hängt davon ab, welche Neubauablieferungen sich noch weiter in die Zukunft verschieben lassen. Noch größer soll der Effekt durch die Wiederherstellung der Produktivität und Fahrplantreue sein: 19 Prozent Kapazitätsplus kalkuliert Drewry dafür ein. Bei den globalen Containerverladungen hingegen, sprich dem Geschäftsvolumen, wird höchstens mit minimalem Wachstum gerechnet, gemessen in Transportleistung (TEU-Meilen) sogar mit einem Minus.
Auch wenn der Höhepunkt der Inflation überschritten ist und die wirtschaftliche Aktivität den Einkaufsmanager-Indizes zufolge nicht mehr so schnell schrumpft wie noch im Herbst: Den Silberstreif am Horizont können die meisten im Überseegeschäft noch nicht erkennen. (jpn)
Wirtschaft
Aktien von Reedereien stürzen ab Anleger machen Bogen um Containerschiffe
Von Jannik Tillar 11.12.2022, 18:02 Uhr
284370565.jpg
Kaum ein Analyst spricht zurzeit eine Kaufempfehlung für Aktien von Reedereien aus.
(Foto: picture alliance / imageBROKER) Copyright NTV danke
FB
TW
mail
drucken
Während der Pandemie schießen die Preise in der Container-Schifffahrt in die Höhe. Die Reedereien erwarten, dass die Nachfrage auch in den kommenden Jahren hoch bleibt. Doch schon jetzt sinken die Frachtraten – superschnell. Die Aktien verlieren massiv.
Lange Zeit hieß es, die Containerpreise werden nie wieder fallen. Getrieben von der Coronakrise schoss 2020 die Nachfrage nach oben, kurz darauf folgten auch die Preise. Und eine ganze Weile änderte sich daran nichts. Noch im Januar kostete die Überfahrt von Shanghai nach Hamburg knapp 8000 Dollar für einen Standardcontainer. Und eigentlich dachten die Reedereien, dass das so bleibt.
Heute, ein knappes Jahr später, ist die Situation eine andere: Die Frachtrate, ein anderes Wort für den Transportpreis, liegt bei weniger als 1500 Dollar. Die Aktien von Reedereien wie Hapag Llyod liegen über 30 Prozent im Minus, und kaum ein Analyst spricht derzeit eine Kaufempfehlung aus. Wie konnte es so weit kommen – und wohin geht es in den kommenden Monaten?
Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd 185,90
Noch Ende Mai zeigten sich Branchenvertreter selbstbewusst. In einer PWC-Umfrage gaben sie an, dass 93 Prozent der deutschen Hochseeredereien voll ausgelastet seien. „Heute sind nicht mehr Kapazitätsüberhänge bei fehlender Nachfrage das Problem, sondern im Gegenteil mangelnde Transportkapazitäten bei stark gestiegener Nachfrage“, kommentierte daraufhin Burkhard Sommer vom Maritimen Kompetenzzentrum von PWC. Zwei Drittel der Reedereien gaben auch an, dass sie mit steigenden Ladungsaufkommen in den kommenden fünf Jahren rechnen.
Frachtraten fallen „superschnell“
Inzwischen hat sich die Zuversicht aber eingetrübt. Zwar präsentiert Hapag-Lloyd in diesem Jahr wohl ein Rekordnettogewinn von etwa 19 Milliarden Euro. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass das kommende Jahr schwieriger werden dürfte. Bereits Anfang November berichtete Chef Rolf Habben Jansen von fallenden Spotraten, also den Preisen für kurzfristige Buchungen. Und Konkurrent Maersk wurde noch deutlicher. „Die Frachtraten sinken superschnell. Schneller, als mir lieb ist“, erklärte Chef Soren Skou im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Die Sorge ist eindeutig: Selbst wenn das Frachtvolumen weiter steigt, dürften die rasant fallenden Frachtraten den Umsatz insgesamt schmälern.
halo.JPG
Wirtschaft 31.08.22 01:32 min
Als erste Reederei der Welt Hapag-Lloyd startet Container-Tracking
Dass die Transportpreise sinken, hat mehrere Gründe. In erster Linie sind Reedereien Zykliker, das heißt: Ihre Performance hängt an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, oder zumindest am Ausblick. Und genau der war zuletzt negativ. „Die Branche leidet unter den makroökonomischen Bremsspuren aus Ukraine-Krieg, Energiekrise, steigenden Zinsen und schwächerem Konsumentenvertrauen“, sagt Analyst Christian Cohrs, der Hapag-Lloyd für Warburg Research beobachtet. Diese Entwicklung sorgt für eine geringere Nachfrage, was sich in den sinkenden Preisen niederschlägt. Dass die Frachtraten aber so rasant fallen, erklärt er mit einem Hebeleffekt: „Corona hat einen Nachfrageschock nach Konsumgütern ausgelöst. Zeitgleich gab es starke Ineffizienzen in der Transportkette, zum Beispiel durch Zero Covid in China oder Abfertigungsengpässe in den USA. Dieser doppelte Positiveffekt hat sich nun aufgelöst und führt damit zu einem doppelten Effekt nach unten.“
Cohrs sieht das faire Preisniveau von Hapag-Lloyd derzeit bei 167 Euro. Das wären noch einmal 22 Euro weniger als der Schlusskurs vom Mittwoch. Bislang lag Cohrs, der Hapag-Lloyd seit mehreren Monaten mit „Sell“ bewertet, richtig: Zwar stieg der Kurs zwischen Januar und Juni von 287 auf 450 Euro. Doch dann folgte der rasante Absturz. „Es war klar, dass sich die Vorzeichen irgendwann umdrehen werden. Das tun sie jetzt. Damit trübt sich auch die Ertragsperspektive deutlich ein.“
Mehr Neubauten als Verschrottungen
Hier spielt auch ein dritter Punkt hinein: die Frachtkapazitäten. Stand jetzt rechnet die Marktforschungsgesellschaft Alphaliner mit einem Zuwachs von 2,3 Millionen Container-Äquivalenten (TEU) im kommenden Jahr. Zeitgleich fallen nur 0,65 Millionen TEU heraus, weil die Schiffe über 25 Jahre alt sind. Mehr Angebot würde zu sinkenden Preisen führen – zumindest in der Theorie. Tatsächlich sei das auch eine der spannenden Fragen in den kommenden Monaten, meint Cohrs. Ganz so einfach sei die Rechnung nämlich nicht: „Die Reeder können sehr aktives Kapazitätsmanagement betreiben. Sie können einerseits Schiffe ins Dock schicken, was zuletzt kaum stattgefunden hat, und alte oder ineffiziente Schiffe verschrotten oder zumindest zeitweise stilllegen.“
CAPITAL_Logo_290x358px.jpg
„Wirtschaft ist Gesellschaft“. Unter diesem Motto beleuchtet das Wirtschaftsmagazin Unternehmen und Organisationen sowie die Menschen, die für sie arbeiten. Und schafft so neue Perspektiven. Wir finden den Ansatz gut. Deshalb kooperiert ntv.de mit „Capital“.
Folgen: FB TW
Anders gesagt: Die Reeder könnten den neuen Kapazitäten etwas entgegensetzen. Die Frage sei aber, wie diszipliniert die Reeder seien. „Eigentlich müsste jedem in der Branche klar sein, dass der Preiskampf niemanden etwas bringt“, sagt Cohrs. Das haben auch die Vor-Corona-Jahre gezeigt, als sich die Reedereien gegenseitig im Preis unterboten. Das hat Jahr für Jahr zu tiefroten Konzernbilanzen geführt. Jetzt, nach den Rekordgewinnen, sind die meisten Konzerne wieder kerngesund und theoretisch bereit für den nächsten Preiskampf. Doch anders als damals ist die Branche nun in der Position, auskömmliche Preise durchsetzen zu können.
Aktuell liegen die Preise an der Shanghai Shipping Exchange noch immer 20 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. Auf der anderen Seite sind aber die Rohstoffpreise und Stückkosten gestiegen. Zuletzt waren die Ebitda-Margen von Hapag-Lloyd im dritten Quartal mit 57,8 Prozent aber noch mehr als auskömmlich. „Ein Preiskampf ist natürlich nicht auszuschließen – vor allem, wenn wir in eine tiefe Rezession stürzen. Meine Erwartung ist aber, dass die Reeder davor zurückschrecken werden.“
Dieser Text ist zuerst bei „Capital“ erschienen
Dänische Reederei Maersk sieht Containerschifffahrt am Wendepunkt
Die Zeit immer größerer Container-Riesen ist vorbei, ist Maersk-Chef Søren Skou überzeugt – auch weil die Nachfrage nachlasse und die schon jetzt 400 Meter langen Schiffe nicht mehr wirtschaftlich wären. Die Frachtraten sieht der Manager weiter rückläufig.
15.11.2022, 13.11 Uhr
Copyright Manager Magazin
Unsere Artikel werden ab sofort für Sie automatisiert vertont. Probieren Sie es direkt hier aus.
400 Meter lang: Die schwer beladene „Mumbai Maersk“ hatte sich Anfang Februar dieses Jahres etwa sechs Kilometer nördlich der ostfriesischen Insel Wangerooge festgefahren
400 Meter lang: Die schwer beladene „Mumbai Maersk“ hatte sich Anfang Februar dieses Jahres etwa sechs Kilometer nördlich der ostfriesischen Insel Wangerooge festgefahren Foto: Sina Schuldt / dpa
Die Containerschifffahrt stößt nach Ansicht der dänischen Großreederei Maersk an ihre Grenzen. Sowohl was die Größe der Schiffe als auch was die Frachtpreise angehe, sei ein Wendepunkt erreicht, sagte Konzernchef Søren Skou (58) am Montagabend im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Mit 20.000, 22.000 und mehr Standardcontainern (TEU) sei eine Dimension erreicht, ab der sich die Frage der Wirtschaftlichkeit stelle, zumal der Welthandel nicht mehr so stark wachse.
Anzeige
„Die Schiffe werden nicht größer werden“: Maersk-Chef Søren Skou
„Die Schiffe werden nicht größer werden“: Maersk-Chef Søren Skou Foto: imago
„Die Schiffe werden nicht größer werden,“ prognostizierte Skou. Maersk ist die weltweit zweitgrößte Containerreederei nach MSC aus der Schweiz. Man könnte zwar auch Frachter für 30.000 TEU bauen. Dann seien zwar die Stückkosten niedriger. „Aber wie will man die Schiffe füllen“, fragte Skou. Solche Riesenschiffe müssten mehr Zwischenstopps in Asien einlegen, um Ladung aufzunehmen. Dadurch verlängere sich die Fahrzeit. Containerschiffe brauchen je nach Geschwindigkeit jetzt schon mehrere Wochen von Asien nach Europa.
WERBUNG
Der Maersk-Chef verglich die Schifffahrt mit der Luftfahrt. Man könne zwar ein Flugzeug für 1000 Passagiere bauen. „Wir alle wissen, wenn Sie nicht jeden Tag nach New York fliegen, rentiert sich das nicht.“ Das Gleiche gelte für Containerschiffe. „Wir brauchen eine bestimmte Frequenz.“
„Frachtraten werden superschnell zurückgehen“
Søren Skou, Chef der der dänischen Großreederei Maersk
Mit Blick auf die Frachtraten, die die Reedereien für den Transport der Container kassieren, sagte Skou, er rechne mit einem weiteren Rückgang. Auf die Frage, wie schnell dies gehen werde, antwortete er: „Superschnell. Schneller als mir lieb ist.“
VERLAGSANGEBOT
E-Mail-Kurs
Kreativität für Unkreative
Denkt mal neu! Seid mal mutig! Solche Phrasen lösen selbst bei kreativ geübten Teams eher Fluchtreflexe aus, anstatt zu inspirieren. Im E‑Mail-Kurs von manage › forward lernen Sie Tools kennen, die Kreativität in Ihrem Team befeuern und für mehr Innovation sorgen.
Die Containerlinien haben in den vergangenen Jahren massiv von den gestiegenen Frachtpreisen profitiert, die Gewinne sind explodiert. Dabei fließen die Gewinne zu einem erheblichen Teil an die Aktionäre. Für das Jahr 2021 schüttete Hapag-Lloyd rund 6,2 Milliarden Euro Dividende aus – bei einem rund drei Milliarden Euro höheren Vorsteuergewinn. Einen Teil investieren die Reedereien auch in die Expansion.
Hapag-Lloyd gab kürzlich für die ersten neun Monate dieses Jahres einen Konzerngewinn von 13,8 Milliarden Euro an – und damit deutlich mehr, als das Unternehmen im Ausnahmejahr 2021 als Reingewinn verbucht hatte. Zu den Rekordgewinnen der Reedereien trägt auch bei, dass sie kaum Steuern zahlen. Hapag-Lloyd wies für die ersten drei Quartale lediglich eine Ertragssteuerlast von 77 Millionen Euro aus. Möglich ist das wegen der Tonnagesteuer – einer Methode zur Gewinnermittlung, die vor mehr als 20 Jahren zur Unterstützung des Schifffahrtsstandortes Deutschland eingeführte wurde. Dabei wird anstelle des tatsächlichen Gewinns ein fiktiver Gewinn pauschal nach der Größe der Schiffe ermittelt. Der ist in der Regel deutlich geringer als der tatsächliche Gewinn.
Wenn Reederei-Chefs nun also vor einem Rückgang der Frachtraten und rückläufigen Containernachfrage warnen, der ihre Gewinne drücken dürfte, ist das ein Klagen auf allerhöchsten Niveau in einer ohnehin steuerlich exponierten Position.
Mehr zum Thema
Geldregen für Reederei: Hapag-Lloyd-Gewinn summiert sich bereits auf 13,8 Milliarden Euro
Hapag-Lloyd-Gewinn summiert sich bereits auf 13,8 Milliarden Euro
Dänische Reederei: Maersk erwartet Abkühlung des Containerbooms
Maersk erwartet Abkühlung des Containerbooms
Dividende verzehnfacht: Hapag Lloyd schüttet 6,2 Milliarden Euro an Aktionäre aus
Hapag Lloyd schüttet 6,2 Milliarden Euro an Aktionäre aus
So prognostizierte kürzlich Maersk, dass die weltweite Containernachfrage angesichts eines schwächeren Welthandels in diesem Jahr um 2 bis 4 Prozent sinken werde. Zuvor hatte Maersk sowohl einen Rückgang um 1 Prozent als auch einen Zuwachs um 1 Prozent in Aussicht gestellt. „Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir uns entweder in einer Rezession befinden oder bald in einer Rezession sein werden, sicherlich in Europa, aber möglicherweise auch in den USA“, sagte Skou in einem Interview mit Bloomberg TV
.
rei/Reuters
Feedback
Sensation für Privatversicherte: Rückzahlung für zu hohe Beiträge möglich
News
Staus in Containerschifffahrt gehen zurück, Sanktionen treffen Russlands Handel hart
07.11.2022
Die Staus in der Containerschifffahrt bilden sich auf hohem Niveau langsam zurück. Dies zeigt das jüngste Datenupdate des Kiel Trade Indicator für den Monat Oktober. Die Frachtraten für den Warentransport von China nach Europa liegen so niedrig wie zuletzt vor rund 2 Jahren. Die Handelswerte weltweit und für große Volkswirtschaften im Vergleich zum Vormonat sind tendenziell negativ(preis- und saisonbereinigt). Bei Russland zeigen die Sanktionen Wirkung. Monatlich fehlen dem Land Importe im Wert von rund 4,5 Milliarden US-Dollar.
Laut jüngstem Datenupdate des Kiel Trade Indicator fällt der Welthandel im Oktober leicht im Vergleich zum Vormonat (-0,8 Prozent, preis- und saisonbereinigt). Für Deutschlands Handel sind die Werte für Importe (-0,9 Prozent) und Exporte (-0,2 Prozent) leicht negativ bzw. deuten auf eine rote Null hin. Auch für die EU zeichnet sich wenig Veränderung im Handel ab, Importe (0,0 Prozent) und Exporte (1,0 Prozent) dürften auf dem auf Niveau des Vormonats liegen bzw. leicht darüber.
Für die USA signalisieren die Werte des Kiel Trade Indicator keine Bewegung bei den Importen (0,0 Prozent). Ein klares Minus steht hingegen bei den Exporten (-2,7 Prozent) im Vergleich zum Vormonat. Für China steht eine schwarze Null bei den Importen (0,9 Prozent) und ein deutliches Plus bei den Exporten (10,1 Prozent).
„Tendenziell geht es seitwärts mit dem weltweiten Handel, auch wenn sich diese Entwicklung nicht gleichmäßig für alle Länder zeigt. Deutsche Ausfuhren folgen preisbereinigt schon seit geraumer Zeit dieser Entwicklung, die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen deutschen Exporteuren also offenbar spürbar zu schaffen“, sagt Vincent Stamer, Leiter Kiel Trade Indicator. „Chinas Plus bei den Exporten ist im weltweiten Trend ein klarer Ausreißer nach oben. Ob damit die Erholung von den Einschränkungen der Null-Covid-Politik eingeläutet wird, bleibt abzuwarten. Historisch gesehen sind starke Schwankungen in Chinas Handelszahlen nicht ungewöhnlich.“
In Russland zeigen die Sanktionen der westlichen Staaten Wirkung. Sowohl für die Exporte (-2,6 Prozent) als auch die Importe (-0,4 Prozent) zeichnet sich im Oktober nochmals ein Rückgang des preisbereinigten Güterhandels ab. Bereits in den vergangenen Monaten war der Handel deutlich eingebrochen, insbesondere mit der EU.
Die offizielle Statistikbehörde von Russland veröffentlicht seit einigen Monaten keine Importwerte mehr, der Effekt der Sanktionen gegen Russland soll damit offenbar verschleiert werden. Eine Auswertung mittels der Exporte von 57 Ländern und Regionen nach Russland, darunter auch die EU und China, für die Sommermonate Juni, Juli und August 2022 zeigt, dass Russland monatlich rund 24 Prozent weniger Waren importiert als 2021. Die monatliche Importlücke liegt bei rund 4,5 Milliarden US-Dollar.
Während im Sommer 2021 noch die EU Russlands wichtigster Handelspartner war, hat China nun diese Spitzenposition eingenommen. Die EU exportiert im Vergleich zum Vorjahr 43 Prozent weniger Waren nach Russland, China 23 Prozent mehr. Allerdings hat der Anstieg der Exporte von China nach Russland im September an Dynamik verloren. „Chinas Exporteure konnten die Sanktionsschäden auch bislang nicht kompensieren und Russlands Anstrengungen, wegbrechende Importe aus Europa zu ersetzen, gestalten sich zunehmend schwieriger. Die Sanktionen der westlichen Allianz treffen die russische Wirtschaft augenscheinlich hart und schränken die Konsummöglichkeiten der Bevölkerung spürbar ein“, so Stamer.
Darauf deutet auch der Rückgang anlandender Ladung in russischen Häfen hin. St. Petersburg, ehemals größter Containerhafen Russlands und wichtiger Umschlagspunkt für den Handel mit Europa, erreichte im Oktober erstmals weniger als 10 Prozent der Vorjahresmengen. Auch der Schwarzmeerhafen Novorossijsk verzeichnet einen Rückgang um etwa 50 Prozent. Der für die Abwicklung des Asienhandels wichtige Hafen Wladiwostok erreicht jetzt zwar die Umschlagsmenge des Vorjahres, der wegbrechende Handel zwischen Europa und Russland kann dort aber nicht kompensiert werden.
Die Containerschiffstaus rund um den Globus zeigen auf hohem Niveau weiter deutliche Zeichen der Entspannung. Gegenwärtig befinden sich 10 Prozent aller weltweit verschifften Güter im Stau.
Seit Beginn des Jahres sind die Frachtraten von China nach Nordeuropa um etwa zwei Drittel gefallen. Erstmals seit rund 2 Jahren liegen die Preise für einen Standardcontainer wieder unter 5.000 US-Dollar und damit nahe dem Niveau vor Ausbruch der Handelskrise. Auf der Route von China nach Nordamerika haben die Preise schon etwas früher zu sinken begonnen.
Stamer: „Der deutliche Rückgang der Frachtraten ist ein positiver Impuls für den globalen Handel und damit auch für die deutsche Wirtschaft. Bleiben die Raten niedrig und lassen die weltweiten Schiffsstaus weiter nach, könnte der günstigere Transport Rezessionsängsten im exportierenden Gewerbe entgegenwirken.“
Weitere Informationen zum Kiel Trade Indicator und einzelne Prognosen für 75 Länder und Regionen finden Sie auf www.ifw-kiel.de/tradeindicator.
Die nächsten Aktualisierungen des Kiel Trade Indicator erfolgen am 21. November (ohne Medieninformation) und am 6. Dezember (mit Medieninformation) für die Handelsdaten im November.
Kiel Trade Indicator
Click for more details.
Über den Kiel Trade Indicator
Der Kiel Trade Indicator schätzt die Handelsflüsse (Im- und Exporte) von 75 Ländern und Regionen weltweit, sowie des Welthandels insgesamt. Im Einzelnen umfassen die Schätzungen über 50 Länder sowie Regionen wie die EU, Subsahara-Afrika, Nordafrika, den Mittleren Osten oder Schwellenländer Asiens. Grundlage ist die Auswertung von Schiffsbewegungsdaten in Echtzeit. Ein am IfW Kiel programmierter Algorithmus wertet diese unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz aus und übersetzt die Schiffsbewegungen in reale, saisonbereinigte Wachstumswerte gegenüber dem Vormonat.
Die Auswertung erfolgt zweimal im Monat. Um den 20. (ohne Pressemeldung) für den laufenden und den folgenden Monat und um den 5. (mit Pressemeldung) für den vergangenen und den laufenden Monat.
An- und ablegende Schiffe werden dabei für 500 Häfen weltweit erfasst. Zusätzlich werden Schiffsbewegungen in 100 Seeregionen analysiert und die effektive Auslastung der Containerschiffe anhand des Tiefgangs gemessen. Mittels Länder-Hafen-Korrelationen können Prognosen erstellt werden, auch für Länder ohne eigenen Tiefseehafen.
Der Kiel Trade Indicator ist im Vergleich zu den bisherigen Frühindikatoren für den Handel deutlich früher verfügbar, deutlich umfassender, stützt sich mit Hilfe von Big Data auf eine bislang einzigartig große Datenbasis und weist einen im Vergleich geringen statistischen Fehler aus. Der Algorithmus des Kiel Trade Indikators lernt mit
https://kurier.at/wirtschaft/container-schifffahrt-mengen-um-30-prozent-eingebrochen-das-ist-irre/402201342
© REUTERS/FABIAN BIMMER Copyright Kurier
Interview
31.10.2022
Container-Schifffahrt: „Mengen um 30 Prozent eingebrochen, das ist irre“
Wegen der Corona-Pandemie wurde der Frachtraum in den Container-Schiffen knapp und die Preise stiegen. Jetzt gebe es hohe Überkapazitäten, schildert ein Experte.
von Thomas Pressberger
In der Containerschifffahrt hat sich im letzten Monat der Wind um 180 Grad gedreht. Der Frachtraum war davor knapp und die Reedereien haben nach vielen mageren Jahren seit 2020 Milliardengewinne geschrieben. Viel haben sie in Schiffe investiert, ihre Flotten um 25 Prozent aufgestockt. Diese werden bis 2025 ausgeliefert.
Es gleicht einem Treppenwitz, dass es just in dem Moment zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und zu jahrzehntelang nicht gekannten Inflationsraten kommt. Die Nachfrage nach Waren aller Art rasselte in den Keller, in der Containerschifffahrt herrscht Flaute. Ein Gespräch mit Alexander M. Till, Experte vom Hamburger Hafen.
KURIER: In der Containerschifffahrt gab es in den vergangenen Wochen nie da gewesene Umbrüche. Was ist passiert?
Alexander M. Till: Die Reedereien haben in den vergangenen 24 Monaten nach vielen nicht guten Jahren Rekordgewinne geschrieben. Maersk, die weltweit zweitgrößte Reederei, hatte 2021 ein Betriebsergebnis (Ebit, Anm.) in Höhe von 19,6 Milliarden US-Dollar. Die französische Reederei CMA/CGM, die Nummer drei auf der Welt, 17,9 Milliarden US-Dollar. Damit lag deren Ebit-Marge bei über 40 Prozent des Umsatzes. Normalerweise haben die Reedereien eine Ebit-Marge von zwei bis sechs Prozent, oder lagen in den letzten Jahren sogar im Minus. Das ist ein historisches Plus. Das hat 2020 begonnen und 2021 seinen Höhepunkt erreicht.
Doch dann kam Gegenwind?
Seit Anfang September sind die Raten für einen 40-Fuß-Container von 10.000 bis 12.000 Dollar im Sturzflug. Derzeit liegen sie bei 4.000 Dollar.
Wie kam es dazu?
In Asien sind die Ladungsmengen um 30 Prozent eingebrochen, das ist irre, total ungewöhnlich. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Importeure in Europa wegen der wackelnden Lieferketten wie verrückt importiert haben und jetzt nicht mehr bestellen, weil die Läger voll sind. Es ist sicherlich ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren.
IfW: Containerschiff-Stau in der Deutschen Bucht wieder größer
Weltweit stecken offenbar elf Prozent aller verschifften Waren in Containerhäfen fest. Alleine in der Deutschen Bucht warten laut IfW 19 Schiffe.
06.09.2022 – 13:58 Uhr 1 Kommentar
Dutzende Schiffe in der Deutschen Bucht warten auf ihre Abfertigung. Quelle: dpa
Wartende Containerschiffe in der Deutschen Bucht
Dutzende Schiffe in der Deutschen Bucht warten auf ihre Abfertigung.
Mit Neustart aus der Krise Einmalige Chance für deutsche Werften
Meinung – Markus Lorenz | 09.09.2022, 19:07 Uhr
Beitrag hören:
02:06
Der Niedergang des deutschen Schiffbaus geht weiter. Doch eine Wende ist gerade jetzt möglich. Wenn wir entschlossen handeln.
Wikinger-Horror-Event in Damp
VikingMania im Dampland: Eintauchen in eine andere Welt
Anzeige
[VikingMania im Dampland: Eintauchen in eine andere Welt]
Das immer gleiche Ritual: Jedes Jahr trägt die IG Metall mit ernster Miene die Jobzahlen der deutschen Werften vor, fast immer versehen mit einem mehr oder weniger dicken Minuszeichen. Daran knüpft die Gewerkschaft eben so regelmäßig die zusehends flehentliche Forderung an die Politik, dem Aussterben des Schiffbaus endlich etwas entgegenzusetzen. Der Erfolg solcher Appelle war bisher äußerst mäßig. Von Einzelfällen abgesehen, ließen und lassen Bundes- wie Landesregierungen die Verzwergung des einst elementaren Industriezweiges einfach geschehen.
Lesen Sie auch
IG Metall warnt
Krise auf Werften im Norden: So viele Jobs gingen in einem Jahr verloren
IG Metall sieht Werften in Abwärtsspirale
Schiffbaumesse SMM in Hamburg
Strenge Klimaregeln als Motor für Schiffbau in Europa
Schiffbaumesse SMM 2022
Weg ins Nirwana
Auf dem Weltmarkt sehen sich die alleingelassenen deutschen Anbieter einer erdrückenden Konkurrenz staatlich gepäppelter Konzerne gegenüber, nicht nur aus Fernost. Und so wäre der Weg der hiesigen Schiffbauer ins Nirwana wohl unaufhaltsam, würden nicht gerade jetzt außerordentliche Faktoren dafür sorgen, dass die Karten neu gemischt werden.
Zum Einen zeigt Russlands Ukraine-Krieg uns allzu schmerzlich, wohin wirtschaftliche Abhängigkeit von autoritären Regimen führt. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, ewig schön billige Schiffe und maritime Infrastruktur aus China zu beziehen.
Historische Gelegenheit zum Wiederaufbau
Gleichzeitig zwingt die Klimakrise die Branche zu einem historischen technologischen Neustart. Schiffe müssen in kürzester Zeit fossilfrei werden, zugleich brauchen wir die Meere noch viel stärker als Standorte für unsere saubere Energie der Zukunft.
Darin liegt eine einmalige Gelegenheit für einen Wiederaufbau von Werftstrukturen in Deutschland und in Europa. Ja, ohne massive staatliche Hilfe – sprich viel Geld – wird das nicht gehen. Und dennoch müssen wir diese Doppelchance zügig ergreifen. Uns bleibt nichts anderes übrig.
(Foto: dpa)
Kiel Der Stau von Containerschiffen in der Deutschen Bucht löst sich nach Beobachtungen des Kiel Instituts für Wirtschaftsforschung (IfW) nicht auf – und ist zuletzt sogar wieder gewachsen. „Lieferengpässe und Staus in der Containerschifffahrt verfestigen sich und belasten den weltweiten Warenaustausch“, berichtete der IfW-Ökonom Vincent Stamer im jüngsten „Kiel Trade Indicator“ vom Dienstag. „In der deutschen Bucht warten wieder mehr Containerschiffe als noch vor 14 Tagen.“
Nach IfW-Berechnungen stecken derzeit weltweit rund elf Prozent aller verschifften Waren in Staus vor wichtigen Containerhäfen fest. Dabei sei in den beobachteten Wartebereichen „erstmals der Stau in der Nordsee am gravierendsten“, so das Kieler Institut.
Deutlich über zwei Prozent der globalen Frachtkapazität stünden dort still und könnten weder be- noch entladen werden. Alleine in der Deutschen Bucht warten demnach derzeit 19 Containerschiffe auf Löschung ihrer Waren, zwei mehr als noch vor zwei Wochen.
Zudem schnelle die Warteschlange vor den US-Bundesstaaten South Carolina und Georgia in die Höhe, berichtete IfW-Forscher Stamer. Dort liegt der wichtige Containerhafen Savannah. „Vor Chinas Häfen sind die Staus zyklisch bedingt rückläufig.“
Themen des Artikels
Coronavirus
Schifffahrt
China
Logistik Copyright Handelsblatt
Weil mehr als 90 Prozent aller Güter weltweit per Schiff transportiert werden, ist der Containerschiffsverkehr eine Lebensader des Welthandels. Sie ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor zweieinhalb Jahren zunehmend aus dem Takt geraten.
Jede Störung, etwa Lockdowns in einzelnen Häfen, eine Havarie wie die der „Ever Given“ im Suezkanal oder Arbeitskämpfe wie zur Zeit im größten englischen Containerhafen Felixstowe, bringt zusätzlich Sand ins Getriebe und mindert die Pünktlichkeit der Schiffe.
Mehr: Härtere Gangart gegen China – Deutsche und US-Behörden stoppen Verkauf von Container-Hersteller
IfW: Containerschiff-Stau in der Deutschen Bucht kleiner
IfW: Containerschiff-Stau in der Deutschen Bucht kleiner
Containerschiffe in der Deutschen Bucht. (Archivbild)
Von moneycab
23. August 2022, 14:55 Uhr
Kiel – Der hartnäckige Stau von Containerschiffen in der Deutschen Bucht hat sich nach Beobachtungen des Kiel Instituts für Wirtschaftsforschung (IfW) zuletzt deutlich verkleinert. «Statt 24 Containerschiffen warten derzeit «nur» noch 17 auf Abfertigung in Hamburg oder Bremerhaven», berichtete IfW-Ökonom Vincent Stamer im jüngsten «Kiel Trade Indicator» vom Dienstag. Allerdings sei es für eine Entwarnung noch zu früh: «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich der Stau weiter in diesem Tempo zurückbildet.»
Nach Stamers Einschätzung sind einige Schiffe «offenbar in niederländisches Hoheitsgewässer als Wartezone ausgewichen». Umgerechnet auf die Frachtkapazität sei die Dimension des Stauvolumens ausserdem weiterhin sehr hoch. Derzeit stehen allein in der Deutschen Bucht zwei Prozent des weltweiten Transportvolumens still, «die wartenden Schiffe haben eine Kapazität von insgesamt 200’000 Standardcontainern (TEU)», so Stamer. Der IfW-Experte analysiert auf Basis von Echtzeitdaten fortlaufend den weltweiten Containerverkehr auf See.
Weil mehr als 90 Prozent aller Güter weltweit per Schiff transportiert werden, ist der Containerschiffsverkehr eine Lebensader des Welthandels. Sie ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor zweieinhalb Jahren zunehmend aus dem Takt geraten. Jede Störung, etwa Lockdowns in einzelnen Häfen, eine Havarie wie die der «Ever Given» im Suezkanal oder Arbeitskämpfe wie zur Zeit im grössten englischen Containerhafen Felixstowe, bringt zusätzlich Sand ins Getriebe und mindert die Pünktlichkeit der Schiffe. (awp/mc/ps)
SchlagwörterContainerschifffahrt, Deutsche Bucht, IfW
Schreibe einen Kommentar
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Kommentar *
CONTAINER SHIPPING – Kunden von Reedereien abgezockt
1. August 2022 Hans-Joachim Schlobach Aktuell, Business+Finanzen, Transport+Infrastruktur
blogistic-logo Copyright
Container Shipping – Kunden von Reedereien fühlen sich abgezockt und fordern jetzt von der EU-Kommission die Überprüfung der Gruppenfreistellungsverordung. (Foto: Rainer Sturm / www.pixelio.de)
Container Shipping – Kunden von Reedereien fühlen sich abgezockt und fordern jetzt von der EU-Kommission die Überprüfung der Gruppenfreistellungsverordung. (Foto: Rainer Sturm / www.pixelio.de)
Container Shipping – Das Global Shippers Forum (GSF), eine Interessensvertretung von Kunden und Dienstleistern von und für Reedereien, drängt jetzt auf die sofortige Überprüfung der Gruppenfreistellungsverordnung der EU durch die EU-Kommission. Sie befürchten die Umgehung des Wettbewerbsrechts durch die Reedereien und wollen eine gleichmäßige Verteilung der Risiken und Lasten in den globalen Lieferketten sowie eine Transparenz der Preisfindung. Das GSF stützt sich dabei auf die Untersuchungen der US-amerikanischen Federal Maritime Commission, FMC, vom Mai diesen Jahres.
Reedereien verdienen sich derzeit gleich mehrfach eine goldene Nase am weltweiten Container Shipping. Seit dem Beginn der Coronapandemie sind die Preise pro Container explodiert. Kostete ein 40-ft-Container noch rund zwei Wochen vor Ausbruch der Pandemie im Jahr 2019 rund 1.500 US-Dollar, müssen Kunden aktuell mehr als 9.500 US-Dollar berappen. Und das ohne einer Mehrleistung oder verbesserter Services durch die Reedereien. Im Gegenteil: Meldungen über immer schlechtere Services, die bis zur Kundenfeindlichkeit reichen, und Chaos durch Missmanagement bei den Reedereien auf Kosten ihrer Kunden mehren sich zunehmend.
Containerschifffahrt – Ein kundenfeindlicher Anbietermarkt
Ein Grund für die Misere: Die Container-Frachtschifffahrt hat sich vom Käufer- zum Anbietermarkt gewandelt, offenbar zum alleinigen Vorteil der Reedereien und zum Nachteil ihrer Kunden. Denn letztere sind nicht nur mit unsicheren Lieferzeiten konfrontiert, sondern die Waren kommen gehäuft in schlechtem Zustand an. Die weltweiten Lieferkettenprobleme durch Containerstau in den Häfen oder direkt bei den Absendern sind dafür nicht alleine verantwortlich. Vielmehr sind diese Probleme bei den Reedereien zunehmend hausgemacht, so der Vorwurf von Insidern. So werden die Waren nicht selten ohne Informationen von den Reedereien einfach umgeleitet und sind dann für längere Zeit nicht auffindbar. Gerade sensible Waren aus dem Elektronikbereich oder verderbliche Waren werden so teilweise bzw. auch schon mal zur Gänze unbrauchbar – nicht selten zum alleinigen Schaden des Adressaten oder den Versicherungen. Lieferausfälle sind somit mittlerweile an der Tagesordnung.
Gruppenfreistellungsverordnung begünstigt Reedereien bei Container Shipping
Experten des Global Shipping Forum machen dafür unter anderem auch die Gruppenfreistellungsverordnung der EU verantwortlich, welche Container Shipping offenbar die Reedereien begünstigt. Hinter diesem Wortmonster versteckt sich eine Verordnung im Sinne von Art. 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag). Sie stellt bestimmte Gruppen wie etwa Reedereien von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen wie zum Beispiel ein Kartellverbot frei. Die Gruppenfreistellungsverordnung konkretisiert dabei für die jeweilige Gruppe verbindlich die in Art. 101 Absatz 3 AEU-Vertrag enthaltenen, sehr allgemein gehaltenen Voraussetzungen für solche Ausnahmen. Sie hatte den Sinn, die Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise von europäischen Reedereien gegenüber Reedereien außerhalb der EU zu gewährleisten, die beispielsweise mit keinen kartellrechtlichen Beschränkungen konfrontiert sind.
Werbung
Container Shipping – Künstlich forcierte Containerpreise?
Container Shipping – Der Hochsee-Containerschifffahrtsmarkt soll auf faire und transparente Weise für alle Parteien in der maritimen Lieferkette funktionieren. (Foto: Bernd Sterzl / www.pixelio.de)
Container Shipping – Der Hochsee-Containerschifffahrtsmarkt soll auf faire und transparente Weise für alle Parteien in der maritimen Lieferkette funktionieren. (Foto: Bernd Sterzl / www.pixelio.de)
Vor dem Hintergrund völlig neuer globaler Voraussetzungen, der Übermacht der Reedereien und explodierender Containerpreise fordert nun das Global Shipping Forum in einem offenen Brief, dass die EU-Kommission die Gruppenfreistellungsverordnung für Reedereien einer neuerlichen Überprüfung unterzieht. Gegebenenfalls soll die EU-Kommission auch eine Änderung dieser Wettbewerbsregeln für die Containerschifffahrt einleiten. Nach Ansicht der internationalen Interessenvertretung von insgesamt zehn Handels- und Cargo-Organisationen und Unternehmen befreit die EU-Verordnung die Containerreedereien von vielen Kontrollen des EU-Wettbewerbsrechts und erlaubt ihnen auch den Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen. Sie können so die Anzahl und Größe der eingesetzten Schiffe sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Fahrten auf Handelsrouten in der ganzen Welt zu verwalten. Dahinter steckt die Befürchtung, dass auf diese Weise unter Umgehung des Wettbewerbsrechts der EU der weltweit vorhandene Frachtraum samt Container zum Nachteil der Reedereikunden verknappt und so die Preise künstlich hochgehalten werden.
Container Shipping – Gruppenfreistellung dringend überprüfen
Fakt ist, dass Unternehmen der EU und andere Glieder der globalen Lieferketten seit der letzten Erneuerung der Verordnung im April 2020 unter enormen Störungen des Warenverkehrs in der Containerschifffahrt leiden. So werden viele Abfahrten storniert oder zu anderen Häfen umgeleitet und Häfen umgangen („übersprungen“), teilweise ohne darüber zu informieren. Gleichzeitig haben sich nicht nur die Containerraten versechsfacht, sondern sind auch die Schifffahrtsraten um das vierfache gestiegen als die vor der Pandemie im Jahr 2019 üblich war. „Die Auswirkungen von Lockdowns auf die Warenproduktion und die Nachfrageverschiebungen aufgrund der Auswirkungen der Covid-Pandemie waren sicherlich erheblich. Aber die Fähigkeit der Schifffahrtsindustrie, diese Auswirkungen gemeinsam zu bewältigen und gleichzeitig Gewinne von insgesamt über 186 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf Kosten der übrigen Lieferkette und letztendlich der europäischen Verbraucher zu erzielen, zeigt, dass etwas nicht stimmt“, heißt es in einer Stellungname aus dem Global Shipping Forum und weiter: „Die Vorteile der Ausnahmen vom allgemeinen Wettbewerbsrecht für die Reedereien werden nicht gerecht zwischen den Reedereien und der übrigen Wirtschaft verteilt, was allein schon ein zwingender Grund dafür ist, die Gruppenfreistellung dringend zu überprüfen.“
Faire und Transparente Preise beim Container Shipping gefordert
In ihrem Schreiben an die Kommission weisen die Unterzeichner auf die Enthüllungen und Empfehlungen der Untersuchungen hin, die in den Vereinigten Staaten von der Federal Maritime Commission, FMC, im Mai durchgeführt wurden. Abschließend heißt es darin: „Die Überprüfung der Verordnung wird es allen Interessensgruppen ermöglichen, Beweise und Argumente dafür vorzulegen, wie die Kommission vorgehen sollte, um sicherzustellen, dass der Hochsee-Containerschifffahrtsmarkt auf faire und transparente Weise für alle Parteien in der maritimen Lieferkette funktioniert. Dies sollte die Prüfung neuer Maßnahmen und Mechanismen umfassen und genügend Zeit einräumen, um diese vor dem Auslaufen der derzeitigen Verordnung im April 2024 zu prüfen und umzusetzen.“
CONTAINERSTAU – MRS-CMC bietet Parking-Lösung für beladene Container
Containerstau (Foto: Rainer Sturm / www.pixelio.de)
Mit einer Art Parking-Lösung für beladene Container will der US-amerikanische Containerspezialist Marine Repair Services-Container Maintenance Corporation (MRS-CMC) dem Container-Rückstau auf US-amerikanischen Häfen und dem Frachterstau vor den Küsten der USA entgegenwirken. Reeder, Spediteure und Verlader können hier ihre Ladungen gewissermaßen „parken“.

14:51 Unternehmen / Ausland
Seefracht: DHL und Hapag-Lloyd setzen auf nachhaltigen Schiffskraftstoff
Mit ihrer Zusammenarbeit wollen die Unternehmen die Skalierbarkeit nachhaltiger Transportlösungen demonstrieren.
DHL Global Forwarding und Hapag-Lloyd haben sich die Dekarbonisierung der Containerschifffahrt und Logistik auf die Fahnen geschrieben. (Bild: DPDHL / Hillebrand)
DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist von Deutsche Post DHL Group, hat eine Vereinbarung mit Hapag-Lloyd, einer der weltweit führenden Linienreedereien, über die Verwendung moderner Biokraftstoffe unterzeichnet. Das gaben die Unternehmen am 7. Juli bekannt. In einem ersten Schritt will Hapag-Lloyd für 18.000 TEU des für DHL verschifften Seefrachtvolumens Biokraftstoffe verwenden und dadurch 14.000 Tonnen an CO2-Emissionen (Well-to-Wake) einsparen. Die beiden Unternehmen teilten die Vision einer Dekarbonisierung der Containerschifffahrt und Logistik, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit ihrer Zusammenarbeit haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, die Skalierbarkeit nachhaltiger Transportlösungen und die Relevanz moderner Biokraftstoffe im heutigen Marktumfeld zu demonstrieren. Sowohl DHL als auch Hapag-Lloyd setzen sich für einheitliche Branchenstandards auf Basis des Carbon-Insetting-Ansatzes ein.
1 / 1
Überblick über die Kooperation zwischen DPDHL Global Forwarding und Hapag Lloyd. (Grafik: DPDHL)
Biokraftstoffe basieren der Mitteilung zufolge auf biologischen Reststoffen wie Altspeiseöl und anderen Abfallprodukten. Aus diesen Rohstoffen wird demnach ein Fettsäuremethylester (FAME) hergestellt, der dann mit unterschiedlichen Anteilen an schwefelarmem Heizöl gemischt wird. Im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen reduziert dieser reine Biokraftstoff die Treibhausgasemissionen um mehr als 80 Prozent.
„Auf unserem Pfad zur Klimaneutralität bis 2045 werden Biokraftstoffe in den nächsten Jahren eine bedeutende Rolle spielen. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden ein nachhaltiges kommerzielles Transportprodukt auf der Basis von Biokraftstoff bieten und ihnen so helfen, ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Diese Kooperation wird uns diesem Ziel einen Schritt näherbringen,“ sagt Danny Smolders, Managing Director Global Sales bei Hapag-Lloyd.
Weiterführende Inhalte
Geplanter Hub im Segro Park Coventry Gateway: Die Anlage soll über 500.000 Sendungen pro Tag abwickeln. (Bilder: DHL)
E-Commerce: DHL investiert 560 Millionen Euro in Großbritannien
Mit ihren Nachhaltigkeitsstrategien haben sich DHL und Hapag-Lloyd Unternehmensangaben zufolge das Ziel gesetzt, ihre Emissionen bis 2050 beziehungsweise 2045 auf Netto-Null zu reduzieren. In diesem Zusammenhang haben sich beide Unternehmen dazu verpflichtet, nachhaltige Logistiklösungen und Zugang zu nachhaltigen Kraftstoffen für eine schnellere Dekarbonisierung der Logistikindustrie bereitzustelle
Seefracht zwischen Engpässen und drohender Überkapazität
Nach dem Allzeithoch haben die Frachtraten für Container nachgegeben. Neue Kapazitäten könnten einen wahren Preisverfall auslösen.
Rainer Weihofen
Die Reederei Evergreen hat das derzeit grösste Containerschiff der Welt in Dienst gestellt.
Die Reederei Evergreen hat das derzeit grösste Containerschiff der Welt in Dienst gestellt. (Bild: Jerry Lampen/EPA)
Die taiwanesische Containerreederei Evergreen Marine erlangte im März 2021 unfreiwillige Berühmtheit, als sich ihr Schiff «Ever Given» im Suezkanal verkeilte. Vergangene Woche hat sie das grösste Containerschiff der Welt in Betrieb genommen. Mal wieder das grösste, muss man sagen. Die «Ever Alot» ist 400 Meter lang, 62 Meter breit und hat Platz für etwas mehr als 24’000 TEU (20-Fuss-Container).
Es ist das siebte Schiff der Evergreen-A-Klasse, das seit Mitte vergangenen Jahres in Dienst gestellt wurde. Die Vorgänger waren gemessen an der Transportkapazität nur unwesentlich kleiner und bis dahin die Grössten. Sieben weitere dieser Giganten sind derzeit in chinesischen Werften im Bau.
Durchgeschüttelter Markt
Mit den vierzehn Schiffen kommt Transportkapazität für knapp 340’000 TEU auf einen Markt, der seit Beginn der Coronapandemie kräftig durchgeschüttelt worden ist. Zunächst brachen die Exporte von China nach Europa oder den USA ein, denn chinesische Produktionsbetriebe mussten schliessen. Die Reeder reduzierten ihre Linienverbindungen, um die Frachtraten bei einbrechender Nachfrage zu schützen. Mitte 2020 lagen fast 12% aller Containerschiffe auf Reede – gegenüber 2 bis 4% in krisenfreien Zeiten.
Containerschiffe Mitte Mai vor Cuxhaven: Aktuell warten etwa ein Dutzend in der Deutschen Bucht
Containerschiffe Mitte Mai vor Cuxhaven: Aktuell warten etwa ein Dutzend in der Deutschen Bucht Foto:
Rust / IMAGO
Krieg und Corona haben die Lieferketten der Weltwirtschaft kräftig durcheinander gebracht – und führen vor zahlreichen Häfen zu teils langen Staus und Verzögerungen. Diese Folgen in der Containerschifffahrt haben laut dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) nun auch die Nordsee erreicht.
ANZEIGE
Anzeige
»Erstmals seit Ausbruch der Pandemie stauen sich Containerschiffe auch in der Nordsee vor den Häfen Deutschlands, Hollands und Belgiens«, heißt es in dem nun veröffentlichten Handelsindikator
. »Hier stecken gegenwärtig knapp zwei Prozent der globalen Frachtkapazität fest und können weder be- noch entladen werden.«
Viele Exporte von China nach Deutschland entfallen
Allein in der Deutschen Bucht warten demnach etwa ein Dutzend große Containerschiffe mit einer Kapazität von insgesamt etwa 150.000 Standardcontainern auf das Anlaufen in Hamburg oder Bremerhaven. Vor den Häfen Rotterdam und Antwerpen sei die Lage noch dramatischer. Dagegen habe sich der Containerschiffstau vor Los Angeles und dem südlichen Kalifornien wieder gänzlich zurückgebildet.
ANZEIGE
Wie der Traum vieler jetzt wahr werden könnte
Der Traum vom flexiblen Leben und Arbeiten zwischen Deutschland und einem Zweitwohnsitz im Süden ist realistischer, als viele denken. Möglich macht dies ein innovatives Eigentumskonzept. So funktioniert es
Vor Shanghai und der angrenzenden Provinz Zheijang seien gegenwärtig über drei Prozent der globalen Frachtkapazität im Stau gebunden. Bisher sind laut IfW wegen des Lockdowns in Shanghai Exporte im Wert von bis zu 700 Millionen Euro von China nach Deutschland entfallen.
4000 Kilometer Seeweg weniger
Kombi-Terminal Horb Foto: F.Matzner
Ein neues Kombi-Terminal spart 4000 Kilometer Seeweg ein. Und: Wie sich die Lieferzeit um acht Tage verkürzen lässt.
27.05.2022 Ralf Lanzinger
Das Kombi-Terminal im Horber Industriegebiet nimmt Fahrt auf. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hat mit den Investoren und Vertretern aus Wirtschaft und Politik den ersten Spatenstich für das Infrastrukturprojekt vorgenommen. Das Kombi-Terminal dient der Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene dient. Mit dem neuen Logistikweg, den es in dieser Form im südlichen Baden-Württemberg bisher noch nicht gibt, kann eine seeseitige Umfahrung von halb Europa eingespart werden. Und auch Tonnen von CO2 werden nicht in die Atmosphäre emittiert.
4000 Kilometer Wegstrecke
Pro Containerschiff werden rund 4000 Kilometer Wegstrecke vermieden, was eine Lieferzeitverkürzung von bis zu acht Tagen bedeutet. Rechnerisch werden dadurch pro Schiffstransport auf dem Weg von Port Said am Suez-Kanal bis nach Hamburg knapp 8000 Tonnen CO2 eingespart. Die Horber Verladestation liegt in der Mitte der Schienenverbindung zwischen den deutschen Nordhäfen und dem Seehafen an der italienischen Adriaküste. Der Bau des Terminals soll zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Dazu wird die Gleisanlage zu großen Teilen erneuert und reaktiviert. Die moderne Infrastrukturanlage für das Einzugsgebiet zwischen Stuttgart und Bodensee wird bisher unerschlossene Logistikströme über die Schiene ermöglichen. Logistikketten sollen dadurch nachhaltiger und effizienter gestaltet werden können.
Container zwischenlagern Copyright Eurotransport.de
Später wird das KTH durch das Intermodale Servicezentrum Horb ergänzt. Auf dieser Depotfläche, auf der es auch Reparatur- und Serviceeinrichtungen geben wird, können dann Container zwischengelagert werden. Die Baugenehmigung in Form des Planfeststellungsbeschlusses für das Kombi-Terminal Horb wurde seitens des Regierungspräsidiums Karlsruhe in der „Rekordzeit“ von gerade einmal neun Monaten erteilt, wie Investor
Kurt Plathe, Eigentümer der Firma Plathe Grundbesitz mit Sitz in Neubulach, lobend erwähnte, als er Regierungspräsidentin Sylvia Felder auf der Baustelle begrüßte.
Auch der Kreis Freudenstadt und die Stadt hätten die Idee von Anfang an unterstützt
. Der Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger betonte, dass das Kombi-Terminal „auf dem Weg zur Klimaneutralen Kommune“ als Katalysator in manchen Debatten herhalten könne. Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Baden–Württemberg, bescheinigte Kurt Plathe „Hartnäckigkeit, mit der er manches Hindernis aus dem Weg räumte“.
Gemeinsam in die „Zugkunft“
Die Verantwortlichen auf kommunaler Seite hätten verinnerlicht, dass man nur gemeinsam in die „Zugkunft“ starten könne. „Heute ist ein richtig guter Tag für Horb, die Menschen und das Klima“, brachte Krenz seine Eindrücke auf den Punkt. Die entscheidenden Schritte zur Finanzierung der digitalen Zufahrtsweiche als Grundvoraussetzung für die Einschleusung der bis zu 500 Meter langen Containerzüge in den Bahnverkehr zu allen Tageszeiten habe zweifellos der frühere Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel (CDU) unternommen, so Plathe. Fuchtel habe dafür gesorgt, dass der Bund über die DB Netze AG die Kosten übernimmt.
Der Impuls für das KTH sei von den Industrie- und Handelskammern gekommen, die vor über zehn Jahren nach einem Standort suchten, sagte Plathe. Auf die Fläche im Industriegebiet Heiligenfeld habe ihn dann der Haiterbacher Logistik-Unternehmer Horst Schuon aufmerksam gemacht, nachdem zuvor ähnliche Pläne in der Nachbargemeinde Eutingen gescheitert seien. „Wenn wir unsere Betriebe in eine nachhaltige Zukunft führen wollen, müssen wir uns der gesamten Wertschöpfung widmen“, machte Claudia Gläser, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald, deutlich. Mit der Reaktivierung bestehender Gleisanlagen in Horb sei den Investoren und der Stadt ein „cleverer Schachzug“ in ihrem Streben nach mehr Nachhaltigkeit gelungen. Das Kombi-Terminal verbessere die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, die dadurch ihre wertschöpfungsintensiven Arbeitsplätze
erhalten könnten.
Allianz-Studie Häfen weltweit überlastet
Stand: 10.05.2022 09:46 Uhr
Die internationalen Handelshäfen kommen einer Studie zufolge mit dem Umschlag nicht hinterher. Lockdowns in China, aber auch fehlende Container bremsen den Welthandel – wahrscheinlich noch monatelang.
Die Pandemie und der Ukraine-Krieg führen dazu, dass die großen internationalen Handelshäfen derzeit rund um den Globus den Warentransfer nicht wie gewünscht abarbeiten können. Der zur Allianz gehörende Industrieversicherer AGCS geht davon aus, dass sich die Probleme nicht schnell lösen lassen.
In ihrer Analyse der Schifffahrtsrisiken zeichnet die AGCS-Studie ein düsteres Bild der derzeitigen Situation. So werde etwa allein im weltgrößten Hafen Shanghai eine Rückkehr zum Normalbetrieb nach dem derzeit noch andauernden Lockdown Monate dauern. Eine Prognose sei schwierig, da dies sowohl von den Maßnahmen der chinesischen Behörden als auch der Entwicklung der Pandemie in China abhänge.
Frachtflugzeug der Lufthansa Cargo | dpa
28.02.2022
Luft- und Schifffahrt Krieg verschärft Lieferkettenprobleme
Wegen Corona sind die globalen Lieferketten ohnehin noch gestört – jetzt kommt der Ukraine-Krieg hinzu.
„Man muss mehr Container bauen“
Unabhängig von aktuellen Einschränkungen des Handels durch die Pandemie sind die Frachtkapazitäten in der Handelsschifffahrt nach Einschätzung der Allianz-Tochter AGCS insgesamt zu knapp. Deswegen hätten große internationale Reedereien 7,5 Millionen neue Container bestellt, so Experte Anastasios Leonburg: „Man muss wesentlich mehr Container bauen, die dann in den Umlauf kommen.“
Die Schifffahrt erlebt derzeit laut der Studie eine „noch nie da gewesene Überlastung der Häfen“. Ausgelöst wurde sie durch teilweise großen Verzögerungen vieler Branchen bei der Belieferung mit Rohstoffen und Zulieferteilen mit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren.
Das Containerschiff „McKinney Moller“ in Cadiz (Spanien). | dpa
09.02.2022
Container-Schifffahrt Maersk fährt Rekordgewinn ein Copyright Tagesschau
Die knappen Transportkapazitäten durch angespannte Lieferketten haben Maersk einen Gewinn von 18 Milliarden US-Dollar eingebracht.
Schiffe sitzen in ukrainischen Häfen fest
Die Sondersituation in der Branche hat neue Risiken entstehen lassen oder bestehende Risiken erhöht. So werden wegen der fehlenden Schiffskapazitäten auch konventionelle Frachschiffe inzwischen zum Transport der Container eingesetzt, alte Schiffe werden länger genutzt und Wartungsintervalle nicht eingehalten.
Auch der Krieg in der Ukraine schafft dem Versicherer zufolge neue Risiken. Im Schwarzen Meer seien bereits Schiffe verloren gegangen, andere säßen in den Häfen in der Ukraine fest. Für Schiffe gibt es eine eigene Kriegsversicherung, die anders als die Kasko-Versicherung einspringt, wenn Schiffe verloren gegeben werden müssen. Nach einer festgelegten Wartefrist von sechs bis zwölf Monaten können Schiffe, die nicht mehr aus den Häfen wegkommen, als Totalverlust deklariert werden.
Nicht zuletzt stellt auch ein Öl-Embargo gegen Russland ein potenzielles Risiko für die Schifffahrt dar. Denn wenn das Schweröl knapp werde, könnten Reeder gezwungen sein, andere, vielleicht minderwertige Kraftstoffe zu verwenden, die zu Schäden an der Maschine führten.
Schriftzug Hapag-Lloyd | dpa
Exklusiv
19.04.2022
Vorwürfe gegen Hapag-Lloyd „Räuberische Geschäftspraktiken“
US-Abgeordnete werfen Hapag-Lloyd vor, ihre Preise zu Lasten von Verbrauchern unverhältnismäßig erhöht zu haben.
Weniger, aber größere Schäden
Die Zahl der Totalverluste hat sich in der internationalen Schfffahrt im Laufe der vergangenen zehn Jahre zwar mehr als halbiert, so Justus Heinrich, Leiter der AGCS-Schiffsversicherung in Mitteleuropa. 2012 gab es demnach noch 127 gesunkene oder irreparabel beschädigte Schiffe. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 54.
Doch da Containerschiffe immer größer werden, finden sie bei Bränden an Bord häufig keinen Hafen mehr, den sie anlaufen können. So sank im vergangenen Jahr der unter singapurischer Flagge fahrende Frachter „X-Press Pearl“ nach einem fast zwei Wochen dauernden Brand vor der Küste Sri Lankas.
Häfen
Lockdown
Lieferengpässe
Schiffahrt
Con
Auftragsbestand für neue Containerschiffe auf 14-Jahres-Hoch
Auftragsbestand für neue Containerschiffe auf 14-Jahres-Hoch
Die Engpässe im globalen Containerverkehr auf See haben das Orderbuch der Werften weltweit auf ein 14-Jahres-Hoch steigen lassen
© Foto: Rinson Chory / unsplash
In nur achtzehn Monaten wurden die Auftragsbücher für Containerschiffe um 6 Millionen TEU erweitert.
noch keine Bewertung
Datum: 07.04.2022
Autor: Stefanie Schuhmacher/ dpa
Lesezeit: 3 min NOCH KEINE Kommentare
#Seefracht #Container #Güterverkehr
News direkt aufs Smartphone!
VR Express: Der tägliche Newsletter für aktuelle Nachrichten aus Transport, Logistik und Spedition.
Hamburg/Kopenhagen. Die Engpässe im globalen Containerverkehr auf See haben das Orderbuch der Werften weltweit auf ein 14-Jahres-Hoch steigen lassen. Im Oktober 2020 hatte der Auftragsbestand mit einer Kapazität knapp unter 2 Millionen Standardcontainern (TEU) einen Tiefstand nach der Finanzkrise erreicht, wie der internationale Reederverband Bimco am Donnerstag in Bagsværd bei Kopenhagen berichtete. In den achtzehn Monaten seither hätten die Linienreedereien Rekordgewinne erzielt, die zu einem großen Teil in Neubauaufträge geflossen seien. „In nur achtzehn Monaten wurden die Auftragsbücher für Containerschiffe um 6 Millionen TEU erweitert“, sagte Bimco-Analyst Niels Rasmussen. „Damit hat der Auftragsbestand zum ersten Mal seit Ende 2008 die Marke von 6,5 Millionen TEU überschritten.“
Weltweit sind 25,5 Millionen TEU auf der Wasserstraße
In der weltweiten Containerschifffahrt sind nach Angaben des Branchendienstes Alphaliner derzeit Schiffe mit einer Kapazität von 25,5 Millionen TEU unterwegs. Mehr als 80 Prozent davon entfallen auf die Top 10 der Branche. „Zusätzlich zu den Auslieferungen von Neubauten müssen wir davon ausgehen, dass sich die Überlastungsprobleme in der Welt allmählich lösen werden“, sagte Rasmussen. Dadurch könnten zusätzlich bis zu zwei Millionen TEU an effektivem Angebot freigesetzt werden. Ob damit die Transportkapazitäten auf den Ozeanen in gleichem Maß steigen, ist aber fraglich. Denn angesichts wachsender Vorgaben bei der Energieeffizienz kämen Reedereien nicht umhin, Schiffe abzuwracken. Für andere müssten die Reeder die Fahrgeschwindigkeit drosseln, was auch die Verfügbarkeit von Transportkapazität mindert.
Deutsche Werften profitieren nicht
Deutsche Werften profitieren von der boomenden Nachfrage nach Containerschiffen nicht, weil die Fertigung dieser Schiffe längst nach Asien abgewandert ist. Aber die weltweit führende deutsche Zulieferindustrie, die etwa Antriebstechnik liefert, ist gleichwohl indirekt mit im Boot.
Die Corona-Pandemie hat die Abläufe im globalen Containerverkehr stark durcheinandergebracht, und die Konjunkturerholung nach der Corona-Rezession sorgt zusätzlich für hohe Nachfrage nach Transportleistungen. All dies führt dazu, dass die Reeder längst nicht alle Aufträge abwickeln können – mit entsprechendem Druck auf die Preise für Transporte, die Frachtraten, die wiederum die Abnehmer und Waren und damit die Verbraucher belasten. (ste/dpa)
Transport & Logistik
Krieg drückt Wirtschaftswachstum – Risiko für Containermarkt
article publisher
Transport & Logistik
Das Wichtigste der letzten 24 Stunden
Reeder fordern Ausreise: Etwa 100 Schiffe sitzen in der Kriegsregion fest
Etliche Handelsschiffe scheuen die Fahrt durch das Kriegsgebiet im Schwarzen Meer. Deutsche Reeder fordern eine freie Ausreise der Frachter.
handelsblatt.com
Maersk Container | picture alliance / CHROMORANGE
Weltgrößte Containerreederei Maersk stoppt russische Transporte
Stand: 01.03.2022 13:01 Uhr
Der Containerriese Maersk und andere große Reedereien setzen wegen des Ukraine-Kriegs alle Lieferungen von und nach Russland aus. Ausgenommen sind humanitäre Güter. Auch für den Hamburger Hafen haben die Sanktionen Folgen.
Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat die dänische Containerreederei Maersk den Großteil der Transporte von und nach Russland auf Eis gelegt. „Da die Stabilität und Sicherheit unseres Betriebs direkt und indirekt schon durch die Sanktionen beeinflusst wird, werden neue Maersk-Buchungen über See und Land nach und von Russland vorübergehend ausgesetzt“, teilte der Konzern mit Sitz in Kopenhagen mit. Russische Häfen würden „bis auf Weiteres“ nicht mehr angelaufen.
Das Containerschiff „McKinney Moller“ in Cadiz (Spanien). | dpa
09.02.2022
Container-Schifffahrt Maersk fährt Rekordgewinn ein
Die knappen Transportkapazitäten durch angespannte Lieferketten haben Maersk einen Gewinn von 18 Milliarden US-Dollar eingebracht.
Humanitäre Güter werden weiter geliefert
Ausgenommen seien demnach Lieferungen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und weiteren humanitären Gütern. Damit wolle Maersk seine „soziale Verantwortung“ unterstreichen sowie seine Bemühungen, die Bevölkerung „trotz aller Komplikationen und Unsicherheiten“ zu unterstützen. Die Reederei werde die Lage weiter beobachten und das Geschäft mit Russland wieder aufnehmen, „sobald wir Stabilität und Sicherheit“ wieder gewährleisten können, erklärte der dänische Konzern.
Aufträge, die vor Inkrafttreten der Sanktionen gegen Russland erteilt wurden, wolle die Reederei aber unter Berücksichtigung der Strafmaßnahmen versuchen zu erledigen. Maersk betreibt Containerschifffahrtsrouten nach St. Petersburg und Kaliningrad in der Ostsee, Novorossiysk im Schwarzen Meer und nach Wladiwostok und Wostochny an der russischen Ostküste. Etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Russland.
Darüber hinaus gehören Maersk 31 Prozent des russischen Hafenbetreibers Global Ports, der sechs Terminals in Russland und zwei in Finnland betreibt. „Mit Global Ports prüfen wir, wie wir die sich ständig weiterentwickelnden Sanktionen und Beschränkungen einhalten können, und bereiten mögliche nächste Schritte vor“, hieß es von der weltgrößten Containerrederei. Einen Buchungsstopp für die Ukraine hatte der Konzern bereits am Donnerstag bekanntgegeben. Dort hat Maersk 60 Angestellte.
Hafen von Odessa | picture alliance / Zoonar
24.02.2022
Sorge um Mitarbeiter Wie deutsche Firmen nun reagieren
Die ersten Unternehmen reagieren auf den russischen Einmarsch in der Ukraine.
Zoll muss Transporte von Hamburg nach Russland einzeln genehmigen
Ähnliche Entscheidungen wie Maersk trafen das in Singapur ansässige Logistikunternehmen Ocean Network Express (ONE) sowie die Schweizer Reedereigruppe MSC. Auch Hapag-Llloyd hatte in der vergangenen Woche eine vorübergehende Buchungssperre für Russland und die Ukraine beschlossen. Die Hamburger Traditionsreederei hatte am Freitag erklärt, ihren wöchentlichen Liniendienst von der Hansestadt nach Kaliningrad vorerst auszusetzen.
Zwischen Hamburg und Russland gibt es nach Angaben des Hafens aktuell zehn Liniendienste: sieben mit St. Petersburg und drei mit Kaliningrad. In Deutschlands größtem Seehafen soll es künftig Beschränkungen geben: Ab sofort seien alle Warentransporte aus dem Hamburger Hafen nach Russland nur noch mit Einzelgenehmigungen des Zolls erlaubt, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. Die „automatische Überlassung von Waren nach Russland“ sei gestoppt worden.
Die britische Regierung verbot Schiffen, die in irgendeiner Weise mit Russland in Verbindung stehen, die Einfahrt in Häfen des Vereinigten Königreichs. Auch die Europäische Union (EU) droht mit einem Einlaufverbot.
Ukraine Russland Handel Maersk
Der Versand von Waren auf dem Seeweg ist derzeit besonders teuer. Binnen zwei Jahren hat sich der Preis versechsfacht.
Preisanstieg des Containertransports seit 2020
(Quelle: Statista)
Das Statistikportal Statista beziffert die Buchung eines 40-Fuß-Containers auf derzeit 9.806 US-Dollar (8.614 Euro), also 548 Prozent mehr als 2020. Vor genau zwei Jahren mussten hierfür lediglich 1.514 US-Dollar (1.329 Euro) aufgewendet werden. Wie die Grafik weiterhin zeigt, ist der Warenversand von China in Richtung Europa und den USA besonders kostenintensiv. Hintergrund: Nach dem Ende der Lockdowns führte eine Mischung aus stark anspringender Nachfrage und extrem knappen Kapazitäten bei Containern zu dem Preisanstieg. Entsprechend stiegen auch die Aktienkurse von Reedereien wie Moeller-Maersk oder Hapag-Lloyd – und die Preise für importierte Waren.
Containerschifffahrt bezeichnet den Gütertransport mit Schiffen, welche für den Transport von ISO-Containern ausgelegt sind. Besagte Standardcontainer sind in zwei verschiedenen Größen vorzufinden. Es werden Container mit einer Länge von 20 Fuß (ein angelsächsisches Maß, entspricht 6,096 Metern) oder mit einer Länge von 40 Fuß (12,192 m) verwendet. Container werden in der Regel in der Einheit Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) gezählt. Ein TEU entspricht dabei einem 20-Fuß-Container.
Containerschifffahrt steigt deutlich
Die ersten Container kamen Mitte der 1950er Jahre in der weltweiten Seefahrt zum Einsatz. In Deutschland wurde der erste Container im Jahr 1966 im Bremer Überseehafen umgeschlagen. Die weltweite Containertransportmenge ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Im Jahr 2015 belief sich die weltweite Containertransportmenge auf rund 136 Millionen TEU. Laut Prognosen sollen es im Jahr 2022 etwa 161 Millionen TEU sein. Im Jahr 2020 ging die Containertransportmenge jedoch coronabedingt leicht zurück. Regional betrachtet sind die Verkehre zwischen Nordamerika und Europa am stärksten zurückgegangen.
IfW: Weiterhin Stau in der Containerschifffahrt

Kiel (dpa) – Staus auf den internationalen Routen der Containerschifffahrt behindern weltweit weiterhin die Versorgung mit Gütern und Rohstoffen. «Rund 11 Prozent aller weltweit verschifften Waren stecken derzeit in Staus fest», berichtete das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Montag. «Im Roten Meer, der wichtigsten Handelsroute zwischen Europa und Asien, sind aktuell rund 11 Prozent weniger Waren unterwegs als üblich.»
Parallel legt indes der Welthandel kräftig zu und liegt inzwischen nach Einschätzung der IfW-Volkswirte mittlerweile sogar über dem Niveau vor der Corona-Krise. Vor diesem Hintergrund interpretiert IfW-Ökonom Vincent Stamer die anhaltenden Lieferengpässe als «Ausdruck einer extrem schnell gestiegenen Nachfrage, der das Angebot nicht hinterherkommt».
Verbraucher und Unternehmen leiden seit vielen Monaten unter hartnäckigen Störungen der globalen Lieferketten. Die Corona-Pandemie hat die Fahrpläne der Linienreedereien durcheinander gebracht, unter anderem weil immer wieder Häfen nach Coronaausbrüchen geschlossen wurden. Hinzu kommt, dass die Konjunktur vor allem in der weltweit größten amerikanischen Volkswirtschaft früher und kräftiger angezogen hat als hierzulande. Das sorgt dafür, dass die weltweiten Transportkapazitäten über die Maßen ausgelastet sind.
Die mit der gegenwärtigen Omikron-Welle so stark wie noch nie eskalierende Pandemie sieht das IfW bislang zwar in erster Linie als Gefahr für China, nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das könnte sich aber ändern: «Es ist zu befürchten, dass Verzögerungen in Chinas Containerumschlag auch Europas Handel in Mitleidenschaft ziehen würden», sagt Stamer. «Das chinesische Neujahrsfest und die Ausrichtung der Olympischen Spiele sind eine Bewährungsprobe für China, dass sich die pandemische Situation und damit auch der wirtschaftliche Ausblick nicht verschlechtert.»
Die chinesischen Behörden bekämpfen bereits kleinere Infektionsstränge mit harten Maßnahmen. In den vergangenen Wochen verhängten sie in mehreren Millionenstädten im Land Lockdowns. Dadurch kam es unter anderem zu Produktionsstopps in Fabriken, logistischen Verzögerungen und einem Einbruch des Binnenkonsums.
© dpa-infocom, dpa:220207-99-11266/3
Container-Engpässe verschärfen sich weiter – 564 Schiffe warten vor Häfen

Container-Engpässe verschärfen sich weiter – 564 Schiffe warten vor Häfen
Ein neues Verspätungsbarometer des Schweizer Logistikers Kühne + Nagel zeigt: Die Wartezeiten für Container nähern sich einem neuen Höchststand. Dafür gibt es einen Schuldigen.
19.01.2022 – 15:05 Uhr

Container-Stau im Hafen Los Angeles
Probleme in den USA sind für 80 Prozent der weltweiten Schiffsverspätungen verantwortlich.
(Foto: imago images/ZUMA Wire)
Düsseldorf Deutsche Einzelhändler und Industriekunden, die mit einem Ende der weltweiten Lieferverzögerungen nach dem angespannten Weihnachtsgeschäft gerechnet hatten, werden in diesen Tagen enttäuscht. Das geht aus einem globalen Datenabgleich hervor, den der Schweizer Speditionskonzern Kühne + Nagel (K+N) unter dem Titel „Global Disruption Indicator“ ab diesem Donnerstag täglich veröffentlichen will.
Die Zahlen, die dem Handelsblatt vorab vorliegen, sind weiterhin gekennzeichnet von einer angespannten Versorgungslage. So befinden sich der Statistik zufolge aktuell sogar mehr Schiffscontainer vor den weltweiten Häfen in Wartestellung als vor Weihnachten. „Die Situation wird keineswegs besser“, erklärt K+N-Vorstand Otto Schacht, „und das, obwohl Weihnachten nun vorbei ist.“
Jetzt weiterlesen
19.01.2022 – 15:05 Uhr

Container-Stau im Hafen Los Angeles
Probleme in den USA sind für 80 Prozent der weltweiten Schiffsverspätungen verantwortlich.
(Foto: imago images/ZUMA Wire)
Düsseldorf Deutsche Einzelhändler und Industriekunden, die mit einem Ende der weltweiten Lieferverzögerungen nach dem angespannten Weihnachtsgeschäft gerechnet hatten, werden in diesen Tagen enttäuscht. Das geht aus einem globalen Datenabgleich hervor, den der Schweizer Speditionskonzern Kühne + Nagel (K+N) unter dem Titel „Global Disruption Indicator“ ab diesem Donnerstag täglich veröffentlichen will.
Die Zahlen, die dem Handelsblatt vorab vorliegen, sind weiterhin gekennzeichnet von einer angespannten Versorgungslage. So befinden sich der Statistik zufolge aktuell sogar mehr Schiffscontainer vor den weltweiten Häfen in Wartestellung als vor Weihnachten. „Die Situation wird keineswegs besser“, erklärt K+N-Vorstand Otto Schacht, „und das, obwohl Weihnachten nun vorbei ist.“
Jetzt weiterlesen
Vollversammlung Verbände warnen vor Zusammenbruch der Lieferketten wegen
Warum die Lieferketten weiterhin stocken
Auch Monate nach der Blockade des Suez-Kanals gibt es noch immer Probleme / Wann entspannt sich der Containerverkehr?
Unternehmen fehlen Bauteile, und das bestellte Fahrrad ist seit Monaten überfällig. Wo globale Transportketten sonst wie Uhrwerke funktionieren, herrscht in der Corona-Pandemie großes Durcheinander – zum Verdruss von Wirtschaft und Verbrauchern, die Materialmangel und Lieferprobleme auf eine Geduldsprobe stellen.
Volkswirte und Logistikexperten rechnen damit, dass die Probleme auch 2022 noch anhalten werden. So spektakulär die Bilder von der tagelangen Havarie des Megamax-Frachters „Ever Given“ im März im Suezkanal waren: Das Problem ist viel hartnäckiger, als dass es sich nur mit diesem einen Schiffsunglück erklären ließe.
„Es ist leider offen, wann sich die Situation bei den Lieferketten nachhaltig verbessern wird. Ich bin aber sicher, dass wenn wir die Pandemie besiegt haben, wann immer das sein wird, dann wird das auch alles wieder besser fließen“, sagt die neue Präsidentin des Verbandes Deutscher Reeder, Gaby Bornheim. Die angespannten Lieferketten seien ganz klar Folge der Corona-Pandemie.
„Wir können unsere Seeleute immer noch nicht einfach so an Bord bringen, wie wir das gewohnt waren und sie auch nicht ungehindert von Bord holen“, berichtet die Chefin der Hamburger Peter Döhle Schiffahrts-KG, eine der größten deutschen Reedereien. „Da sind erhebliche Restriktionen, die sich in den einzelnen Häfen im Wochen-, manchmal auch im Tagesrhythmus ändern, so dass wir gar keine Sicherheit haben, jetzt Crewwechsel in vielen Teilen der Welt durchführen zu können.“
Lange Zeit waren auch fehlende Container ein großes Problem, weil die Transportboxen wegen Verspätungen in den Fahrplänen nicht dort waren, wo sie zur neuen Beladung sein sollten. Normalerweise sind Container zum Beispiel bei Hapag-Lloyd 50 Tage unterwegs, bevor sie wieder beladen werden können. Aufgrund der Überlastungen der Häfen sind es jetzt mehr als 60 Tage. Um das auszugleichen, hat allein die Hamburger Großreederei seit 2020 insgesamt 625 000 neue Transportboxen eingekauft.
Häfen werden zum Nadelöhr
Als gewaltiges Nadelöhr erweisen sich schließlich viele Häfen – vor allem die an der chinesischen Küste und der amerikanischen Westküste, zwischen denen die riesigen Handelsströme zwischen den beiden größten Volkswirtschaften abgewickelt werden. In China wurden immer wieder Häfen ganz oder teilweise geschlossen, weil Hafenarbeiter coronainfiziert waren. Schiffe müssen tagelang auf das Be- und Entladen warten oder auf andere Häfen ausweichen, vor denen sich dann ebenfalls große Staus bilden. Wegen der sehr strikten Reaktion der chinesischen Behörden und der beispiellosen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Coronavariante Omikron dürften geschlossene Hafenterminals in China auch 2022 ein Thema bleiben.
Schiffe auf Reede, Lkw ohne Fahrer
Auch vor dem Port of Los Angeles und vor Long Beach in direkter Nachbarschaft, den beiden wichtigsten Häfen an der US-Westküste, liegen massenhaft Schiffe auf Reede, im Herbst waren es zeitweise bis zu 100. Zudem funktionieren die Hinterlandverkehre nicht, wie sie sollten, auch weil es nicht genügend Lkw-Fahrer gibt.
Der Ökonom Vincent Stamer, der beim Kiel Institut für Weltwirtschaft regelmäßig weltweite Schiffsbewegungen analysiert, schätzt, dass derzeit mehr als elf Prozent der weltweit verschifften Güter auf unbewegten Schiffen parkt – eine gewaltige Menge, bedenkt man, dass 90 Prozent der globalen Warenströme per Containerschiff transportiert werden.
Zum Jahresende hin beobachtet Stamer zwar eine leichte Entspannung bei den Staus. Aber: „Es ist zu vermuten, dass die Entspannung bei den Staus in der Containerschifffahrt eine Folge der gedämpften Handelsaktivität ist, keine Trendwende hin zu wieder flüssigeren Abläufen.“ Erste Besserung könnte sich im Februar zeigen. „Obwohl die Nachfrage immer noch hoch ist, hoffen wir, dass es nach dem chinesischen Neujahrsfest erste Anzeichen für eine allmähliche Dekompression in den Lieferketten geben wird“, schreibt Hapag-Lloyd zum Jahreswechsel in einer Nachricht an die Kunden.
Verzögerungen noch weit ins neue Jahr
Auch Stamer sieht das Neujahrsfest in China als erste wichtige Wegmarke. Das Fest ist traditionell ein Höhepunkt des Konsums im bevölkerungsreichsten Land der Welt, danach ebbt die Konsumnachfrage deutlich ab. „Doch auch dann dürfte es noch dauern, bis das globale Liefernetzwerk wieder im Gleichtakt schwingt. Lieferverzögerungen und Engpässe könnten uns daher noch sehr weit ins nächste Jahr beschäftigen“, erwartet der Kieler Wirtschaftsforscher.
lno
Coronakrise

China öffnet Containerterminal wieder Für Schiffsstau-geplagte Reeder ist Erleichterung in Sicht

Weltweite Hamsterkäufe – Deutschland hat das Nachsehen Copyright Norddeutsche Rundschau danke Ralph Poeschus
Hamburg Der konjunkturelle Boom nach der Corona-Rezession führt weltweit zu Hamsterkäufen der Unternehmen. Dabei haben europäische und vor allem deutsche Unternehmen oft das Nachsehen, während die USA im Rennen um die heiß begehrten Zulieferungen die Nase vorn haben. Das ist das Ergebnis einer Welthandelsstudie des Kreditversicherers Euler Hermes. Erklärt wird das Missverhältnis mit der ungleichzeitigen Erholung von den Folgen der Lockdowns. Die US-Konjunktur kam im laufenden Jahr deutlich früher und kraftvoller wieder in Gang als in Europa. Die Folge: Warenlieferungen aus China in die USA nähmen derzeit um rund 30 Prozent zu, nach Europa hingegen nur um etwa 10 Prozent. „Hamsterkäufe sind aktuell in im globalen Handel“, sagte der Chef von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Ron van het Hof. „Die USA haben im Rennen um die Waren dabei allerdings klar die Nase vorne – unter anderem aufgrund der früheren Wiedereröffnung.“ Unternehmen versuchten überall händeringend, ihre Lagerbestände aufzufüllen. „Das ist aktuell allerdings kein Selbstläufer: Angesichts der anhaltenden Engpässe in der Versorgungskette, insbesondere bei den Schiffscontainern selbst, und den längsten Verspätungen seit einem Jahrzehnt steigen die Preise und damit Kosten des Welthandels im Galopp auf neue Rekordhöhen.“ Die meisten europäischen Länder und insbesondere Deutschland hätten in dieser Lage Mühe, ihre ohnehin niedrigen Lagerbestände wieder aufzufüllen.
Der Studie der Allianz-Tochter zufolge hat sich der Welthandel im laufenden Jahr überraschend schnell und stark erholt. Für das Gesamtjahr rechnen die Volkswirte von Euler Hermes beim Volumen der weltweit gehandelten Waren und Dienstleistungen mit einem Plus von 7,7 Prozent, nach 8 Prozent Minus im Vorjahr. Wegen deutlicher Preiserhöhungen dürfte demnach der Handel dem Wert nach sogar um 15,9 Prozent zulegen, nach einem Minus von 9,9 Prozent 2020.
Der Einbruch bei Angebot und Nachfrage sei der Treiber hinter dem Einbruch des Welthandels 2020 gewesen, schrieben die Ökonomen. „Für den diesjährigen Anstieg des Werts der gehandelten Waren und Dienstleistungen macht die Normalisierung der Angebots- und Nachfragebedingungen allerdings nur etwa 15 Prozent aus – die Aufstockung der Lagerbestände hingegen etwa 50 Prozent.“ Die knappen Schiffskapazitäten mit höheren Preisen machen demnach rund 35 Prozent aus. Containerreedereien verlangen derzeit kräftig steigende Preise für globale Gütertransporte, die zu rund 90 Prozent auf See abgewickelt werden. „Schiffskapazitäten dürften kurzfristig auch weiterhin knapp bleiben“, sagte van het Hof. „Gründe dafür sind neben dem regional sehr ungleichmäßigen Aufschwung die unzureichenden Investitionen der letzten Jahre in der Seeschifffahrt.“

Gestandene Seefrachtexperten haben es in ihren Berufsleben schon einige Male erlebt, dass Reedereien den Markt „überbauen“, die Nachfrage nicht Schritt hält und Raten und Schiffswerte ins Bodenlose stürzen. Den krassesten Einbruch erlebte die Linienschifffahrt 2009 in der Weltfinanzkrise. Copyright DVZ
Die Branche hatte darauf spekuliert, dass der „China-Boom“ mit zweistelligen Zuwachsraten im globalen Verkehr anhalten würde, und zu diesem Zweck auf Teufel komm raus investiert. Die Folge: Überkapazitäten für rund ein Jahrzehnt, und das, obwohl der Containerverkehr nach 2009 wieder zu wachsen begann, nur eben viel moderater als im Jahrzehnt davor. Eine so gravierende Fehleinschätzung – einige nannten es auch schlichtweg „Gier“ – sollte der Containerschifffahrt nie mehr unterlaufen.
Reeder geben Zurückhaltung auf
Bis Ende vergangenen Jahres hielten die Reedereien auch Disziplin. Was dann passierte, verschlug vielen die Sprache. Im vierten Quartal 2020 und ersten Quartal dieses Jahres legten Carrier – und teils auch Tramp-Reeder – Neubauaufträge für Schiffe von zusammen 2,6 Millionen TEU Kapazität nach. Einen solchen Ansturm auf die Werften hatte die Welt der Containerschifffahrt noch nicht gesehen.
Anders als in früheren Zyklen sind die Investitionen diesmal größtenteils durch die Linien selbst getrieben und nur zu einem geringen Teil durch Tramp-Reeder, die keinen eigenen Zugang zur Ladung haben und ihre Schiffe verchartern müssen. Einige Experten betrachten die Flut an Bestellungen deshalb als rationaler und weniger spekulativ als in früheren Zyklen. Sie unterstellen den Linien ein tieferes Verständnis der Entwicklungen auf der Ladungsseite.
Die Gretchenfrage ist: Rechtfertigt die Transportnachfrage wirklich einen so hohen Kapazitätszubau? Dabei ist die Sicht nach vorne alles andere als klar. Seit Corona wird der Markt hauptsächlich durch Engpässe und Effizienzverluste entlang der Transportkette bestimmt. Die Rundläufe der Schiffe und der einzelnen Container haben sich drastisch verlängert, die Produktivität in den Häfen und im Hinterland ist aufgrund von Sicherheits- und Quarantänemaßnahmen erheblich gesunken. Die effektive Kapazität wird somit begrenzt, auch wenn die Flottenkapazität sogar angewachsen ist.
Was passiert nun, wenn die Pandemie eines Tages überwunden ist und die Produktivität in der Containerschifffahrt wieder anzieht? Die schlummernde Kapazität, die dann freigesetzt wird, könnte das Angebot an Transportleistung Schätzungen zufolge um 3 Prozent oder mehr nach oben treiben. Dabei sind Neubauablieferungen noch gar nicht miteinbezogen. In einem Markt, der auf eine möglichst synchrone Ausweitung von Angebot und Nachfrage angewiesen ist, weil Frachtraten und Assetwerte (Schiffe) sonst empfindlich zur einen oder anderen Seite ausschlagen, können Differenzen von ein paar Prozentpunkten absolut gravierend sein.
Aufgrund der raschen Erholung im Containerverkehr ab dem dritten Quartal 2020 sank das weltweite FCL-Ladungsvolumen im vergangenen Jahr nur leicht um 1,2 Prozent. Für dieses Jahr liegen die Erwartungen verschiedener Marktforschungshäuser wie Clarksons Platou oder Alphaliner bei rund plus 6 Prozent. Allerdings sorgen jüngste Daten des britischen Dienstleisters Container Trades Statistics (CTS), der seine Daten direkt von den Carriern bezieht, jetzt für Unsicherheit in der Branche.
Demnach lagen die weltweiten Verladungen im Mai nahezu unverändert gegenüber Mai 2019 – vor der Pandemie. Ist dies ein erstes Indiz dafür, dass die Erholung im Weltcontainerverkehr an Schwung verliert? Oder liegt es nur daran, dass die Flotte längst zu 100 Prozent ausgelastet ist und gar nicht mehr Ladung gebucht werden kann?
Skeptiker verweisen darauf, dass der Höhepunkt bei der Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität laut Einkaufsmanager-Indizes für Nordamerika bereits überschritten scheint. Optimisten führen Berichte aus der Bulkschifffahrt an, wonach erhebliche Ladungsmengen, die bislang containerisiert waren, jetzt wieder „lose“ in Bulk verschifft werden müssen. Die Containerverkehrsdaten werden wohl erst über die kommenden Monate mehr Klarheit bieten.
Doch – Ladungswachstum hin oder her – spätestens 2023, wenn ein Großteil des heutigen Schiffbauauftragsbuchs zur Ablieferung kommt, dürfte der Frachtenmarkt in der Containerschifffahrt ernsthaft auf die Probe gestellt werden. Die Zuwachsrate der Flotte wird laut Clarksons Platou dann auf plus 8 Prozent hochschnellen – von plus 4,5 Prozent in diesem Jahr und plus 2,6 Prozent im Jahr 2022. Dass das Verkehrswachstum wird Schritt halten können, ist unwahrscheinlich. Das letzte Mal, dass die Volumina derart stark zugenommen haben, war direkt nach der Finanzkrise. Zuvor waren sie aber – anders als zu Corona-Zeiten – fast ebenso stark geschrumpft. Um den Markt auszugleichen, werden die Reedereien wohl zu drastischen Maßnahmen greifen müssen, wie in früheren Krisenphasen: für jedes neue Schiff gleichzeitig ein älteres in die Abwrackung geben. (ol)

Infografik Das Herz der Globalisierung: Containerschifffahrt in 5 Grafiken Copyright Handelsblatt
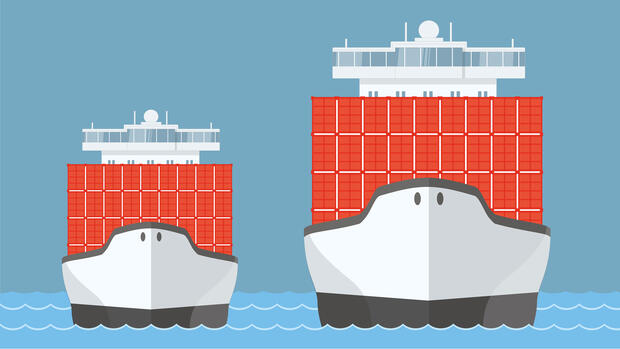
In vielen Seehäfen verzögern sich die Abläufe wegen Pandemieschutzbestimmungen, viele Seefahrer sind noch nicht geimpft. Die Folge: Containerschiffe können nicht abgefertigt werden, Frachtraten schießen nach oben.
Etwa vier Fünftel des globalen Handelsvolumens wird über die Weltmeere abgewickelt. Doch erst die Havarie eines Containerschiffs im Suezkanal hat der breiten Öffentlichkeit gezeigt, wie wichtig der Seeverkehr für den Welthandel ist – und wie anfällig für Störungen.
Aktuell verzögert sich in vielen Seehäfen die Abfertigung der Frachtschiffe wegen Pandemieschutzbestimmungen, viele Seefahrer sind noch nicht geimpft. Die Staus vor den Häfen werden immer länger. Folge: Noch mehr Kapazitäten fehlen am Markt, die Frachtraten steigen weiter.
Mehr zum Thema: Die weltweiten Engpässe im Frachtverkehr werden in den kommenden Monaten auch die Verbraucher in Deutschland spüren. Bei welchen Händlern bald leere Regale und höhere Preise drohen – und wer die Krise meistert.
IfW: Weiter Stau im Container-Schiffsverkehr in China

Das Wichtigste in Kürze
- Die globalen Güterströme werden im Süden Chinas weiter massiv behindert.
- Einzelne Häfen haben weniger als die Hälfte ihrer üblichen Containermenge verschifft.
- Unternehmer weltweit sorgen sich davor, dass der Welthandel ins Chaos stürzt.
Der Mega-Schiff-Stau im Süden Chinas behindert weiter massiv die globalen Güterströme. «Die Anzahl wartender Containerschiffe im chinesischen Perlflussdelta ist ungewöhnlich hoch. Einzelne Häfen wie Yantian haben weniger als die Hälfte ihrer üblichen Containermenge verschifft», berichtete das Kieler Institut für Weltwirtschaft am Montag.

«Gegenwärtig sind bereits knapp fünf Prozent aller Containerschiff-Kapazitäten durch Staus an den chinesischen Häfen gebunden. Das ist mehr als in der ersten Corona-Welle», schreiben die Wirtschaftsforscher. Im Roten Meer zwischen Nordafrika und der arabischen Halbinsel, seien daher «aktuell zehn Prozent weniger Containerschiffe unterwegs, als zu erwarten wäre».
Längst ein grösseres Problem als das Suezkanal-Chaos
Der Stau im chinesischen Hafen Yantian wurde ausgelöst von einem Corona-Ausbruch unter Hafenarbeitern. In der Schifffahrtsindustrie gilt er längst als grösseres Problem als der einwöchige Stau am Suezkanal Ende März. Dieser war damals bekanntlich durch die Havarie des Containerfrachters «Ever Given» verursacht worden.

Die weltgrösste Container-Reederei Maersk hatte ihren Kunden zwar zuletzt am Freitag signalisiert, dass sich die Überlastung in Yantian allmählich auflöse – «aber es ist zu beachten, dass wenn ein Hafen betroffen ist, dies zu einer Abwärtsspirale für benachbarte Häfen werden kann».
Materialengpässe in Europa
Die coronabedingten Störungen im weltweiten Container-Schiffsverkehr sind eine der Ursachen für Materialengpässe in Europa. Sie sorgen nach Einschätzung vieler Volkswirte dafür, dass die Industrie ihre prall gefüllten Auftragsbücher derzeit nur zum Teil abarbeiten kann. Auch für die von der Corona-Krise schwer gebeutelten Schweizer Unternehmer ist das ein harter Schlag.

Das IfW wertet mit einem neuen Analyse-Tool weltweit Schiffsbewegungen aus, um so Rückschlüsse auf die Entwicklung der globalen Handelsströme zu ziehen. Dabei werden an- und ablegende Schiffe in 500 Häfen weltweit erfasst. Zusätzlich werden Schiffsbewegungen in 100 Seeregionen analysiert, anhand des Tiefgangs wird ausserdem die effektive Auslastung der Containerschiffe gemessen.
Weltwirtschaft Coronavirus Stau
Letzte Meinungen

China schweigt folgenschweren Container-Stau aus

IfW: Weiter Stau im Container-Schiffsverkehr in China
Aktualisiert:
Institut für Weltwirtschaft
Lieferengpässe kosten Wirtschaft fast 25 Milliarden Euro
Fehlende Rohstoffe und Vorprodukte, verzögerte Lieferungen. Erst im Verlauf des dritten Quartals ist etwas Besserung in Sicht.
Kiel – Die Engpässe und Verzögerungen in den globalen Lieferketten dürften die deutsche Volkswirtschaft nach Schätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) 2021 rund 25 Milliarden Euro kosten.
Die Ökonomen gehen in ihrer veröffentlichten Analyse davon aus, dass die „Belastungen erst im Verlauf des dritten Quartals leicht abnehmen und sich erst danach eine deutliche Besserung einstellt“. Allein im zweiten Quartal dürfte demnach die deutsche Wirtschaftsleistung durch die Zuspitzung der Liefersituation um etwa ein Prozent gedrückt worden sein.
Die Industrie, aber auch viele Handwerker beklagen seit Monaten, dass dringend benötigte Rohstoffe und Vorprodukte fehlen oder verzögert geliefert werden. Die Gründe sind vielschichtig: Zum einen lässt die anziehende Konjunktur der Schwergewichte USA und China viele Güter knapp und teuer werden. Zum anderen hat die Corona-Pandemie die globalen Lieferrouten in der Containerschifffahrt durcheinandergewirbelt, unpünktliche Schiffsankünfte sind seit langem an der Tagesordnung. Das Ergebnis: Die Industrie sitzt zwar auf prall gefüllten Orderbüchern, kann die Aufträge aber nicht abarbeiten.
„Sobald sich die Lieferengpässe lösen, wird die Industrieproduktion durch zwei Faktoren Rückenwind erhalten und für einige Zeit voraussichtlich deutlich stärker zulegen als die neu eingehenden Auftragseingänge“, prognostiziert das IfW. Zum einen werde es Aufholeffekte geben, sobald die Industrie ihre Produktion wieder auf das übliche Niveau hochfährt. „Das derzeitige Niveau der Auftragseingänge spricht für einen Anstieg der Industrieproduktion um etwa 10 Prozent.“ Zum anderen gebe es Nachholeffekte, sobald die aufgestauten Aufträge abgearbeitet würden. „Dadurch wird die Produktion vorübergehend über ihr langfristig normales Niveau ansteigen.“ dpa
Auch interessant
Copyright Joerg Potent
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/nach-havarie-einigung-auf-entschaedigung-fuer-blockade-von-suez-kanal-durch-ever-given/27354498.html?share=fb
Einigung auf Entschädigung für Blockade von Suez-Kanal durch „Ever Given“
Laut einem Vertreter des japanischen Eigentümers stehen die Parteien kurz vor einer Unterschrift. Dann soll das Schiff wieder freigegeben werden.
23.06.2021 – 12:52 Uhr Kommentieren

Ever Given im Suezkanal
Die „Ever Given“ war am 23. März bei starkem Wind auf Grund gelaufen, hatte sich schräg gestellt und so den Kanal sechs Tage lang blockiert.
(Foto: via REUTERS)
Ismailia Der Eigner des im März im Suez-Kanal havarierten Container-Schiffes „Ever Given“ hat eigenen Angaben zufolge eine Einigung mit der ägyptischen Kanal-Behörde über eine Entschädigungszahlung erzielt. Man habe sich prinzipiell auf einen Schadenersatz für die tagelange Blockade der viel befahrenen Wasserstraße einigen können, wie ein Vertreter des japanischen Eigentümers Shoei Kisen und dessen Versicherers am Mittwoch mitteilte.
Es werde daran gearbeitet, so schnell wie möglich zu einer Unterschrift zu kommen. Sobald die Formalitäten erledigt seien, werde die Freigabe des von der Behörde festgehaltenen Schiffes vorbereitet. Diese forderte zunächst 916 Millionen Dollar für Bergung, Reparatur und Einnahmeausfälle, ging dann aber auf 550 Millionen Dollar herunter.
Beide Seiten hatten wegen der Festsetzung des Schiffes vor Gericht gestritten. Dessen Entscheidung war eigentlich für vergangenen Sonntag angesetzt, wurde aber nach Angaben aus Justizkreisen auf Antrag des Eigners auf den 4. Juli verschoben, um eine gütliche Einigung zu erzielen.
Die „Ever Given“ war am 23. März bei starkem Wind auf Grund gelaufen, hatte sich schräg gestellt und so den Kanal sechs Tage lang blockiert. Hunderte Schiffe konnten die Wasserstraße nicht passieren, was den weltweiten Handel erheblich störte. Am 29. März wurde das riesige Container-Schiff wieder freigelegt und liegt seither auf Basis eines ägyptischen Gerichtsurteiles in einem See zwischen zwei Kanal-Abschnitten vor Anker.
Themen des Artikels
Copright Handelsblatt
Porträt
Ein Mal Revolution zum Mitnehmen
http://www.welt.de/wirtschaft/article155639447/Fast-neue-Frachter-landen-in-der-Schrottpresse.html
| Autor: Benedikt Hofmann
Am 26. April 1956 stach mit der „Ideal X“ das erste Containerschiff in See und gab den Startschuss für die Containerisierung, die unser aller Leben nachhaltig beeinflussen sollte. Der Visionär hinter der Idee war Malcom McLean, der Sohn eines Farmers aus North Carolina. Manchmal beginnen Revolutionen ganz leise und es wird erst Jahre später klar, wie bedeutend ein Ereignis war, von dem kaum jemand Notiz genommen hat. Ein Beispiel hierfür begab sich am 26. April 1956, als ein umgebauter Tanker aus dem Zweiten Weltkrieg namens „Ideal X“ im Hafen von Newark im US-Bundesstaat New Jersey beladen wurde und wenig später in Richtung Houston ablegte. Es war der Beginn der Containerisierung und damit des modernen Welthandels, auch wenn das erst keiner bemerkte und später viele nicht wahrhaben wollten. Erdacht und auf die Reise geschickt wurden das Schiff und dessen außergewöhnliche Ladung von Malcom McLean, der auf einer Farm in Maxtom in North Carolina aufgewachsen war und schon früh sein Talent für das Transportgeschäft zeigte. Nachdem er mit einigen Gelegenheitsjobs genug Geld zusammenbekommen hatte, um die Anzahlung für einen gebrauchten Pick-up-Truck zu leisten, gründete er 1934 die Spedition McLean Trucking. Am Steuer eines seiner Trucks war es auch, als er 1937 gedanklich die ersten Schritte in Richtung der Entwicklung machte, für die ihn das Fortune Magazine 1982 in die „Business Hall of Fame“ aufnahm. McLean selbst erzählte die Geschichte, wie er im Hafen von Hoboken hinter dem Steuer saß und sich unglaublich langweilte. Wie alle anderen Güter, die an diesem Tag verladen werden sollten, mussten auch die Baumwollballen, die McLean geladen hatte, einzeln von seinem Lkw und dann auf das Schiff geladen werden. Es bildeten sich lange Schlangen und es dauerte mehrere Tage, bis ein großes Schiff beladen war. Für Fuhrunternehmen war das eine kleine Katastrophe, da wartende Lkw damals wie heute kein Geld verdienen. In einem Interview mit dem Fachmagazin American Shipper drückte McLean es 1996 wie folgt aus: „Der Gedanke, dass es doch viel leichter wäre, meinen ganzen Anhänger zu verladen, kam mir, als ich dort wartete.“
Nicht der Erste, aber der Visionärste
Ähnlich wie Carl Benz, der in Deutschland gemeinhin als der Erfinder des Automobils gilt, aber bei Weitem nicht der Erste war, der sich mit dem Konzept durch Verbrennungsmotoren angetriebener Fahrzeuge beschäftigte, war auch McLean nicht der Erste, der sich über einen Warentransport mittels größerer mobiler Transportbehälter Gedanken machte. Bereits im 18. Jahrhundert wurden hölzerne Umverpackungen eingesetzt, die als Vorläufer des Containers gelten können. Später kamen in verschiedenen Ländern Bahncontainer zum Einsatz, für die es beispielsweise in Großbritannien schon erste Normen gab. Im Jahr 1933 wurde dann das Bureau internationale de Container (BIC) in Paris gegründet. Es sollte eine Lösung für den Containertransport entwickeln, die international zum Einsatz kommen konnte. Das Vorhaben scheiterte aber, wie es so häufig der Fall ist, an Zweiflern, die sich nicht vorstellen konnten, dass die Vorteile, die durch den Containertransport entstehen, die nötigen Investitionen in Infrastruktur und Gerätschaften aufwiegen könnten.
Diese Sorge zu widerlegen blieb McLean überlassen, der seit den langen Tagen, die er wartend in seinem Lkw zugebracht hatte, immer weiter an seiner Idee tüftelte. Vor die Umsetzung hatten die US-Wettbewerbshüter aber noch einige Hürden gestellt. Dem Kartellrecht zufolge durfte er als Spediteur keine Schifffahrtslinie betreiben, was einen echten Pionier und Visionär aber natürlich nicht aufhält. Um seine Idee umsetzen zu können, verkaufte er sein Unternehmen 1955 und erwarbt die Reederei Pan Atlantic Steamship. Zusätzlich investierte er in Lkw, Kräne, Container und natürlich Schiffe, die er für seine Zwecke umbauen lies. Mit der ersten Fahrt der Ideal X bewies er dann, dass es sich sehr wohl rechnete. Das Schiff konnte viel schneller be- und entladen werden und sparte so nicht nur Zeit, sondern senkte die Kosten des Hafenaufenthalts auch um rund 90 %.
Nichts ist beständiger als der Zweifel
Den weltweiten Durchbruch für den Containertransport bedeutete das allerdings noch lange nicht. Gerade im in diesem Fall wirklich „alten Europa“ bestanden erhebliche Zweifel und auch ein gewisses Maß an Überheblichkeit gegenüber dieser neuen „Spinnerei“ aus den USA. So schrieb der Spiegel noch 1967 von der „gefährlichen Kiste“ und eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey beschwor ein geradezu apokalyptisches Hafen- und Reedereiensterben herauf.
Dennoch bestellten europäische Reedereien, wohl von der Angst, den Anschluss zu verlieren, getrieben, die ersten Containerschiffe. Und sie hatten durch ihre zweifelnde, abwartende Haltung – so ist die Geschichte eben manchmal – sogar noch einen Vorteil: Als der Containerhandel Fahrt aufnahm, verfügten sie über deutlich modernere und größere Schiffe als die amerikanischen Pioniere. Der Triumphzug des Containers war nicht mehr aufzuhalten, amerikanische Reedereien sollten allerdings nur noch eine Nebenrolle spielen. Der letzte Akt in McLeans Geschichte als Reeder endete 1999, als sein Unternehmen, das mittlerweile Sea-Land hieß, von Maersk, der weltweit größte Containerschiff-Reederei, übernommen wurde. Zuvor hat er aber auch deutsche Wirtschaftsgeschichte mitgeschrieben. Hierzulande feiert man dieser Tage 50 Jahre Containerschifffahrt nach Deutschland. Am 5. Mai 1966 legte mit der Fairland das erste Containerschiff im Überseehafen Bremen an. Natürlich unter der Flagge der Sea-Land-Linie von Malcom McLean. 110 Container hatte die Fairland an Bord, eine Nussschale im Vergleich zu den heutigen Ozeanriesen. Die Oscar und ihre Schwesterschiffe der Olympic-Serie, die als größte Containerschiffe der Welt gelten, bringen es auf 19.224 Standardcontainer (TEU).
Bild: Malcolm McLean at railing, Port Newark, 1957 von Maersk Line/ flickr / CC BY-SA 2.0
Fast neue Frachter landen in der Schrottpresse
Hapag-Lloyd: 50 Jahre Containerschifffahrt in Deutschland
Hapag-Lloyd: Allianz mit asiatischen Reedereien
Hapag-Lloyd beschließt Allianz mit asiatischen Reedereien | Hamburg News
http://www.focus.de/regional/hamburg/schifffahrt-reederei-uasc-beraet-ueber-zusammenschluss-mit-hapag-lloyd_id_5544076.html
Schifffahrt: Reederei UASC berät über Zusammenschluss mit Hapag-Lloyd – FOCUS Online
SchifffahrtReederei UASC berät über Zusammenschluss mit Hapag-Lloyd
Schifffahrt: Reederei UASC berät über Zusammenschluss mit Hapag-Lloyd – FOCUS Online
Das teilte die börsennotierte Hamburger Reederei am Mittwoch in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Die beiden Unternehmen verhandeln seit einigen Wochen darüber, ihre Aktivitäten in der Containerschifffahrt zusammenzuführen. UASC würde damit zum größten Einzelaktionär bei Hapag-Lloyd. Ein Vertrag liegt noch nicht vor. Die mögliche Transaktion bedarf der Zustimmung mehrerer Kartellbehörden, der zuständigen Organe und der Aktionäre von Hapag-Lloyd. Die Hauptversammlung von Hapag-Lloyd ist für den 1. Juni angesetzt.
Hapag-Lloyd: Allianz mit asiatischen Reedereien
“THE Alliance” wird eins der großen Bündnisse in der Containerschifffahrt sein. Das Netzwerk soll 18 Prozent der weltweiten Flottenkapazität vereinen
Hapag-Lloyd gründet gemeinsam mit der südkoreanischen Reederei Hanjin, den japanischen Schiffahrtsgesellschaften “K”Line, Mitsui O.S.K. Lines und Nippon Yusen Kaisha sowie der Reederei Yang Ming aus Taiwan eine neue Allianz. Diese soll alle Ost-West-Fahrtgebiete zwischen Asien und Europa sowie Asien und Nordamerika, das Transatlantikgebiet und Verbindungen zwischen Asien und dem Mittleren Osten abdecken. Ein entsprechender Vertrag wurde nun von den Partnern unterzeichnet, teilte Hapag Lloyd mit. „THE Alliance“ könnte demnach – unter der Bedingung, dass alle relevanten Wettbewerbsbehörden zustimmen – im April 2017 beginnen. Die Dauer der Kooperation wurde auf zunächst fünf Jahre festgelegt.
Platz 3 der internationalen Containerschifffahrt-Bündnisse
Mit dieser Partnerschaft entsteht nach Angaben der Mitgliedsreedereien eines der führenden Netzwerke in der Containerschifffahrt mit rund 18 Prozent der weltweiten Flottenkapazität. Zusammen sollen die sechs Allianz-Partner Flotten mit mehr als 620 Schiffen betreiben. Parallel zum neuen Allianz-Vertrag führt Hapag-Lloyd demnach Fusionsverhandlungen mit dem arabischen Konkurrenten UASC. Der Zusammenschloss könnte das Bündnis mit weiteren Kapazitäten stärken.
Nach Recherchen von welt.de stünde “THE Alliance” auf der Asien-Europa-Route mit 28 Prozent der Kapazitäten derzeit auf Rang drei der internationalen Bündnisse in der Containerschifffahrt. An der Spitze steht demnach die kürzlich angekündigte Ocean Alliance um die französische Reederei CMA CGM mit 35 Prozent der Kapazitäten, dicht gefolgt von 2M, dem bestehenden Bündnis der beiden Marktführer Maersk und MSC, mit 34 Prozent.
Wichtiger Schritt zur Konkurrenzfähigkeit
Nach Aussage der Mitgliedsreedereien ermöglicht die Kooperation den sechs Partnern das Angebot zusätzlicher Abfahrten und Direktverbindungen. Experten halten Netzwerke in der Containerschifffahrt angesichts fallender Frachtpreise für die Reedereien für überlebenswichtig. Können Waren in Containern von mehreren Partnern der Allianz verschifft werden, könnten mehr Häfen angelaufen und Kosten gespart werden.
ca/kk
Quellen und weitere Informationen:
Hapag-Lloyd gründet gemeinsam mit der südkoreanischen Reederei Hanjin, den japanischen Schiffahrtsgesellschaften “K”Line, Mitsui O.S.K. Lines und Nippon Yusen Kaisha sowie der Reederei Yang Ming aus Taiwan eine neue Allianz. Diese soll alle Ost-West-Fahrtgebiete zwischen Asien und Europa sowie Asien und Nordamerika, das Transatlantikgebiet und Verbindungen zwischen Asien und dem Mittleren Osten abdecken. Ein entsprechender Vertrag wurde nun von den Partnern unterzeichnet, teilte Hapag Lloyd mit. „THE Alliance“ könnte demnach – unter der Bedingung, dass alle relevanten Wettbewerbsbehörden zustimmen – im April 2017 beginnen. Die Dauer der Kooperation wurde auf zunächst fünf Jahre festgelegt.
Platz 3 der internationalen Containerschifffahrt-Bündnisse
Mit dieser Partnerschaft entsteht nach Angaben der Mitgliedsreedereien eines der führenden Netzwerke in der Containerschifffahrt mit rund 18 Prozent der weltweiten Flottenkapazität. Zusammen sollen die sechs Allianz-Partner Flotten mit mehr als 620 Schiffen betreiben. Parallel zum neuen Allianz-Vertrag führt Hapag-Lloyd demnach Fusionsverhandlungen mit dem arabischen Konkurrenten UASC. Der Zusammenschloss könnte das Bündnis mit weiteren Kapazitäten stärken. Nach Recherchen von welt.de stünde “THE Alliance” auf der Asien-Europa-Route mit 28 Prozent der Kapazitäten derzeit auf Rang drei der internationalen Bündnisse in der Containerschifffahrt. An der Spitze steht demnach die kürzlich angekündigte Ocean Alliance um die französische Reederei CMA CGM mit 35 Prozent der Kapazitäten, dicht gefolgt von 2M, dem bestehenden Bündnis der beiden Marktführer Maersk und MSC, mit 34 Prozent.
Wichtiger Schritt zur Konkurrenzfähigkeit
Nach Aussage der Mitgliedsreedereien ermöglicht die Kooperation den sechs Partnern das Angebot zusätzlicher Abfahrten und Direktverbindungen. Experten halten Netzwerke in der Containerschifffahrt angesichts fallender Frachtpreise für die Reedereien für überlebenswichtig. Können Waren in Containern von mehreren Partnern der Allianz verschifft werden, könnten mehr Häfen angelaufen und Kosten gespart werden.
Containerschifffahrt Krise – Containerfonds Anlegern drohen hohe Verluste
Mehrere zehntausend Anleger haben bundesweit Anteile an geschlossenen Containerfonds erworben. Gelockt von hohen Renditechancen und einer vermeintlich stetig wachsenden und somit auf Containergüter angewiesenen Weltwirtschaft, ließen sich viele Anleger, von deren Bank- oder Finanzberatern, in den letzten Jahren zum Kauf einer Beteiligung an einem geschlossenen Containerfonds überreden Mehrere zehntausend Anleger haben bundesweit Anteile an geschlossenen Containerfondserworben. Gelockt von hohen Renditechancen und einer vermeintlich stetig wachsenden und somit auf Containergüter angewiesenen Weltwirtschaft, ließen sich viele Anleger, von deren Bank- oder Finanzberatern, in den letzten Jahren zum Kauf einer Beteiligung an einem geschlossenen Containerfonds überreden. Infolge der sich bereits seit mehreren Jahren abzeichnenden Krise auf dem weltweiten Containerschiffmarkt, müssen die Anleger geschlossener Containerfonds, statt prognostizierter Ausschüttungen, zwischenzeitlich mit hohen Verlusten rechnen.
Containerschifffahrt Krise: Reedereien schlagen Alarm
Wie die Süddeutsche Zeitung in deren Onlineausgabe vom 12.02.2016 berichtet, betrachten Vertreter namhafter Reedereien – wie beispielsweise Maersk und Hapag Lloyd – den derzeitigen Preisverfall der Frachtraten mit großer Sorge. So wurden beispielsweise am größten deutschen Hafen und Europas zweitgrößtem Containerhafen– Hamburg – laut SZ Angaben 10 % weniger Container umgeschlagen, als noch ein Jahr zuvor. Wie die SZ weiter berichtet, ist Hamburg kein Einzelfall: So fiel der, die Frachtraten für Rohstoffe erfassende Baltic Dry Index, zwischenzeitlich bereits unter das Niveau von 2008 (Beginn der weltweitern Wirtschaftskrise). Der seit 1985 von der Londoner Baltic Exchange von Montag bis Freitag veröffentlichte Baltic Dry Index (BDI) ist ein weltweit anerkannter Indikator für die Preisbestimmung verschiffbarer Hauptfrachtgüter (z. Bsp. Eisenerz, Kohle und Getreide).
Baltic Dry Index: Deutlicher Preisverfall ersichtlich
Anhand des BDI zuletzt ermittelten Durchschnittspreises, für den Transport eines Containers auf einem Containerschiff der größten Schiffsklasse (Capesize), ist die Krise der Containerschifffahrt deutlich sichtbar: So kostete der Transport eines Containers laut SZ Angaben zuletzt gerade noch $ 2756. Dem gegenüber belaufen sich die durchschnittlichen Aufwendungen für die Reedereien, Expertenmeinungen zufolge, auf durchschnittlich $ 8.000,-.
Containerschifffahrt: Blick geht nach unten
Lange Zeit gab es für die weltweite Containerschifffahrt immer nur den Blick nach oben. Spätestens seit 2012 hat sich dieser Blick jedoch in das Gegenteil verkehrt. Die Gründe für den weltweiten Rückgang der Charterraten sind, Expertenmeinungen zufolge, vielschichtig: Der Rückgang, der bislang die Weltwirtschaft stützenden chinesischen Volkswirtschaft, die in vielen Schwellenländern wie Brasilien, Russland oder Mexiko schon seit längerem vorherrschenden Rezessionen, sowie der weltweite Ölpreisverfall, der bislang auch vermeintlich Krisenresistenten Staaten wie Saudi-Arabien zu schaffen macht.
Verheerende Folgen für Containerschifffahrt
Je weniger, ein bislang als Wirtschaftsmotor aufgetretener Staat einnimmt, desto weniger – allen voran per Container verschiffbare Güter – importiert er von anderen Staaten. Letztere geraten durch die rückgehenden Exportraten ihrerseits wiederum in den Abwärtsstrudel. Für die weltweite Containerschifffahrt hat diese Entwicklung verheerende Auswirkungen: Es werden weitaus weniger Container als noch in den Boomjahren bis 2012 benötigt.
Überangebot an Containerschiffen verschärft die Krise
Erschwerend für die weltweite Containerschifffahrt kommt die Tatsache hinzu, dass nicht zuletzt in den Boomjahren, aber auch noch danach, zahlreiche, immer größere Schiffe auf den Markt geworfen wurden. Laut SZ Recherchen war es etlichen Reedereien, selbst in den aufstrebenden Jahren der Containerschiffbranche, nur selten möglich, deren Schiffe in der Gewinnzone zu halten.
DWN: Containerschiffe als Vorboten der Krise
Auch die Autoren der Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN) sehen die Abwärtsentwicklung auf dem weltweiten Containerschiffmarkt mit großer Sorge. In deren aktuellen Artikel vom 07.03.2016,werden die Containerschiffe als Vorboten, einer immer tiefer in die Krise stürzenden Weltwirtschaft, ausgemacht. Vor dem Hintergrund der immer weiter zurückgehenden globalen Nachfrage und der, die Erlöse im Container-Handel deutlich übersteigenden Transportkosten, werden viele Reedereien – so das ernüchternde Fazit der DWN Autoren – im laufenden Geschäftsjahr hohe Verluste hinnehmen müssen.
Containerschiffmarkt: Ausblick in ungewisse Zukunft
Die weitere Entwicklung auf der weltweiten Containerschifffahrt bleibt auch 2016 ungewiss. Ob und inwieweit es gerade kleineren Reedereien in Zukunft gelingen wird, der Abwärtsspirale von sinkenden Charterraten und permanentem Überangebot auf Dauer Stand zu halten, bleibt ebenso abzuwarten, wie etwaige, die gesamte Containerschifffahrt noch tiefer in den Abwärtssog reißende konjunkturelle Einbrüche.
Containerfonds Anleger : Leidtragende der Krise
Die Verlierer der weltweiten Containerschifffahrt Krise stehen allerdings schon heute fest: Es sind die zahlreichen Anleger, die über deren Bank oder deren Finanzdienstleister in den vergangenen 10 Jahren Anteile an geschlossenen Containerfonds gezeichnet haben. Neben den, in den meisten Fällen ohnehin nie geflossenen und im Rahmen des Verkaufsgesprächs stets als sicher prognostizieren Ausschüttungen, werden sich die Zeichner geschlossener Containerfonds bei zunehmend anhaltender Krise auf dem weltweiten Containerschiffmarkt auf erhebliche Einbußen bis hin zu einem Totalverlust der investierten Einlage einstellen müssen.
Containerfonds Anleger nicht schutzlos gestellt
Betroffene Anleger geschlossener Containerfonds sollten sich mit deren Situation nicht abfinden, sondern umgehend den Rat eines, auf Bank- und Kapitalanlagerechts spezialisierten Rechtsanwalts suchen. Sollten betroffene Containerfonds Anleger von ihrem Anlageberater oder von ihrer Bank nicht umfassend über die Risiken einer Beteiligung an einem geschlossenen Containerfonds aufgeklärt worden sein, so bestehen möglicherweise Schadensersatzansprüche. Des Weiteren kommt für die Anleger von geschlossenen Containerfonds in Betracht, gegen die Initiatoren der Fonds und gegen den Vertrieb Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die Schadensersatzansprüche können sich zum einen aus Prospekthaftung, zum anderen aufgrund Falschberatung ergeben.
Was können betroffene Containerfonds Anleger jetzt tun?
Betroffenen Anlegern von geschlossenen Containerfonds wird geraten, ihre in Betracht kommenden Ansprüche durch einen auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage https://akh-h.de/news/containerschifffahrt-krise-containerfonds-anlegern-drohen-hohe-verluste
Hapag-Lloyd: 50 Jahre Containerschifffahrt in Deutschland
by schiffsjournal •
Ein halbes Jahrhundert nach Beginn der Containerschifffahrt hat sich die „Eintagsfliege“ als äußerst überlebensfähig erwiesen. Der Großteil des internationalen Warenverkehrs wird heute von weltweit 6.397 Containerschiffen abgewickelt. Als die Revolution vor 50 Jahren Deutschland erreichte, wurde zwar nicht geschossen. Es gab am 6. Mai 1966 in Bremen aber immerhin einen lauten Knall: Die am Vortag in den Überseehafen eingelaufene „Fairland“ der amerikanischen SeaLand Reederei hatte gerade begonnen, die ersten Container auf deutschem Boden abzusetzen, als gleich der zweite dieser damals neuartigen Transportboxen aus dem bordeigenen Krangeschirr rutschte und eine nagelneue Zugmaschine zerstörte. Glücklicherweise waren nur wenige Zeugen zugegen, die in dem Malheur ein schlechtes Omen für die noch junge Containerschifffahrt hätten sehen können. Den Siegeszug der Containerschifffahrt, der zehn Jahre zuvor in den USA begonnen hatte, konnte dieses Missgeschick bekanntlich nicht aufhalten – auch wenn die Skepsis gegenüber dem neuen Transportsystem in Deutschland zunächst noch ausgeprägt war. „Es wurde damals zunächst als Eintagsfliege abgetan“, erinnerte sich 50 Jahre später ein Zeitzeuge. Hapag-Lloyd: 50 Jahre Containerschifffahrt in Deutschland 
US-Spediteur Malcom McLean sah das ganz anders. Er gilt als Vater des modernen Containers McLean hatte bereits Mitte der 50er-Jahre die ersten Container in einheitlicher Größe zunächst im US-amerikanischen Küstenverkehr eingesetzt. Zehn Jahre später transportierte er mit seiner Reederei SeaLand die ersten Boxen über See nach Europa. Am 5. Mai 1966 lief sein Schiff „Fairland“ mit 255 Containern an Bord erstmals einen deutschen Hafen an – den Überseehafen in Bremen. Die beiden führenden deutschen Reedereien Hapag (Hamburg) und Norddeutscher Lloyd (Bremen) arbeiteten zu diesem Zeitpunkt schon auf vielen Feldern eng zusammen, die Fusion zur Hapag-Lloyd stand aber noch bevor. Die Container-Revolution wurde für diese zum wichtigsten Treiber. Allerdings ließ die fortschreitende Containerisierung an Weser und Elbe zunächst vor allem Alarmglocken schrillen. „Die Entwicklung des so genannten Behälter („Container“)-Verkehrs hat ein überstürztes Tempo angenommen“, warnte der Lloyd-Jahresbericht für 1965. Zu diesem Zeitpunkt hofften die Bremer noch auf „eine evolutionäre Entwicklung“ mit „Halbcontainerschiffen“ – vergebens. << Zum Video >> “Wie die Container bei Hapag-Lloyd verladen werden” Es kam bekanntlich anders. Und Hapag und Norddeutscher Lloyd setzten sich nun rasch mit an die Spitze der Bewegung. So führte der NDL im Juni 1966 einen der ersten kombinierten Haus-zu-Haus-Transporte von Stuttgart nach New York mit einem Container durch. Und bereits ein Jahr später waren sich die beiden Reedereien einig, dass der konventionelle Verkehr auf dem Nordatlantik keine Zukunftsaussichten mehr habe, und orderten bei Blohm + Voss und Bremer Vulkan die beiden ersten Vollcontainerschiffe mit einer Kapazität von je 736 Standardcontainer-Einheiten (TEU). Die „Weser Express“ und die „Elbe Express“ eröffneten dann im Herbst 1968 den ersten europäischen Vollcontainerdienst über den Atlantik nach New York. Die Hapag-Lloyd Container Linie, in denen die beiden Reedereien ihr Containergeschäft nun bündelten, war der entscheidende Schritt auf dem Weg zur kompletten Verschmelzung als Hapag-Lloyd im Jahr 1970. Hapag-Lloyd: 50 Jahre Containerschifffahrt in Deutschland
50 Jahre Containerschifffahrt nach Deutschland: Die Globalisierungskiste
Vor 50 Jahren legte das erste Containerschiff in Deutschland an – mit gerade mal 110 Containern. Heute wird alles in den Blechkisten transportiert. Die Geschichte der Containerschifffahrt in Bildern.
Bananen aus Südamerika, Elektronikartikel aus Asien, Kakaobohnen aus Afrika: Täglich haben wir Kontakt mit Produkten, die von einem anderen Kontinent kommen. In Containern verpackt, gelangt die Ware schnell und günstig nach Europa – seit einem halben Jahrhundert auch nach Deutschland.
Am 5. Mai 1966 machte das erste Containerschiff in einem deutschen Hafen fest: der Frachter „Fairland“ der amerikanischen Reederei Sea-Land. 110 Container hatte er an Bord, als er am Bremer Überseehafen anlegte. Seitdem sind die Schiffe deutlich größer geworden. 19.224 Container kann das aktuell größte Containerschiff, die MSC „Oscar“, transportieren. Die Transportboxen sparten Zeit und Arbeitskraft vor allem beim Be- und Entladen im Hafen. Als die Ware noch als Stückgut transportiert wurde, brauchte man 18 Männer, um 80 Tonnen von Bord zu bewegen. Dank den Containern schafften neun Hafenarbeiter 2000 Tonnen in der gleichen Zeit. Diese Effizienz sorgte nicht nur für Euphorie. Hafenarbeiter befürchteten in der Anfangsphase den Verlust ihrer Arbeitsplätze. Doch schließlich bescherten die Container den Häfen einen jahrzehntelangen Aufschwung.  Aktuell haben viele Häfen mit dem schwächelnden Welthandel zu kämpfen. So ging der Containerumschlag im Hamburger Hafen – dem größten Deutschlands – im vergangen Jahr um gut neun Prozent auf 8,8 Millionen Container zurück. Das entspricht dem Niveau von 2006.
Aktuell haben viele Häfen mit dem schwächelnden Welthandel zu kämpfen. So ging der Containerumschlag im Hamburger Hafen – dem größten Deutschlands – im vergangen Jahr um gut neun Prozent auf 8,8 Millionen Container zurück. Das entspricht dem Niveau von 2006.  Sehen Sie in der Bildergalerie, wie sich die Containerschifffahrt in den vergangenen 50 Jahren gewandelt hat und welche Probleme in den ersten Jahren auftauchten.
Sehen Sie in der Bildergalerie, wie sich die Containerschifffahrt in den vergangenen 50 Jahren gewandelt hat und welche Probleme in den ersten Jahren auftauchten.
ter/dpa
 Christoph Rottwilm9.413Containerfrachter im Hamburger Hafen: Derzeit so viel ungenutzter Frachtraum wie nie zuvor DPA Copyright
Christoph Rottwilm9.413Containerfrachter im Hamburger Hafen: Derzeit so viel ungenutzter Frachtraum wie nie zuvor DPA Copyright
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-wirtschaft_artikel,-Rickmers-Brueder-legen-ihre-Schiffsflotten-zusammen-_arid,1355423.html Rickmers-Brüder legen ihre Schiffsflotten zusammen – Wirtschaft: Aktuelle Nachrichten und Berichte – WESER-KURIER Copright
Rickmers-Brüder legen ihre Schiffsflotten zusammen
Ein neues Großunternehmen in der Containerschifffahrt entsteht im Norden. Die beiden Brüder Erck und Bertram Rickmers wollen die Flotten ihrer Hamburger Reedereien künftig gemeinsam betreiben.

Im Norden entsteht ein neues Großunternehmen in der Containerschifffahrt. Die beiden Brüder Erck und Bertram Rickmers wollen die Schiffsflotten ihrer Hamburger Reedereien gemeinsam betreiben. Das kündigten die voneinander unabhängigen Gesellschaften der Geschwister am Donnerstag an. Geplant sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das insgesamt rund 220 Schiffe bereedern soll. „Ziel ist es, die Kräfte in einem von starkem Wettbewerb gekennzeichneten Markt zu bündeln“, hieß es in der Mitteilung.
Gemeinsam würden die Firmen der Rickmers-Brüder eine der größten Charterreedereien Europas bilden. Zu ihrer zusammengelegten Flotte würden nicht nur Containerschiffe mit einer Ladekapazität von bis zu 13.600 Standardcontainern, sondern auch Massengutfrachter gehören.
Hintergrund ist die anhaltende Krise in der Containerschifffahrt. Die Frachtraten sind auf historisch niedrigem Niveau, zudem ist wegen des schwachen Wirtschaftswachstums in Ländern wie China die Nachfrage nach Seetransporten zurückgegangen. Gleichzeitig ist das Geschäft der Reeder von massiven Überkapazitäten geprägt: Die Werften bauen immer größere Schiffe, doch ihre Auslastung ist oftmals schlecht.
„International aufgestelltes Gemeinschaftsunternehmen“
Das Schifffahrtsgeschäft der Rickmers-Brüder geht zurück auf die Bremerhavener Rickmers-Werft, die 1834 von Rickmer Clasen Rickmers gegründet wurde. 1912 verlegte die Familie den Firmensitz nach Hamburg. Die Rickmers-Werft musste Mitte der Achtzigerjahre Insolvenz anmelden, 1986 lief dort das letzte Schiff vom Stapel. Die Rickmers-Linie ging 1988 an Hapag-Lloyd. Doch die beiden Brüder Erck und Bertram bauten neue Firmen auf, unter anderem eine Schiffsfinanzierungs-Gesellschaft.
In den Neunzigerjahren gingen die Brüder getrennte Wege. Bertram Rickmers führt heute die Rickmers Holding, die im Jahr 2000 die Rickmers-Linie zurückkaufte und derzeit knapp 130 Schiffe betreibt. Erck Rickmers steht hinter dem Unternehmen E.R. Schiffahrt mit einer Flotte von etwa 90 Schiffen.
Geplant ist jetzt, dass die E.R. Capital Holding von Erck Rickmers und die Rickmers-Holding seines Bruders ihr Schiffsmanagement „in einem international aufgestellten Gemeinschaftsunternehmen“ zusammenführen, wie es hieß. Die Gesellschaften hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die Prüfung werde einige Wochen in Anspruch nehmen.
Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) bezeichnete die Pläne als „vielversprechende Option“. Es komme für die Zukunftsfähigkeit von Reedereien „entscheidend darauf an, zu wettbewerbsfähigen Kosten anbieten zu können und sich über professionelle Dienstleistungen am Markt zu positionieren“.
Rickmers-Gruppe machte 2015 Verlust von 135 Millionen Euro
Im vergangenen Jahr hatte die Rickmers-Gruppe wegen der Branchenkrise einen Verlust von 135 Millionen Euro erwirtschaftet. Bei der Vorlage der Bilanz im März zeigte sich die Reederei auch für 2016 skeptisch und sagte einen Rückgang des Umsatzes und ein noch schlechteres Ergebnis voraus. Auch kündigte Rickmers ein Sparprogramm an, ohne jedoch Details zu nennen.
Mit dem nun geplanten Gemeinschaftsunternehmen dürfte der Belegschaft auch Stellenabbau drohen. Bislang beschäftigt die Rickmers-Holding gut 2000 Mitarbeiter, für die E.R. Schiffahrt arbeiten an Land und auf See rund 3500 Menschen. Bertram Rickmers war zuletzt in Kritik geraten, weil er sich trotz Krise von seinem Unternehmen Millionen als Lizenzgebühr für die Nutzung des Namens und der Rickmers-Flagge zahlen ließ.
Weltweit zwingt die heikle Lage der Schifffahrt die Reedereien dazu, Kosten einzusparen oder sich Partner zu suchen. Die weltweit größte Containerreederei Maersk will bis Ende 2017 insgesamt 4000 Stellen streichen. Um sich gegen die Krise zu wappnen, hat sich der deutsche Branchenprimus Hapag-Lloyd mit der chilenischen Reederei CSAV zusammengetan. Die französische Containerreederei CMA CGM hatte zuletzt die traditionsreiche Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei (OPDR) gekauft und befindet sich derzeit in der Übernahme des Konkurrenten NOL aus Singapur.
Die Rickmers-Gruppe verchartert ihre Schiffe an Linienreedereien wie CMA CGM und betreibt mit ihrer Rickmers-Linie zudem Mehrzweckfrachter, die auf Verbindungen nach Asien und Amerika unterwegs sind. Die Charterreedereien haben besonders stark unter der momentanen Flaute in der Containerschifffahrt zu leiden, weil sie Eigner von Sc